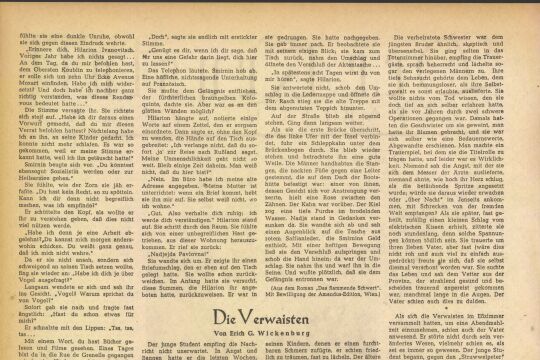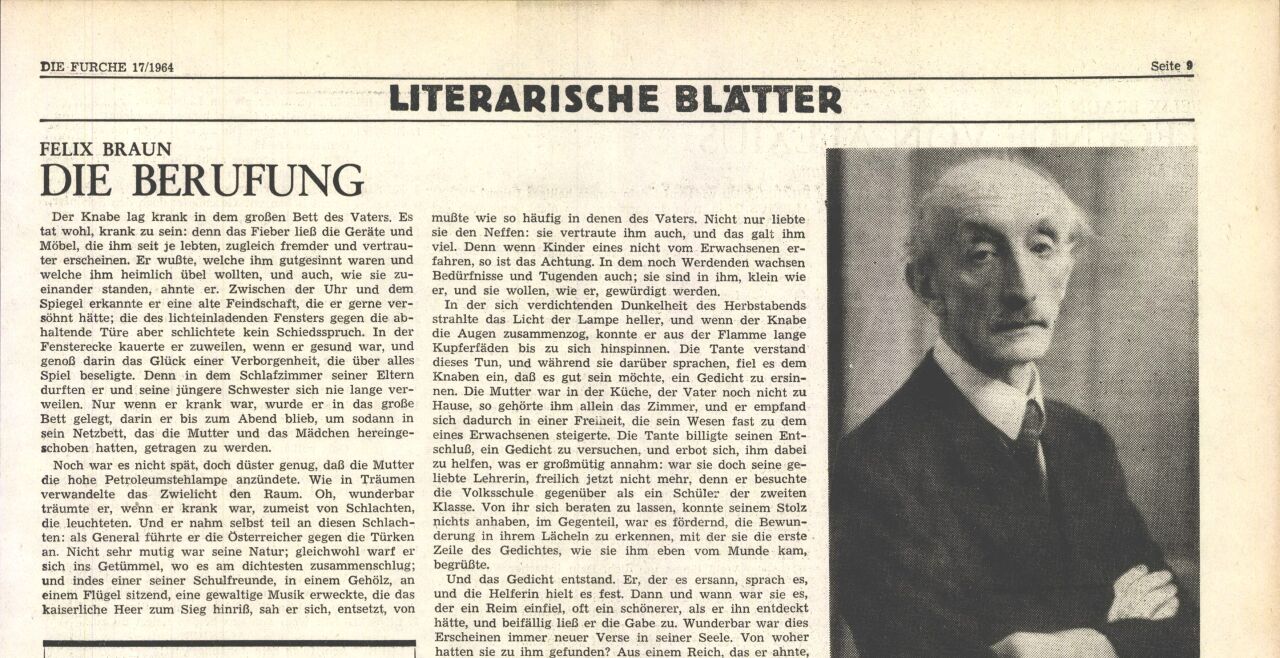
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DIE BERUFUNG
Der Knabe lag krank in dem großen Bett des Vaters. Es tat wohl, krank zu sein: denn das Fieber ließ die Geräte und Möbel, die ihm seit je lebten, zugleich fremder und vertrauter erscheinen. Er wußte, welche ihm gutgesinnt waren und welche ihm heimlich übel wollten, und auch, wie sie zueinander standen, ahnte er. Zwischen der Uhr und dem Spiegel erkannte er eine alte Feindschaft, die er gerne versöhnt hätte; die des lichteinladenden Fensters gegen die abhaltende Türe aber schlichtete kein Schiedsspruch. In der Fensterecke kauerte er zuweilen, wenn er gesund war, und genoß darin das Glück einer Verborgenheit, die über alles Spiel beseligte. Denn in dem Schlafzimmer seiner Eltern durften er und seine jüngere Schwester sich nie lange verweilen. Nur wenn er krank war, wurde er in das große Bett gelegt, darin er bis zum Abend blieb, um sodann in sein Netzbett, das die Mutter und das Mädchen hereingeschoben hatten, getragen zu werden.
Noch war es nicht spät, doch düster genug, daß die Mutter die hohe Petroleumstehlampe anzündete. Wie in Träumen verwandelte das Zwielicht den Raum. Oh, wunderbar träumte er, wenn er krank war, zumeist von Schlachten, die leuchteten. Und er nahm selbst teil an diesen Schlachten: als General führte er die Österreicher gegen die Türken an. Nicht sehr mutig war seine Natur; gleichwohl warf er sich ins Getümmel, wo es am dichtesten zusammenschlug; und indes einer seiner Schulfreunde, in einem Gehölz, an einem Flügel sitzend, eine gewaltige Musik erweckte, die das kaiserliche Heer zum Sieg hinriß, sah er sich, entsetzt, von grausam bärtigen Gesichtern unter Turbanen, geschwungenen, funkelnden Krummsäbeln und grünen Halbmondbannern umschlossen — eine braune Hand packte ihn, Lanzen zielten gegen seine Brust —, keine Flucht konnte mehr retten — zwar wußte er, daß er träumte und daß er, wenn er sich erst in den Abgrund vor ihm geschleudert, erwachen mußte—, da stürzte er auch schon, und, hätte nicht die sanfte Hand der Mutter — denn sie war es und nicht die eines Sarazenen — ihn aufgehalten, so wäre er aus dem Fenster, das er unwissend geöffnet, in den Hof hinabgesprungen.
Aber das war nur ein Traum gewesen, als er so sehr hoch gefiebert hatte, gestern nachts. Obwohl er sich gefürchtet, hatte er doch gewünscht, diesen Traum weiterzuträumen, bloß darum, weil er die große Musik noch einmal hören mochte. Und wirklich gewährte ihm sein Engel den Wunsch, und der schöne Traum wob sich fort. Besiegt waren die Türken. Die Helden aber saßen in einer festlichen Halle zusammen, und die Musik des Freundes erscholl, wie wenn Feuer klänge. Zahme Löwen lagen zu Füßen der Sieger, flammenbeschienen. Unsäglich feierlich verkündeten die Töne einen Frieden, der erhabener war als der Ruhm der Schlachten. Die Löwen vergingen in dem singenden Feuer, klirrend verschollen die Krieger darin und er selbst mit ihnen. Nur die Musik endete nicht. Sie währte über das Fieber und die Nacht hinaus, und da er die Augen auftat und um sich den sanften Tag fand, war ihr Gold das der Sonne.
Dem Traum nachsinnend, hatte er nicht gemerkt, daß die ältere Schwester der Mutter an seinem Bett saß. Seine erste Lehrerin war sie gewesen; daß er lesen und schreiben konnte, verdankte er ihr. Ihr schmales feines Gesicht unter dem hohen schwarzen Haar lächelte immer. Es war so gütig, daß ein Erzürnen in diesen Zügen nie gefürchtet werden mußte wie so häufig in denen des Vaters. Nicht nur liebte sie den Neffen: sie vertraute ihm auch, und das galt ihm viel. Denn wenn Kinder eines nicht vom Erwachsenen erfahren, so ist das Achtung. In dem noch Werdenden wachsen Bedürfnisse und Tugenden auch; sie sind in ihm, klein wie er, und sie wollen, wie er, gewürdigt werden.
In der sich verdichtenden Dunkelheit des Herbstabends strahlte das Licht der Lampe heller, und wenn der Knabe die Augen zusammenzog, konnte er aus der Flamme lange Kupferfäden bis zu sich hinspinnen. Die Tante verstand dieses Tun, und während sie darüber sprachen, fiel es dem Knaben ein, daß es gut sein möchte, ein Gedicht zu ersinnen. Die Mutter war in der Küche, der Vater noch nicht zu Hause, so gehörte ihm allein das Zimmer, und er empfand sich dadurch in einer Freiheit, die sein Wesen fast zu dem eines Erwachsenen steigerte. Die Tante billigte seinen Entschluß, ein Gedicht zu versuchen, und erbot sich, ihm dabei zu helfen, was er großmütig annahm: war sie doch seine geliebte Lehrerin, freilich jetzt nicht mehr, denn er besuchte die Volksschule gegenüber als ein Schüler der zweiten Klasse. Von ihr sich beraten zu lassen, konnte seinem Stolz nichts anhaben, im Gegenteil, war es fördernd, die Bewunderung in ihrem Lächeln zu erkennen, mit der sie die erste Zeile des Gedichtes, wie sie ihm eben vom Munde kam, begrüßte.
Und das Gedicht entstand. Er, der es ersann, sprach es, und die Helferin hielt es fest. Dann und wann war sie es, der ein Reim einfiel, oft ein schönerer, als er ihn entdeckt hätte, und beifällig ließ er die Gabe zu. Wunderbar war dies Erscheinen immer neuer Verse in seiner Seele. Von woher hatten sie zu ihm gefunden? Aus einem Reich, das er ahnte, benachbart jenem Traum, dessen Feuer immer noch an den Rändern seines Geistes loderten. In diesem seinem ersten Gedicht war nicht die Rede von ihm selbst noch von irgend etwas, dessen er je innegeworden; gar nichts, was sein Leben berührt hatte, ging in diese Verse ein, die er um ihrer selbst willen bildete. Ihr Inhalt war die Gefangennahme zweier Diebe, die, vor ihren Richter gebracht, befragt und verurteilt v/urden. Das Verhör vollzog sich so, daß die Tante Mühe genug hatte, es bei dem bloß gütigen Lächeln bewenden zu lassen: gern hätte sie über die Ausdrucksweise der Verbrecher, die einen Löffel und eine Flasche Bier gestohlen, laut herausgelacht, wenn sie nicht die Geschicklichkeit des Kindes, leicht und schnell Reime zu binden, so sehr hätte bewundern müssen; ja, wenn sie nicht selbst so glücklich darüber gewesen wäre, daß sich ihr in dieser frühherbstlichen Abendstunde ein überraschendes Erbe erwiesen hatte: Sie schaute die Gabe der Dichtkunst, die ihrem Vater zuteil geworden war, freilich, ohne daß der alternde Mann ihr viel Gutes zu danken gehabt hätte, und die auch der Mutter des Knaben mitgegeben blieb, in einer neuen Seele ihres Hauses erwachen. Der Großvater war vor einem Jahr an einer zehrenden Krankheit gestorben, lange nach der jungen Mutter, die,|hre beidien K,inder zu früh, Jjatte verlassen müs-• fien — die trau, die^'sie^ jetzt Mutter nannten, .war- die >. JsisjHSgste Schwester der'Mütter, und sie kannten-*ss diese? eine, da sie keine Erinnerung an die erste bewahrten —: der Tante aber, die auch dann und wann etwas in Versen zu schreiben sich bemüßigt glaubte, mochte es damals geschienen haben, als hätten die Toten ihren geliebtesten Besitz dem Enkel, dem Sohn heimlich zurückgetragen: denn in der offenen Sphäre des Fiebers haben sie leichter Zugang zu uns als in der Abgegrenztheit des klaren, heilen Tages.
Der Knabe, der im Fieber an einem Herbstabend in einem Zwielichtzimmer eines alten Hauses im Aisergrund, dem neunten Stadtteil Wiens, sein erstes Gedicht hervorbrachte, bin ich gewesen. Seit sieben Jahren schon war ich auf Erden, der damals letzte Sohn einer seit Jahrhunderten in Wien eingewohnten bürgerlichen Familie, das erste Kind meiner Eltern, der Bruder einer um zwei Jahre jüngeren Schwester, mutterlos und dennoch von einer liebenden Mutter betreut, von der in Krankheit gepflegt zu werden so sehr wohltat, daß ich mir oft wünschte, wieder, doch nicht allzu krank, im Zimmer der Eltern zu liegen, mit Zinnsoldaten zu spielen, die auf der Decke des Bettes nur schwer Halt fanden, im Schulbuch zu lesen, die geliebten Tiere aus Porzellan und Papiermache nahe bei mir zu wissen, oder bloß zu ruhen, zu schauen, zu fühlen. Denn das war die Zeit, da die Möbel und alle Dinge zu leben anhoben wie Menschen. Wenn der Abend dämmerte, lebten nicht nur die sichtbaren Gegenstände: Es kamen Gestalten der Sagen, Hektor oder Siegfried, Helden der Geschichte, Tiere und Blumen, sogar Monate und Tage, Farben und Zahlen zu dem Knaben, mit denen er umging wie mit Freunden. Es war dann oft so, daß er nicht den Größten, sondern den Zweitgrößten lieber hatte, daß er Hannibal dem Scipio, den Panther dem Löwen, die Nelke der Rose, den Montag dem Sonntag, den April dem Mai, die Sechs der Sieben vorzog. Auf eine unsagbare Weise hatten alle diese Wesen ihr Leben und ihr Antlitz, und sehr seltsam war auch der Dritte, wie Seth der Dritte nach Kain und Abel war, und wie ihm und seiner Schwester von der neuen Mutter ein um zehn Jahre später geborener Bruder zugesellt wurde. So war die Lilie die versöhnende Dritte zwischen Nelke und Rose, so das Zebra zwischen Esel und Pferd, der Reiher zwischen Kranich und Storch, so Blau zwischen Grün und Rot und der Abend zwischen Nacht und Tag. Das waren Welten, darin er allein als einziger Richter waltete und in denen kein Tod galt, ja, nichts die Wesen schied, deren geheimnisvolles Leben aus seinem Herzen gespeist wurde. Aus ihnen ging nichts in seine Gedichte ein, die von andersher entsprangen. Entfernt von ihm selbst, fuhren sie fort, zu ersinnen oder zu preisen, Schlachten zu feiern oder Weisheiten zu ergründen, Schicksale vergangener Menschen zu erfinden, die nirgendwo an sein gegenwärtiges grenzten. Die Poesie war ihm ein Reich, dem er zugehörte, ohne daß er es je betreten hätte. Wie dem Sohn eines verbannten Königs kamen ihm Botschaften von dort, die er nicht begriff, aber nachredete und weitergab. Wem? Dem Genius, der sie ihm gesandt? Überhaupt waren es nicht Gedichte, was er nun auch zu schreiben fortan nicht wieder lassen mochte, sondern Reime, deren Sinn bloß der des Klangs war. Um ihrer Musik willen rief er sie aus sich hervor, und vielleicht war sie eben jene des großen Traumes, dessen Feuer nie mehr in seinem Geist erlosch.
Ams „Das LfcUt der Welt“, Neuauflage im Herder-Ver/ag, Wies-Freibur|.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!