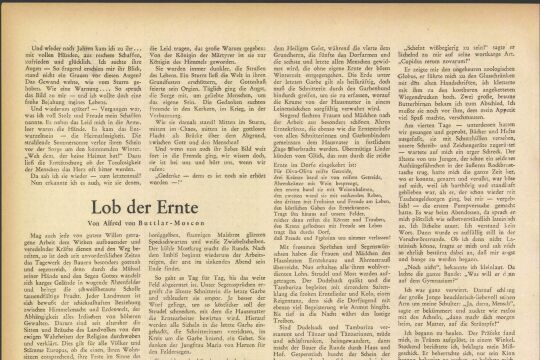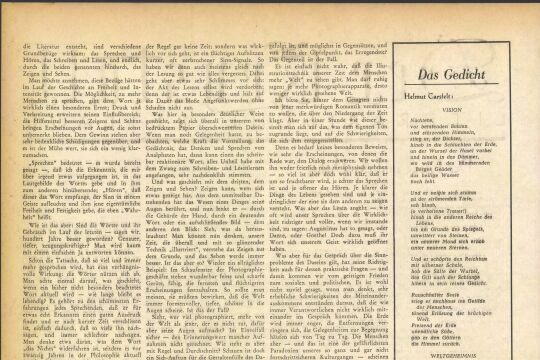Die Zimmerwände meiner Kindheit waren grau. Ich weiß nicht, ob diese Farbe, die so viele Jahre meines Lebens umgab, nicht untergründig die Tönung meines Gemütes und meiner Weltsicht im Guten wie im Bösen für alle Zukunft entscheidend beeinflußt hat. Es mochte, als es noch frisch und neu war, ein helles Grau gewesen sein, sanft wie das Licht stiller Regentage. Zu der Zeit jedoch, da es sich meiner Erinnerung unvergeßlich einprägte, war es schon nachgedunkelt, und von Jahr zu Jahr verriet es mir mehr vom Geheimnis ängstlich verborgener Not, darin ich früh erkennend aufwuchs.
Ich kann mich nicht entsinnen, damals in Zimmern anderer Leute einem solchen Grau begegnet zu sein, und so wurde es recht eigentlich mein frühester Besitz, der mich vom bunteren Leben der anderen Kinder unterschied und trennte und auf mich selbst verwies. Denn meine Mutter, die morgens zur Arbeit ging und erst spät am Abend heimkam, verwehrte mir Spielgefährten, wohl nicht nur aus Sorge, ich könnte unbeaufsichtigt einen Umgang pflegen, der mir nidit guttat, sondern auch weil jede Kameradschaft Besuch und Gegenbesuch mit sich bringt und ihr Stolz es nicht ertrug, vor anderen preiszugeben, wie ärmlich wir hausten.
Sie hatte zwar einst nidit gezögert, die Ersparnisse ihrer Dienstbotenjahre mit einem einzigen Griff wegzugeben, als es galt, einem Angehörigen, der es ihr später nur übel dankte, aus einer plötzlichen Notlage zu helfen; und daß sie selber arm war, hat sie gegen fremde Armut niemals verhärtet, doch daß sie es zu keiner ordentlichen Einrichtung gebracht hatte wie andere Leute und daß sie sich trotz aller verzweifelten Anstrengung nur kümmerlich durchringen konnte, ertrug sie wie eine Schande und Schmach, erbittert und verschwiegen. In ihrer kargen Freizeit flickte, nähte, wusch und scheuerte sie unermüdlich, sie kämpfte mit allen Mitteln eines reditlichen Menschen und weit über ihre Kräfte gegen die Not und wahrte — wenigstens solange die furchtbaren Jahre der Arbeitslosigkeit und Krankheit nicht alle Bemühungen zunichte machten — das bürgerliche Ansehen bis hart an die blanke Schwelle unserer Wohnung. Darüber und hinein ließ sie freilich nur ungern jemanden treten. Wenn ich mir ihr Bild aus jenen Jahren heraufzuholen versuche, stoße ich immer wieder auf eine Nacht vor dem Heiligen Abend, da sidi mitten durdi meinen Kinderschlaf ein scharfes, zischendes Geräusch immer dichter an mein Bewußtsein heranfraß, bis ich erwachte und sdireiend hodifuhr. Ich hatte nicht geträumt: das böse Tier war hier in unserem Zimmer und fauchte am Boden hin im ungewissen Schein einer verhängten Petroleumlampe. Das Lager. meiner Mutter war leer und unberührt, doch aus der Tiefe neben meinem Bett tauchte ihr Antlitz auf, gespenstisch bleich. Sie kniete gestützt auf ihre Linke, und von ihrer rechten Hand, die mir das Deckbett an die Schultern hochzog, stieg ein Geruch von Lauge und von kalter Nässe. „Schlaf“, sagte sie, „es ist nichts. Ich muß den Boden noch fertigreiben, daß alles sauber ist, denn morgen kommt das Christkind.“ Es sollte wohl tröstlidi klingen, doch ich höre noch ihren Atem keuchen, ihr Mund schien mir verzerrt und in ihrem Blick stand die Erschöpfung wie geheimer Zorn.
Ich habe das alles wohl erst im nachhinein in seiner schmerzlichen Bedeutung verstanden, doch das Bild blieb mir mit allen seinen Zügen wie in die Seele eingebrannt. Und ich habe mich später oft gefragt, ob dieses Knien der Mutter in jener Nacht nicht schwerer wog vor Gott als die Gesänge der frommen Beter im Advent. Denn manche Stuben sind härter zu bereiten als das Herz. Gegen unsere Wände freilich hat audi dieses Knien der Mutter nidits vermocht. Ihr Grau
blieb unerbittlidi und wurde nur immer grauer.
Und als in meinem sechzehnten Jahr sich endlidi ein arbeitsloser Vetter gegen zwei Tage Kost und Materialvergütung bereit fand, den Grind der Wände abzukratzen und mit einem Flor phantastischer Blüten zu bedecken, da misdite er aus allerhand spärlichen Resten zwei wunderliche Farben, nidit Rosa und nicht Braun, so daß wir zuletzt die langen grauen Regenjahre nur gegen einen düsteren Herbst eintauschten, der ohne
Laubfall währte und darin die Monde mühsam verrosteten.
Jedoch verglichen mit der Wirkung, die eine andere Farbe auf meine Seele ausübte, blieb dieser Herbst nur eine Episode. Das Zimmer, meiner Kindheit barg nämlich im Gegensatz zur Stetigkeit und Dauer der grauen Wände ein sattes Grün, das auf geheimnisvolle Weise verschwand und wiederkehrte und an dem ich später den Rhythmus unserer größeren und geringeren Not ab-
lesen lernte wie an Baum und Strauch die Jahreszeiten.
Ich liebte dieses Grün; es lag wie eine friedlidie Insel im Raum, wo alle Möbelstücke auf Grund ihrer Herkunft aus ver-sdiiedenen Trödlerläden einander bekämpften, und gab den Betten, von denen eines eckig und aus Eisen, das andere aus barock geschwungenem Holz war, ein Ansehen von festlidier Zusammengehörigkeit. Diese Dek-ken waren der ganze Stolz der Mutter. Wöchentlich mit Sorgfalt gebürstet und täglich zärtlich glattgestrichen, bedeuteten sie ihr die einzige Verwirklichung wohlsituierter Behaglichkeit. Fehlte ihr Grün, erschien mir die Strenge der Mutter strenger, und die kahlen Betten wurden erst tröstlich, wenn
man sich am Abend darin verkroch. Nichts wurde so augenfällig oft und für so lange Zeit in die Putzerei getragen wie diese Decken, und ich konnte mich im stillen nicht genug wundern, um wieviel rascher sie angeblich schmutzig wurden als das weiße Tuch auf unserem Tisch, bis ich eines Tages einen roten Zettel im Geschirrschrank fand, auf dem ich lesebeflissen das rätselhafte Wort Pfandleihanstalt budistabierte. Als Folge der unvermtidlichen Erklärung begann ich nach
und nach zu bemerken, daß auch noch andere Dinge wie Mäntel, Schuhe, Wäsche und ein nie getragener Ring von Zeit zu Zeit ver-sdiwanden und immer seltener wiederkehrten.
Mein kindlidies Wertbewußtsein hat freilich zunächst die Decken am schmerzlidisten von allem vermißt, denn sie dienten mir sommers manchmal hinter dem Rücken meiner Mutter zu einem sonderbaren Spiel, das einem Frevel an ihrer ängstlich behüteten Schönheit gleichkam, den ich erst viele Jahre später gebeichtet habe, als sie schon längst zusammen mit dem repräsentativsten Kleidungsstück der Mutter, einem braunen Kostüm, den letzten, unwiderruflichen Weg unserer besten Habe — vom Versatzamt zur Versteigerung — gegangen waren. Von allem, was still und grün in meiner Kindheit war, waren die Sommer mit ihren langen Ferien das Stillste und das Grünste. Doch war es nicht das Grün von Wald und Flur, das meine Schulkameraden in lustvollen Wochen unbegrenzter Freizeit genossen und dessen Märchenatem noch lange nach Schulbeginn den Lärm der „großen Pausen“ mit fröhlichen Berichten von Abenteuern füllte. Es war das Grün gedämpften Lichtes hinter herabgelassenen Jalousien, mit denen man sidi vor der drückenden Hitze sdiützte, ein Grün, das eine Kühle ohne Haudi erzeugte,, darin man dämmernd auslosch in ein Leben, das schon der Wirklichkeit entbehrte. Der Urlaub meiner Mutter war kurz und ihre Mittel rciditen nur“ hie und da zu einem Ausflug. Also saß idi durdi viele Wochen fast den ganzen Tag allein zwischen vier Wänden und verspann midi in ein Spiel, das ich erfunden hatte und dem ich für mich selber den Namen „das Land- und das Gcschwisterspiel“ gab. In diesem Spiel verquickte ich Landschaften und Figuren aus meinen Lieblingsgeschichten zu einem einzigen Schauplatz und einer großen Familie, mit der ich auf Ferien fuhr. Idi erwarb mir auf diese Weise drei Brüder, vier Schwestern, einen Vater, der Arzt war, eine Großmutter, die einen Landsitz in Reichenhall hatte, und Erlebnisse, die eine solche Macht über mich gewannen, daß ich midi beraubt und einsam fühlte, wenn die Mutter wieder heimkam.
In diesem Spiel kam nun den grünen Decken eine wichtige Rolle zu. Abwechselnd, daß keine mehr zu Schaden käme, zog ich mir bald die eine, bald die andere vom Bett — es kostete mich hinterher keine geringe Mühe, sie wieder so zurückzulegen, daß die Mutter keinen Verdacht schöpfte — und breitete sie auf dem Fußboden unterm Fenster, wo die Sonne durdi die Jalousien-sdilitze ihr lautloses Lichterspiel trieb, legte die Sdiuhe ab und betrat barfuß die grüne Fläche. Sie verwandelte sidi, wurde Gras und Moos, darin ich mich heiter bettete. An ihren Rändern liefen hellere, gelbliche Streifen. Sie wurden meine Bäche, mein Löwenzahn und meine Butterblumen. Ich formte aus Brotkrumen kleine Pilze, stellte sie auf und war im Wald. Idi legte einen Apfel oder eine Zwetschke hin und hatte einen Garten. Aus Zündholzschachteln und Buntpapier bastelte ich mir winzige Häuser und baute sie zu nie gesehenen Dörfern und Städten ins Grüne, die ich staunend bereiste. Idi sang und redete mit meiner schönen, älteren Schwester, oder idi schloß die Augen und hörte meine kleinen Brüder lachen. Idi wußte, daß die Mutter froh war, weil der Vater wieder einem Kranken das Leben gerettet hatte, und die Großmutter hantierte klappernd mit Schüsseln voll süßer Beeren, auf die sie frische, weiße Milch goß. Und plötzlich hatte ich einen guten Einfall. Ich würde eine Mitschülerin einladen. Sie hieß Christi und konnte nicht aufs Land fahren, weil ihre Mutter nur eine Verkäuferin war. Sie hatte keinen Vater, keine Großmutter, keine Geschwister und war immer allein. Sie lebte in einem Zimmer mit grauen Wänden, mir aber gehörte die ganze grüne Welt.
Mein grüner Zauberteppich ersetzte mir alle Sommerfreuden und schenkte sie mir völlig ungetrübt von den Enttäuschungen der
Wirklichkeit, wo unsere Seele aus den Gefilden stiller Eigenmächtigkeit in das bewegte Spiel von fremden Kräften tritt.
Allmählich aber wichen die Gestalten dieser kindlichen Spiele an den Rand des Zauberreichs zurück und gäben meiner Einsamkeit den Raum für andere Gefährten frei. Mit manchen von ihnen habe ich damals mehr ahnend als erkennend einen Bund fürs Leben geschlossen. Niemals wieder las ich mit soviel Andacht und Entzücken die Studien Stifters und die glühende Werthersprache wie auf meinem grünen Sommereiland.
Die letzte große Begegnung, die es mir gewährte, ehe mir seine Greifbarkeit für immer entschwand, waren die Brüder Karamasoff.
Ich las sie viel zu früh, doch aus dem Ungeheuren und Dunklen, das ich nicht zu bewältigen vermochte, traf mich ein Wort mit furchtbarer Erhellung und warf mich der Erfahrung meiner Jahre so weit voraus, daß ich mich fern von allen Ufern fand, als ich es schaudernd nachsprach, um es für immer zu behalten: „Die Hölle ist: nicht mehr lieben können“. Es hat mich von meiner Kindheit losgerissen und ausgesetzt am Abgrund aller Schrecken, dran wir das Menschsein lernen und wo neue Färben das Auge bestürzen, aus deren wildem Chaos wir oft erst spät die stillen Töne wiederfinden, dazwischen uns Gott die Brücke der Bestimmung ins Licht gehängt hat.