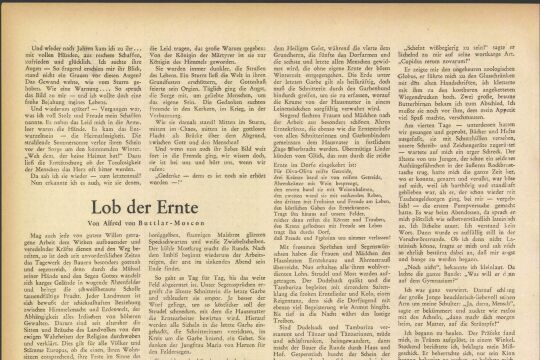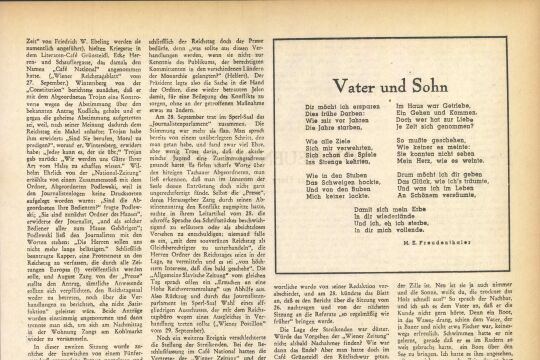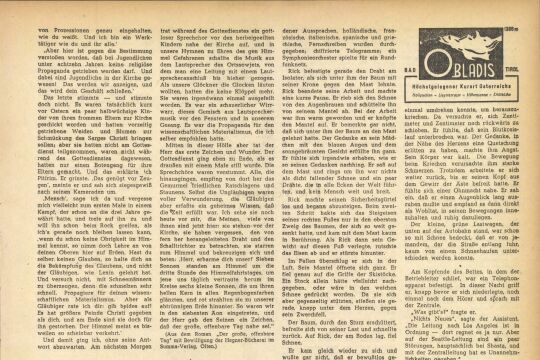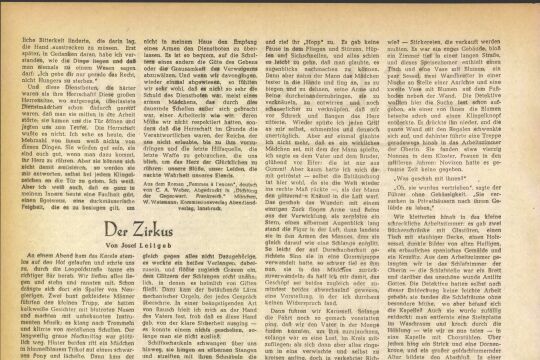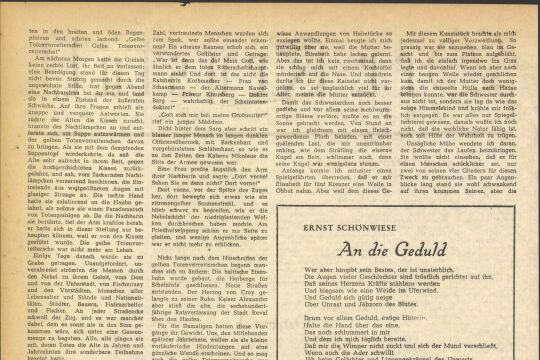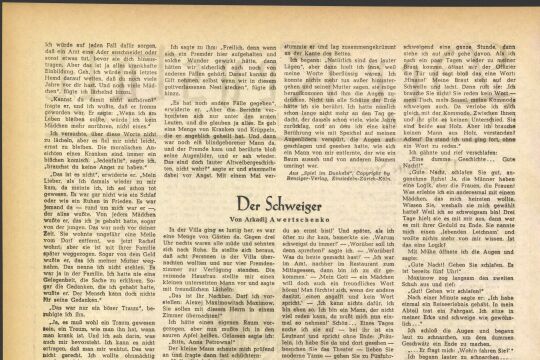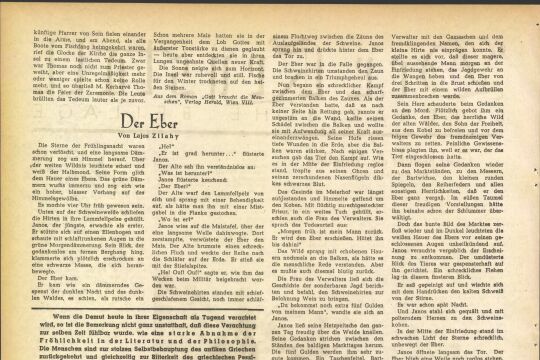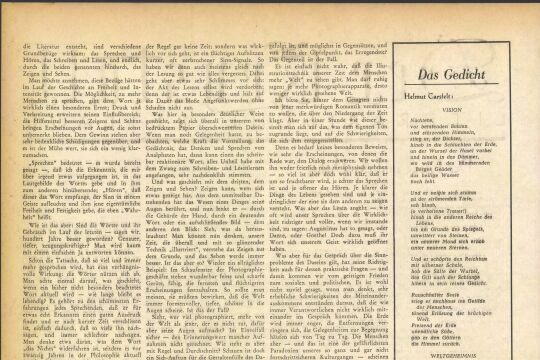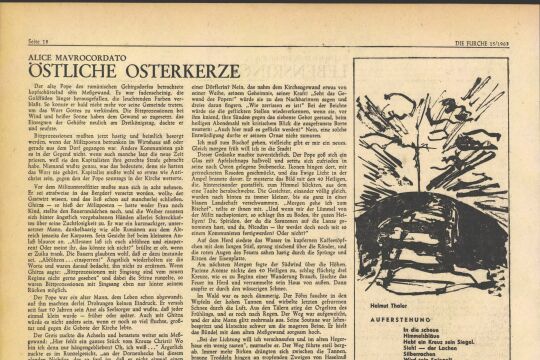Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Fisclte Satans
Die erste Erinnerung meines Lebens ist ein Fisch. Groß, ein Ungeheuer, mehr grau und blau als silbern, hing er in der Luft. Ich liebte ihn sogleich. Daran änderte auch die Ohrfeige nichts, die er mir mit einem Schlag seines Schwanzes versetzte. Ich war damals drei Jahre alt. Als ich lange später in unserer Hütte wieder einmal davon redete, lachten alle.
„Der hing nicht in der Luft“, sagte die Großmutter. Sie erklärte, es sei ein starker Thun gewesen, den mein Vater harpuniert und stolz herumgezeigt hätte. Doch ich beharrte darauf, er sei in der Luft gehangen. Wohl deshalb, weil für mich ein schwebender Fisch das Schönste war, das ich mir vorstellen konnte, und vor allem, weil neben seiner Pracht nichts anderes in meiner Erinnerung Platz hatte, kein Ufer, kein Strauch, kein unrasierter alter Mann. Ich blieb solange dabei, bis mein Vater aufsprang und mir zwei Ohrfeigen versetzte, meinem Gedächtnis nachzuhelfen. Ich floh, während die Fischer vor Lachen schnaubten. So verdankte ich meinem Fisch bereits drei Maulschellen. Das änderte nichts an meiner Liebe zu ihm, oft kehrte er in meinen Träumen wieder, mächtiger, schöner, geheimnisvoller als je zuvor. .
Bei keinem Abenteuer meines späteren Lebens vergaß ich, mich auf Leiden einzustellen, wenn ich etwas oder jemanden liebte oder wenn mir sonst etwas Schönes widerfuhr. So trafen mich die Schmerzen gewappnet, und sie kamen stets pünktlich wie der afrikanische Wind über die Insel meiner Kindheit zu kommen pflegt, die mich gelehrt hatte, was das Glück ist: eine Sache, die durch Wehtun ihren wahren Glanz erhält.
Die Männer hielten mich wie ihren gemeinsamen Sohn. Ich war das einzige Kind auf der Insel. Das hatte seine Vorteile. Der Nachteil war, daß sie alle auf mir herumschlugen, wenn sie schlechter Laune waren. Solange ich klein war, weinte ich. Doch als mir einfiel, daß ich noch nie einen Mann hatte weinen sehen, gab ich es auf. Weil ich doch aber nicht dastehen konnte wie ein Fellsack, wenn sie mich Bearbeiteten, wehrte ich mich in Hinkunft. Das gefiel ihnen. Als ich dem Schwarzbart Paride mit einem Stück Treibholz ein Auge ausstieß, schlugen sie mich halbtot. Seither ließen sie mich in Ruhe.
Etliche Jahre nach der .Geschichte mit dem starken Thun kletterte ich die Felsen vor unserer Hütte zum Ufer hinab und hing eine Schnur aus Pferdeschwanzhaaren ins Wasser. Nikos, der schielende Begleiter des Vaters, hatte es mir so erklärt. Ich saß tagelang und machte keine Beute. Das war eine von Gott gesegnete Zeit. Meine arme, hakenlose Schnur baumelte in die Fluten der Bucht, die kristallklar und still waren. Die Fische zogen an ihr vorbei und beachteten sie nicht. Wenn die Fische näherkamen, war ich so aufgeregt, daß ich von meinem Felsstück ins Meer fiel und kaum dem Ertrinken entrann. Ich bin wohl wie eine Fliege gekrabbelt, die in den Milchkrug fällt und herauskommt, obwohl auch sie nicht zum Schwimmen geboren ist. Ich kam immer wieder an Land, oft halb bewußtlos, und erbrach schmerzhaft das Salzwasser. So sehr es auch im Hals und in den Eingeweiden brannte, so sehr auch die See durch meinen Magen rollte, ich liebte diese schönen, grausamen Augenblicke.
Das Versinken hatte Atemzüge voller Süße, die halbe Ohnmacht war voller Geheimnisse. Diese Dinge in der Nachbarschaft des Todes waren begehrenswert, darum verstand ich nicht, weshalb der Oheim ein verzerrtes Gesicht hatte, als die Männer ihn tot vom Ufer heraufschleiften.
Ich ging unverdrossen jeden Morgen in die nach Salz, nach Tang und heißem Sand duftende Bucht hinab und bot den Fischen Roßhaar an. Ich sang für sie, ich betete, das fruchtete nichts. Ich murmelte Beschwörungen und Zaubersprüche in selbsterfundenen, geheimen Sprachen, vor denen mir selbst unheimlich wurde. Ich fluchte, ich spuckte, alles vergeblich. So hatte ich Zeit, die Fische kennenzulernen.
Ich liebte sie inbrünstig, die Unerreichbaren. Je weniger Hoffnung ich hatte, sie zu erlangen, um so wunderbarer erschienen sie mir. Es gab welche, die waren türkisfarben, andere waren schwarz oder silbergrau oder safrangelb oder blutrot. Sie schwammen einzeln, in Reihen, in Wolken, langsam oder schnell, doch nie hastig, selbst in ihren Fluchten war etwas Königliches, wenn sie wie Blitze davonschnellten. Oft schauten sie mich so seltsam an, daß ich He~zklopfen bekam. Sie gaben mir mit ihrem Schweben und Schwingen Zeichen, die ich in meiner Dummheit nicht verstand.
In diesen Tagen ertappte ich Nikos, wie er mit seiner Angel einen großen Fisch aus meiner Bucht heraushalfterte. Es war das erste Mal, daß ich jemanden einen Fisch herausziehen sah, fischten doch die Männer sonst weit draußen mit den Netzen. Nikos zog seiner Beute einen Haken aus dem Maul, der nicht von schlechten Eltern war und an dem sich noch ein halber Regenwurm wand.
Ich sagte nichts, ich eilte zur Hütte des Nikos, der längst vergessen, daß er mir einen Bären samt Fell aufgebunden. Ich stahl etliche Haken, und im Kräutergarten der Großmutter gab es die fettesten Regenwürmer der Welt. Ich steckte einen wimmelnden Klumpen in die Tasche der Hose aus Ziegenhaut, die mein einziges Kleidungsstück war, das ich auf dem Leibe hatte, und rannte zurück zur Bucht. Ein Fisch nach dem anderen zappelte an meiner Angel, einen nach dem anderen zog ich heraus, es war, als zöge ich eine Kette von Fischen Glied um Glied aus den Wellen.
Ich warf sie hinter mich, dort klatschten sie im Sand wie verdammte Seelen im Fegefeuer. Schließlich rief Nikos von seinem Angelplatz aus zu mir herüber: „Abschlagen mußt du sie, du Lümmel.“ Also schlug ich sie ab, wie er es mir zeigte. Ein Schauder rieselte mir durch die Brust, als ich sie unter meinen Händen sterben sah. Als hernach ein starker Kerl anbiß, den ich mit Mühe an Land brachte, kam Nikos, zog einen Dolch aus dem Gürtel und zeigte mir die Stelle im Nacken, wo ich hineinstoßen mußte. Das starke Tier zuckte, zitterte, bebte. Es seufzte laut und starb. Ich schmeckte Blut auf der Zunge, schrecklich und süß, glaubte, es sei vom Herzblut des Fisches. Später erst merkte ich, daß es mein eigenes Blut war. Ich hatte mich vor Jagdgier in die Lippen gebissen ohne es zu spüren.
Ich fischte bis in die Dunkelheit, bis die Stimme der Großmutter im Finstern aufklang. „Komm!“ war meine Antwort. Sie kam zugleich mit dem Mond in die Bucht herab. Als sie den Haufen Fische sah, bekreuzigte sie sich und begann wie ein Hund zu heulen. Ich aber stieg ans Wasser hinab, wusch mir das Blut und die verkrusteten Fischschuppen von den Händen und kehrte zu dem jammernden Weibe zurück, mit den Gebärden eines Mannes, wie mir vorkam, und mit einer Brust, mächtig wie ein Weinfaß.
Sie kniete und murmelte Gebete, während ich meine Beute zusammenschlichtete und überlegte, wie ich sie heimbringen konnte. „Die Panajia will dich nicht“, keuchte die Großmutter und drohte mit der Faust gegen den Himmel, „jetzt hat dich das alte Untier, der stinkende Eber!“
Sie fuhr erschreckt von mir zurück: „Deine Augen sind furchtbar. Söhnchen“, flüsterte sie, „du bis voll Blut wie ein Mörder ...“ Sie jagte mir solchen Schrecken ein, daß auch ich hinkniete und zu Panajia betete. Als die Großmutter mich so beten sah, wurde ihr leichter. In der Hütte, im Licht des Kienspans und am knisternden Herd war sie plötzlich milde. Sie streichelte mich.
Die besten Fische nahm sie aus, salzte und würzte sie und warf sie in die Pfanne, wo das dicke, riechende Oel schon zischte. Wir aßen, bis uns die Bäuche wegstanden und ich bekam mein erstes Glas Wein. „Wenn sie vielleicht auch vom Teufel sind“, sagte die Großmutter rülpsend, „was man im Magen hat, darüber hat das Untier keine Macht mehr.“
Als ich in der Frühe, mit frischen Würmern ausgerüstet, zu meiner Bucht hinabstieg und die Angel einwarf, da zog ich sie bald wieder heraus. Ich kam mir einsam vor, während doch gerade ein herrlicher Schwärm von Rotröcken auf, mich zusegelte. Ich fror und wagte kaum, die Fische anzublicken. Hinter mir war der Sand vom Abend her von den sterbenden Tieren zerwühlt und mit deren Blut bespritzt. In meiner Erinnerung war der entsetzte Schrei der Großmutter. Und vor mir schwammen und tanzten sie, meine Fische, in zärtlichen Schleifen und Schwüngen ihre heimlichen Worte für mich.
Ich breitete die Arme aus. „Seid mir nicht bös“, sagte ich, „ich liebe euch ja!“ Sie verstanden mich, denn sie nickten auf und ab in der schwankenden Dünung, etliche kamen nahe an die Oberfläche des durchsichtigen Wassers, um mich zu grüßen, andere sprangen sogar in die Luft empor.
Ihre blitzenden Augen starrten mich nicht mehr unheildrohend an, sondern blinkten mir als einem alten Freunde zu. Sie waren versöhnt. Ich lachte, ich weinte vor Erleichterung. Ich ließ meine Hose fallen und stieg in die Wellen. Ich wollte meine Lieblinge umarmen, ans Herz drücken, küssen vor Dankbarkeit und Freude. Sie kamen nahe heran, einige kleinere Kerle stießen ihre Nasen freundschaftlich gegen meine glückselig erschauernde Haut. Ich sah wieder, was ich während meines mörderischen Fanges nicht gesehen hatte — wie schön sie waren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!