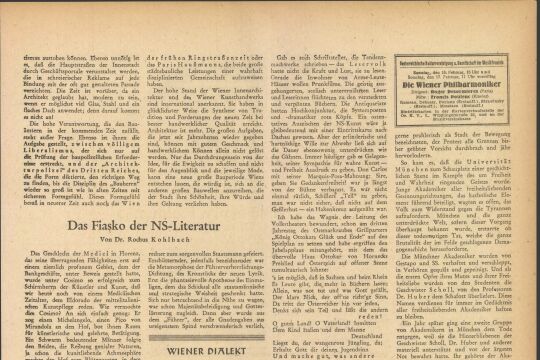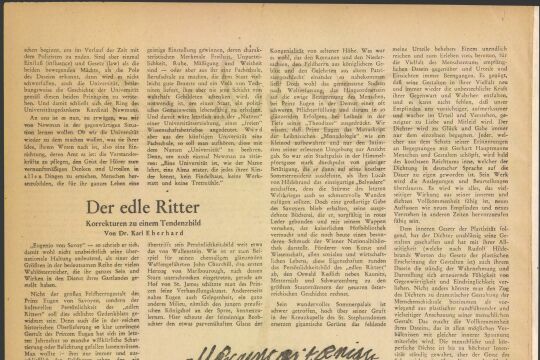Wenn wir die Veränderungen betrachten, welche die Entwicklung einer ungeahnt großartigen Technik auf der ganzen Erde hervorgebracht hat, so überkommt uns eine gewisse Beklemmung. Nicht etwa, daß diese ihren Grund in der Technik selbst hat — das Staunenerregende ihrer Leistungen, die Macht über die Naturgewalten, die sie dem Menschen verleiht, die Erleichterungen und Erhöhungen seines Lebens, die sie geschaffen hat, erfordern unsere Dankbarkeit. Es fragt sich nur, ob der Mensch selbst, der uns dieses großartige Geschenk darbietet, ihm auch gewachsen ist — gewachsen nicht nur im Sinne einer tadellosen Beherrschung seiner Methoden und Apparate. Scheinbar ist das Gegenteil der Fall. Wem steigt nicht bei dieser Frage das Bild des gehetzten Menschen unserer Zeit auf, der überhaupt nicht mehr imstande ist, dem rasenden Tempo seines Berufslebens Einhalt zu gebieten! Könnte nicht der Verkehrsschutzmann, der das Tosen der Großstadt mühsam meistert, fast das repräsentativste Menschenbild unserer Tage abgeben? Besteht nicht die Gefahr, daß eben alles nur noch „funktioniert“, das ganze Leben zum Ablauf eines riesigen Apparates wird, daß niemand mehr für sich und seine Mitmenschen Zeit besitzt? Sind die Kräfte, die die Technik frei gemacht hat, unserem höheren Leben gewidmet oder etwa nur dem atemlosen Geldverdienen? Vermögen alle jene Apparate, die zwar einerseits unser Lebejflfefreien, amder*-seits auch unser Leben zu eÄficken? Und so“ drängt-sich schließlich doch von allen Seiten her die Frage auf: Ist der Mensch als solcher seinen eigenen Erfindungen und Triumphen nicht gewachsen?
Hier aber stockt die Antwort, denn die Frage nach dem Menschen ruft heute ein eigentümliches Grauen hervor — gespenstische Schatten aus vermeintlich längst vergangenen Tagen verdunkeln das strahlende Bild der heutigen Welt. Wer hätte es vor einigen Jahrzehnten noch für möglich gehalten, daß im Raum europäischer, angeblich christlicher Völker die grauenvollen Methoden der Folter wieder zur Anwendung kämen? Wer hätte gewagt, die seit den Tagen des Prinzen Eugen anerkannte Forderung einer ritterlichen Kriegsführung gegenüber der nicht kämpfenden Bevölkerung theoretisch aufzugeben, geschweige sie in ihr Gegenteil zu verkehren — denn die moderne Kriegsführung rechnet ja gerade bewußt mit den Vernichtungsmethoden gegenüber den Wehrlosen. Natürlich sind auch früher Übergriffe vorgekommen, aber sie waren nicht organisiert. Und was dem Menschen gegenüber gilt, gilt auch der stummen Kreatur gegenüber. Auch ihr hat die moderne Technik viele Lasten abgenommen — wir sehen nicht mehr übermüdete Pferde unter allzu schweren Lasten keuchen, aber ist nicht die Vivisektion, wie sie heute in gewissen Laboratorien betrieben wird, weit grausamer? Was davon an die Öffentlichkeit dringt, bedeutet eine Herzenskälte sondergleichen. Und wohin sind denn all die schönen Wiesen- und Feldblumen, aus denen das Bienenvolk seine Honigernte einbrachte? Eine nützliche Technisierung erfand ihre Vernichtung, denn für bloße Lieblichkeit gibt es ja kein Geld! Wohin sind die vielen bunten Schmetterlinge, die unsere Augen erfreuten, wohin die reizenden Vögel, denen man durch die maschinenmäßige Insektenbekämpfung die Nahrung entzog? Wohin ist die Üppigkeit gewisser Landschaften, denen durch die häßliche „Begradung“ unserer Flüsse das Grundwasser entzogen wurde? Fällt uns nicht bei all diesen Beobachtungen die Antwort ein, die ein weiser Mann des einstigen China seinem europäischen Gast gab, der ihn auf die Vorteile seiner Maschinen aufmerksam machte. „Ich weiß wohl“, sagte der Chinese, „daß es solche Instrumente gibt, aber ich würde mich fürchten, mich ihrer zu bedienen, denn wenn man eine Maschine benutzt, so bekommt man ein Maschinenherz.“
Das Maschinenherz ist die eigentliche Gefahr unseres technischen Zeitalters. Hört man doch bereits von solchen Instrumenten, die dem Menschen mit Hilfe eines Elektronengehirns gewisse Entscheidungen abnehmen wollen! Und plötzlich stehen sich Natur und Technik feindlich gegenüber — die Bedrohung des persönlichen Lebens wird zur Bedrohung des Lebens überhaupt. Kein Zweifel, es gibt eine Gefährdung, welche von einer geistig nicht bewältigten Technik ausgeht. Der große Philosoph des alten Rußlands, Nikolai Berdjajew, hat mit Recht in dem Auftreten der Maschine die größte und gefährlichste Revolution erblickt, welche die Menschheit je erlebte. Er bezeichnete diese Revolution als zusammenfallend mit dem „Sturz des menschlichen Bildes“ und den „Übergang der Kultur in die Zivilisation“. Denn die Technik unterwirft nicht nur dem Menschen die Naturgewalten, sie unterwirft sich auch den Menschen selbst, sie unterwirft seine Menschlichkeit, sie macht eben sein Herz zum Maschinenherz. Dieselbe Technik, die ihm so viel Mühsam abgenommen hat, sie zeigt sich auch bereit, ihn zu vernichten: durch die Erfindung der Atomwaffe wird blitzartig klar, wohin der Weg einer geistig und menschlich nicht bewältigten Technik führt — die bloße Zurückdrängung des Lebens wird zur Todesdrohung für die lebende und für die kommende Generation. Und nun gilt es dem Menschen aber auch, sein vielbewundertes Kind, die Technik selbst, zu Letten, denn auch, sie wäre ja verntchtetrwenn 'ihr Schöpfer, der Mensch, ümk^mgßr^f1^^ Allein wir können die Entwicklung weder rückgängig machen noch sie aufhalten — aber wir können versuchen, sie geistig zu beherrschen. Nur der Einsatz höchster Menschlichkeit könnte' die Gefahr bannen — sie ist derrn auch das eigentliche Thema dieser Zeilen.
Unwillkürlich richtet sich der Blick hier auf die Frau — ihr wurde das Leben in einem viel unmittelbareren Sinn anvertraut als dem Mann. Derselbe Berdjajew, der vom „Sturz des menschlichen Bildes“ spricht, weist auf die „unendlich bedeutungsvolle Rolle“ hin, welche die Frau in den letzten Jahren zu spielen begonnen habe. „Die Frau“, so sagt er, „hat sich auf einer größeren Höhe gezeigt als der Mann — sie ist enger mit der Weltseele und den Urwesenheiten verbunden. Die männliche Kultur ist zu rationalistisch, zu weit entfernt von den unmittelbaren Mysterien des kosmischen Seins. Durch die Frau allein kann der Mann zu ihnen zurückkehren.“
Nun hat tatsächlich unsere Zeit für die Frau ganz neue, ihr bisher verschlossene Möglichkeiten des Wirkens gegeben — sie ist in vielen Berufen sichtbar geworden, die ihr bisher verschlossen waren, aber bedeutet dieses Sichtbarwerden auch ein Wirksamwerden? Hat die Frau den Sturz des menschlichen Bildes aufzuhalten vermocht, wie steht sie zur modernen Technik? Kein Zweifel, gerade sie hat ihr vieles zu danken: das heutige Berufsleben, auch der verheirateten Frau, wäre undenkbar ohne die Erleichterungen, welche die moderne Technik dem Haushalt zur Verfügung stellt. Was aber hat nun diese Entwicklung für den geistigen Einfluß der Frau bedeutet?
Man kann diese Entwicklung begrüßen oder bedauern — beides zu Recht. Sie bedeutet eine große Möglichkeit, aber ihr begegnet auch ein schwerer Einwand im Blick auf die Familie. Die Kinder der verheirateten berufstätigen Frau wachsen ohne jene zärtliche Geborgenheit des Elternhauses auf, aus der frühere Generationen lebenslang physische und seelische Kraft schöpften. Die Einsamkeit der heutigen Jugend redet eine erschütternde Sprache. Hier ist der weibliche, echt mütterliche Einfluß nicht gestiegen, sondern zurückgegangen. Auch Berdjajew kennt die Schranken seiner Konzeption..„Die wach-* sende Bedeutung der Frau“, so sagt er, „hat aber* nichts* mit der modernen Emanziparffflfi zu tun, das ist eine antihierarchische und nivellierende Bewegung.“ Dennoch besteht kein Zweifel, daß die Frau, auch in den ehemals nur dem Manne geöffneten Berufen, Kräften dienen konnte, die dem vollen Einsatz ihrer Weiblichkeit entsprachen und der Gefahr des Maschinenherzens ein Menschenherz entgegensetzten. Allein der volle Sieg irer weiblichen Kräfte über eine nach Berdjajew allzu einseitige männliche Welt ist nicht erfolgt — die Zeilen des großen Russen sind nach dem ersten Weltkrieg geschrieben —, die Frau hat den zweiten nicht verhindern können, sie wird auch den dritten, wenn er zur Diskussion stünde, nicht verhindern. Denn die Hoffnung auf die Frau verlangt ja immer auch die Bereitschaft des Mannes: nur im harmonischen Zusammenwirken der polaren Kräfte erfüllt sich das Gesetz eines geordneten Kosmos.
Aber natürlich weiß auch Giono, daß nicht alle seinem Ruf folgen und zur Natur zurückkehren können, darum läßt er die Natur zum Menschen kommen. Der Wald erhebt sich und überwältigt die Städte: „Er treibt die Trümmer einer todgeweihten Zivilisation vor sich her, er holt sie ein, springt über sie hinweg und begräbt sie unter der Last seiner Wurzeln. Und so finde ich dich wieder, Paris, so finde ich dich wieder!“
Nur die Dichter verstehen, was mit dieser märchenhaften Offensive des Waldes gemeint ist. Sie stellt das Symbol einer Naturgewalt dar, die jeden Augenblick die Fesseln sprengen kann, welche ihr der Mensch anlegte. Denn die Natur ist letztlich stärker als die Technik — sie bleibt die große Unbekannte und Ursprüngliche, der wohl der Mensch Kräfte zu entreißen vermag, aber deren Wesen ihm zutiefst unbekannt bleibt, auch' wenn er den geraubten Kräften diesen oder jenen Namen gibt. Die Offensive des Waldes bedeutet die unendliche Überlegenheit der Natur über die Zivilisation — also alles dessen, was seine Ursprünglichkeit bewahrte.
Wir erinnern uns hier an denselben Giono, der uns vor Jahren das unvergeßliche Buch „Die große Herde“ schenkte. Dieses' Buch, mit der ungeheuren Technisierung des ersten Weltkrieges ringend, transzendiert nirgends, es ruft weder religiöse noch ethische Motive auf, das letzte Wort hat nicht der Mensch, sondern die Kreatur schlechthin — das heißt, es verkündet einfach den Primat der Schöpfung: er ist das Grundmotiv aller Werke Gionos. Aber lautet nicht auch die christlich-theologische Verkündigung auf die Erkenntnis, daß die Natur die Voraussetzung der Gnade sei, also auf den Primar. der Schöpfung vor der Erlösung? Wie stellt sich dieser Satz zur heutigen Weltstunde, die eine weit fruchtbarere technische Bedrohung als die des ersten Weltkrieges darstellt? Bedeutet er nicht die kläre Fragestellung: Hat der Mensch das Recht, die Schöpfung Gottes zu vernichten? Kann derselbe Mensch, der sich berechtigt fühlt, nach den Sternen des Alls aufzubrechen, alles Leben des eigenen Sternes vernichten? In der Tat, dieses ist die einzige gültige Frage, die sich heute von der Theologie her ergibt. Es gilt weder das Martyrium für Glauben noch Freiheit — eine Forderung, die vielleicht für einen Teil der Menschheit gültig sein mag, aber niemals für das zwangsweise Massensterben von unendlich vielen, die keinerlei Verhältnis zum Glauben und zur Freiheit haben, und keinesfalls gilt es für die gesamte Kreatur! Sondern es gilt der Primat der Schöpfung, es gilt die Heiligkeit des Lebens schlechthin, nicht nur die des menschlichen Lebens.
Und damit sind wir wieder bei der Hoffnung auf die Frau angelangt: ist es die Trägerin des Lebens, die Berdjajew meinte, als er ihr für die Zukunft eine größere Bedeutung voraussagte? Oder was gab ihm sonst den Mut zu dieser Hoffnung? Wie kam er zu dem Ausspruch, daß sich die Frau auf einer größeren Höhe gezeigt habe als der Mann? Paul Claudel hat uns das herbe Wort hinterlassen: „Die Frau ist ein Versprechen, welches nicht gehalten werden kann.“ Wo sind die Frauen, welche ein Berdjajew meinte? Sind die, welche wir kennen, nicht selbst bereits einer oft allzu aufdringlichen Technik verfallen? Man muß zugestehen: diese Technik macht sie hübscher, wenn auch nicht schöner. Sie verwischt alle Spuren überstandener Jahre, überstandener Enttäuschungen und Schmerzen zugunsten einer ewig strahlenden, wenn auch nicht ganz überzeugenden Jugend; aber sie verwischt auch das Einmalige und Unvergeßliche. In all diesen Gesichtern gibt es keine Schicksalsspur von unerbittlicher und ergreifender Prägung. — Aber vielleicht müssen wir wie Giono die Städte verlassen, um diejenige zu finden, die der große Russe meinte. Vielleicht müssen wir wie er in jenes unberührte Land flüchten, wo noch die Flöte des Pan nachhallt und der Schatten der Nymphe über dem Brunnenbecken schwebt — vielleicht, daß wir dort in dem mütterlichen Antlitz einer schlichten Landfrau diejenige finden, die wir suchen und die uns ohne weiteres überzeugt? Oder gehen hier in der Provence, so nahe den ergreifenden Ruinen antiker Theater, noch die Gestalten der antiken Dichtung um? Ist es Vielleicht Antigene, die'ühVfirh GrTOTfoV Landschaf t •'entgegeritritt?' Sie macht einige Schritte voll Anmut und Kraft, sie streift das Gewand von den Knöcheln und badet die Füße im Tau der Morgenfrühe, um sie für ihren Weg zu stärken. Wird sie die Kraft haben, ihr Ziel zu erreichen? Wird sie den Kampf für die Menschlichkeit, so wie er ihrer Zeit aufgetragen war, bestehen? Nein, sie wird ihn nicht bestehen, ebenso wie die heutige Frau den ihren nicht bestehen wird. Denn es sind ja nicht die Spuren einer kindlich eitlen Technik, die die heutige Frau am Siege hindern — es ist die Unzulänglichkeit ihrer Kraft: das Paradoxe der Hoffnung auf die Frau besteht darin, daß es nicht die herrscherlichen Kräfte sind, die sie einzusetzen vermag. Die Welt aber als solche ist gewohnt, von Macht regiert zu werden. Allein auch ein Giono konnte der Frau nicht zum Siege verhelfen — Giono bedeutet die glorreiche Entscheidung des einzelnen für den einzelnen.
Nein, Antigone hat nicht gesiegt, und dennoch hallt das Wort, das ihr der Dichter in den Mund legte: „Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da“, durch die Jahrtausende unvergessen und unvergeßbar, den Glauben an die Frau bezeugend. Ihm hat das Christentum in seiner Marienlehre Ausdruck verliehen: die gleiche Zeit, die das Antlitz der Frau bis zur Unkenntlichkeit übermalte, sie hat auch das Marienantlitz herausgestellt und seine Verehrung zu einer früher unbekannten Höhe erhoben. Hier ist nicht der Ort, nach der Realität der verschiedenen Marienerscheinungen zu fragen, welche die letzten Jahrzehnte an den verschiedensten Orten zu verzeichnen haben — es genügt, die Sehnsucht der Völker danach festzustellen. Die Kirche hat dieser Sehnsucht entsprochen durch die Verkündigung eines freilich oft mißverstandenen Dogmas. Aber nicht dessen transzendentes Marienbild geht uns hier zutiefst an, auch nicht das der jungen strahlenden Mutter- mit dem Kind im Arme, sondern das der Pietä — es ist das eigentliche Bild des Frauenschicksals in der Zeit, das Bild der schmerzensreich Unterlegenen. Allein der Kampf um das Menschliche ist nie vergeblich, auch wenn ihm äußerlich kein Sieg beschieden ist. „On ne se bat pas dans l'espoir du succes“, heißt es in Rostands „Cyrano de Bergerac“. Soweit unsere Augen reichen, wird die Sendung der Frau die dämonische Verführung, die von den unbeherrschten Gewalten unserer Zeit ausgeht, nicht überwinden, aber immer wieder durch den Schmerz des Unterliegens läutern können und so auch unserem technischen Zeitalter zum Durchbruch eines menschlichen helfen. Der moderne Krieg als die letzte furchtbarste Ausgeburt des technischen Zeitalters wird nicht durch erhöhte Technik überwunden, sondern durch das kreatür-liche Erbarmen oder, wie es Giono nennt, durch die Barmherzigkeit der Welt. „Der Sieg des Lebens“ ist der Titel seines letzten Werkes — man könnte ihn über jedes seiner Bücher schreiben.
Mag das Elektronengehirn, von dem man uns berichtet, wirklich unseren Intellekt weithin ersetzen, indem es Rechnungen von staunenswerten Ausmaßen vollbringt — ein Menschenherz wird das Maschinenherz niemals ersetzen — Maschinen können weder dichten noch beten, noch können sie lieben.