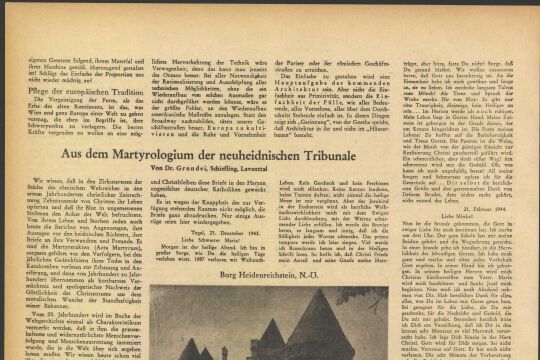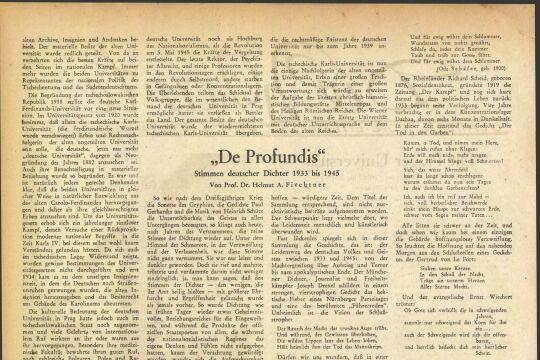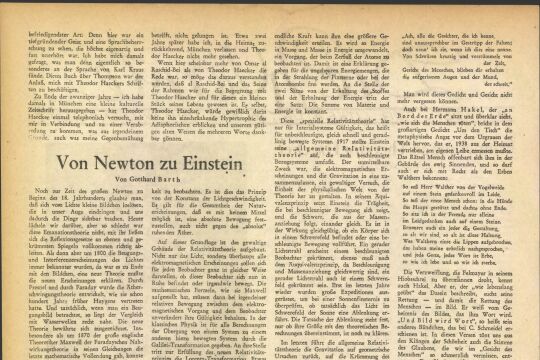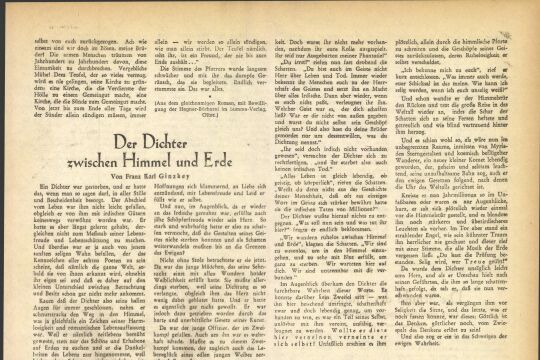Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DIE FRÜHVOLLENDETEN
Dichter, als der Wahrheit und Liebe Verpflichtete, vollziehen — sofem es sich um echte Berufung handelt — heute wie je die höchste, freilich auch die leidvollste Form der Wahrsagung. Ihr Auftrag ist nicht bloß ein künstlerischer und geistiger, sondern auch ein ethischer und religiöser. Im Leiden erleben sie die stärkste Möglichkeit des Gefühls. Das Leid löst ihre Zunge, das Leid singen sie in ihr Gedicht; wie die herrlichste barocke Pestsäule auf Leichen, die großartigsten barocken Kirchen auf der Not der Türkenkriege gegründet sind. Diese Dulder, am Irdischen Leidenden und sich nach Befreiung davon Sehnenden sind jedoch immer von neuem aus ihrer Umnachtung strahlend erwacht, um ihre Hymnen zu vollenden. So Hölderlin: „Doch ist mir einst das Heü'ge, das am Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen: willkommen dann, o Stille der Schattenwelt...“
Im „Torquato Tasso“ wird uns nicht nur das Leiden, das wesentliche Martyrium des Genies, sondern — wie Schopenhauer sagt — auch dessen „stetiger Übergang zum Wahnsinn“ vor Augen gestellt.
Vor allem waren es die Frühvollendeten mit ihrem meteorhaften Aufstieg und dem lautlos verhüllten Abgang, die, in einem erstaunlichen Einklang von Wort und Schweigen, den Schleier über dem Eigentlichen, das wir ahnen und suchen, gelüftet und die Wahrheit nicht als etwas Schreckliches, sondern als ein Übermaß des Lichts, das uns blendet, erkannt haben. Ihr Wesenssymbol ist nach dem östlichen Mythos der Feigenbaum mit seinen süßen, Erkenntnis und Tod bringenden Früchten. Hier hat das Dichterische Offenbarungscharakter und gründet in einem grundsätzlich anderen Weltbild als dem der Bewußtheit und des Rationalen.
Der kürzlich heimgegangene Ludwig von Ficker, dessen Tod sein Werk und das seiner Auserwählten des „Brenner“-Kreises neu vor uns auferstehen Heß, hat dank seiner Sehergabe Dichter jener Spezies aufgespürt. Es war die fruchtbare letzte Saat der sterbenden Monarchie. Am Grabe Georg Trakls, auf dem Friedhof von Mühlau bei Innsbruck, der Josef Leitgeb und nun auch ihn selbst aufgenommen hat, sprach Ficker die Worte: „Hinschwandst du uns, Verblichener, ins Unverblichene deines eigenen Gesichts ... ein Leidwesen, groß und gefaßt. Und was es, früh umflort vom Dämmer der Umnachtung, an Wahrnehmung behielt, bis es in Wahrneh-
mung zerfiel, war dies: ,Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden.'“
Man hat die stets gespannte, überempfindliche Seele des Poeten mit einer hängenden Laute verglichen, die immer ertönt, sobald man sie berührt. „Was aber das Werk groß macht, ist seine, ist des Menschen Größe; denn der große Schöpfer ist notwendigerweise größer als sein Werk“, sagt R. v. Schaukai. Deshalb übt in uns das Gefühl der persönlichen Nähe des Dichters mehr Faszination aus als die Schönheit des Werkes selbst. Diese menschliche Größe erfaßt uns gleich einer stürmischen Woge und überträgt auf uns jene „ozeanische Erregung“, die im Ausdruck des innerlichen Menschen hegt, von dem Bernanos sagt, daß er ein ununterbrochener Schrei sei, unter dem die Welt erbeben müßte, die doch unter nichts anderem mehr zittert als Kriegen, Bomben und Zusammenbrüchen. Es mangle dieser leichenhaften Welt das Ärgernis der Poesie, so wie auch das Ärgernis der Wahrheit.
Freilich, sie brauchen uns nicht mehr, die „frühe Entrückten“, wie Rilke sie nennt, aber wir bedürfen ihrer. „Wir, die so große Geheimnisse brauchen, denen aus Trauer so oft seliger Fortschritt entspringt: — könnten wir sein ohne sie?“ Für die Zurückgebliebenen wurden sie zu Schlafend-Leben-digen. Ihr Tod tritt zurück gegenüber dem Erbe, das sie den „Länger-Währenden“ hinterlassen haben: einem unerschöpflichen Quell an seelischer Kraft, an Schönheit und Gnade für die übernatürliche Ebene neuer Gedichte.
Die immerwährende Ergriffenheit und Begeisterung der Seele, wie sie auf seraphischen Gesichtern mancher Dichterjünglinge liegt, die ein Gainsborough oder Reynolds gemalt haben könnte, spiegelt sich in deren hymnischen Gesängen auf die Bruderschaft von Liebe und Tod, von Schlaf und Tod, von Traum und Leben, Aussagen, die dem künstlerisch Empfänglichen immer wieder neue Aspekte der Wahrheit erschließen. Die wenigsten Missionare des Glaubens vermögen das Unermeßliche so zu künden wie ein Dichter, weil Dichtung — so formuliert es H. Broch — „die einzige aller menschlichen Tätigkeiten ist, die der Todeserkenntnis dient... weil Dichten intensives Sterben ist'“. — In seinem Gedicht „Auf den Tod“ fragt der elegische Genius John Keats, der Begründer der narzißhatften Lyrik: „Kann Tod Schlaf sein, wenn Leben nur ein Traum?“ — Und seine Antwort lautet: „Das Nachher heißt Erwachen.“ Keats und Shelley, die beiden „Frühlingsnachtigallen“, und Lord Byron, das feurige Haupt der englischen Romantik, starben im Jünglingsalter in den klassischen Ländern: Keats an Schwindsucht, Byron an Fieber, Shelley versank bei einer Bootsfahrt im Thyrrhenischen Meer.
Diese von den Göttern auf kurze Zeit zu den Sterblichen entsandten Lieblinge, diese Frühvollendeten, mit der ihnen gegebenen erleuchteteren Verfassung und unerhörten Fruchtbarkeit, haben in dem kurzen Akt ihres Erdendaseins das verwirklicht, was sie auf ihr Schild geschrieben hatten: Von den' Toten zu reden und damit „leise des Unrechts Anschein abzutun“, wie es in der ersten Duineser Elegie heißt, den Anschein des Unrechts, jenes unbegründete Mitleid, das sich der Lebenden in der sinnlosen Tretmühle ihres täglichen Tuns angesichts von Grabstelen bemächtigt.
Die Gesänge von Liebe und Tod bezeugen, daß diese Poeten, diese leicht Entzündbaren, alle Liebende waren, erfüllt oder unerfüllt Liebende, und manche von ihnen sind nicht allein, sie sind mit ihren Schmerzverschwisterten hinübergegangen, denn Liebe und Tod haben eine gemeinsame Wurzel, und es ist nicht von ungefähr, daß die schönsten Liebesgeschichten mit dem Tod enden. „Einfach und unbekümmert“, sagt Ladislaus Boros, „gehen Liebende in den Tod hinein. Sie begeben sich ja nicht ins Fremde, sondern in den Innenraum der Liebe.“
Man verwechsle Tiefe nicht mit Trübsinn und glaube nicht, daß der Leidende keine Heiterkeit kenne, Heiterkeit im Sinne Nietzsches, als „Vorgenuß des Todes“. Die Tempel Apollons stehen nicht an düsteren Orten. Wir sehen es an schwer heimgesuchten Dichtern wie Hölderlin, dem einzig Verbliebenen aus der großen erlesenen Schar des 18. Jahrhunderts, das sein herrliches junges Geschlecht, das kühnste und leidenschaftlichste seit den Tagen der Renaissance, nicht liebte. Vielfältig und verfrüht war ihr Tod. Revolutionen, Kriege, tödliche Krankheiten und tragische Verhängnisse rotteten ein junges Geschlecht von Heroen der schönen Künste aus. Manche — und vielleicht die Größten von ihnen — sind erst spät aus dem Dunkel der Vergessenheit und des Unverstandes ihrer Zeitgenossen wiedergeboren worden, wie Hölderlin, dessen Wiederentdecker Norbert von Hellingrath, selbst ein früh Abberufener, kürzlich unter dem Titel „Unsterbliche Jugend“ an dieser Stelle gewürdigt worden ist. Nach der antikischen hölderldnschen Idee gibt es — so die Interpretation Stefan Zweigs — das Göttliche erst durch die Dichtung, die nicht bloß eine Kreation innerhalb des Kosmos, sondern die Erschaffung des Kosmos selbst ist, also
eine Weltnotwendigkeit. In Hölderlins Versen liegt das Auflösen alles Erdhaften, das feindliche Sich^Absetzen von der Erde, das gewichtlose Entschweben ins Unbegrenzte.
Der 29jährige Novalis will „in Tautropfen hinuntersinken und mit der Asche sich verbinden“, und Kleist, dem — wie er meinte — alles mißglückte, gelang der ekstatische Untergang als Sinn seines Seins. Das einzige wirkliche Gedicht schuf er, als er schon nicht mehr von dieser Erde war: die mystischtrunkene „Todeslitanei“. Er hatte eine Geliebte gefunden, „deren Seele wie ein junger Adler flog“, die seine Traurigkeit als eine „höhere, unheilbare“1 begriff und die ihm deshalb in den Tod folgte. Seinen Todesbrief an die Schwester beschließt er mit den Worten: „Möge Dir der Himmel einen Tod schenken, nur halb an Freude und unaussprechlicher Heiterkeit dem meinigen gleich.“ Kleist glaubte schon als Knabe, daß die Vervollkommnung der Zweck der Schöpfung sei und daß wir nach dem Tode von der hier erreichten Stufe der Vervollkommnung auf einem anderen Stern fortschreiten würden.
„Man könnte vielleicht sagen, daß meine Dichtung der beste Beweis eines metaphysischen Landes ist, das seine schwarzen Halbinseln weit herein in unsere flüchtigen Tage steckt“, so präzisiert der unstete, zwischen Vitalität und Todessehnsucht, Gutem und Abwegigem in verzehrenden Schwankungen lebende Dichter Georg Heym seine Eigenart. Ein knappes Jahrhundert nach Shelley fand auch er im Jünglingsalter den Tod im Wasser. Heym hatte in einer Auseinandersetzung über den Schicksalsbegriff sein frühes Ende vorausgesagt. Auch in der Aufzeichnung eines Traumes lesen wir die unheimliche Prophetie seines verhängnisvollen Unterganges: „Ich stand an dem großen See, der ganz mit einer Art Steinplatten bedeckt war. Es schien mir eine Art gefrorenen Wassers au sein. Manchmal sah er aus wie die Haut, die sich auf Milch zieht... ich fühlte, daß die Platten sehr dünn waren, wenn ich eine betrat, so schwankte sie hin und her... Da kam mir der Gedanke, ich möchte fallen können. In diesem Augenblick versank ich auch schon in ein grünes schlammiges schlingpflanzenreiches Wasser...“ Im Traum konnte er sich in eine sonnige Bucht retten, aber die dem Traum folgende Wirklichkeit behielt ihn in der Tiefe: zu einer anderen Auferstehung, zum Bleibenden im Herzen seiner Freunde. Metaphorisch gestaltet finden wir diese Vision in einem sehr schönen Gedicht:
Deine Wimpern, die langen,
Deiner Augen dunkle Wasser,
haß mich tauchen darein,
Laß mich zur Tiefe gehn.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!