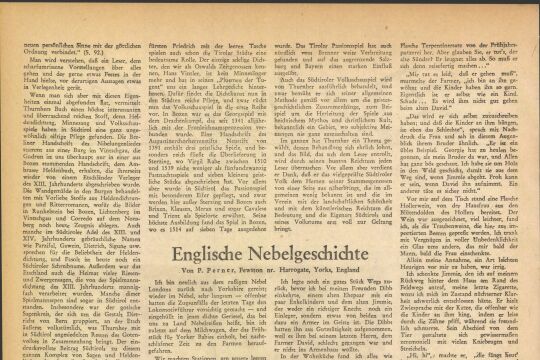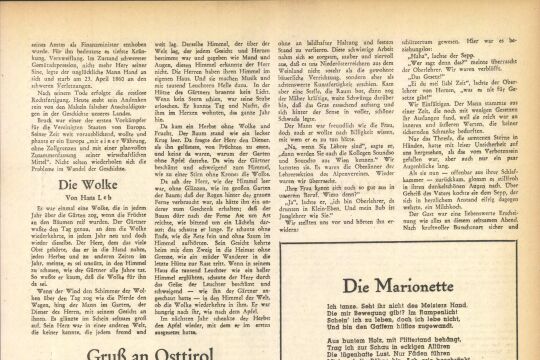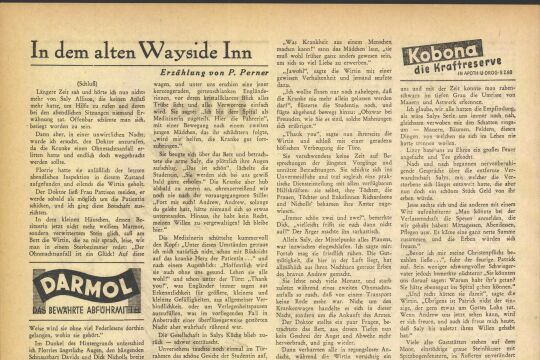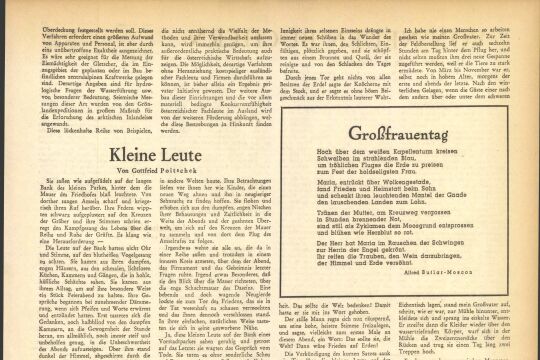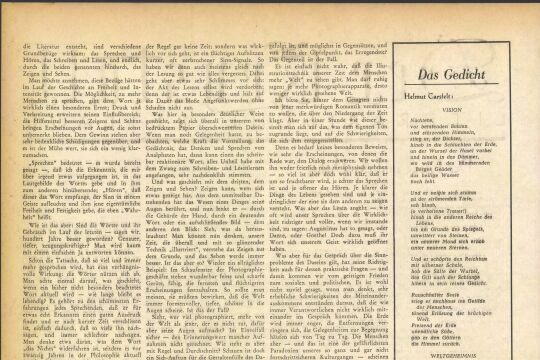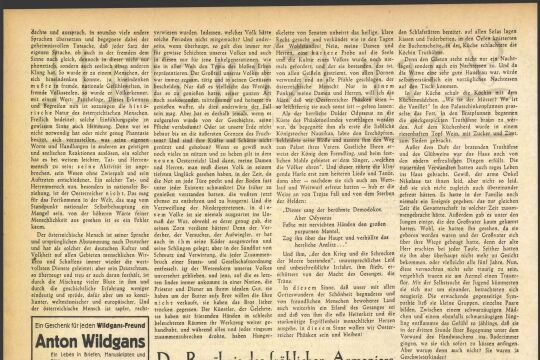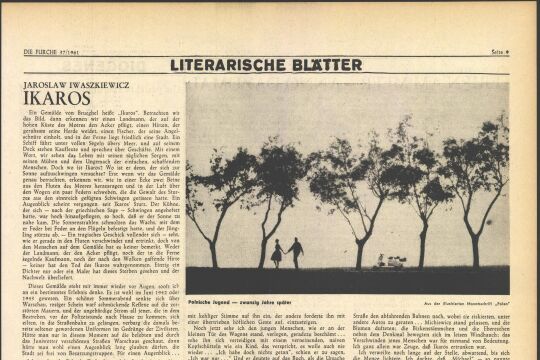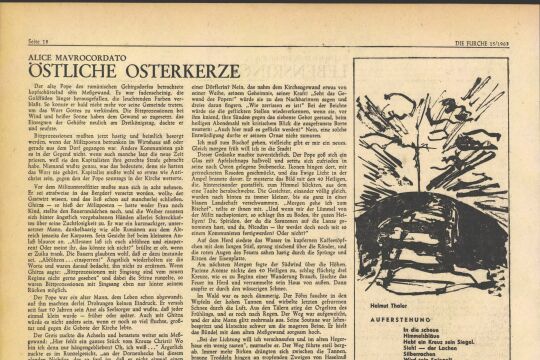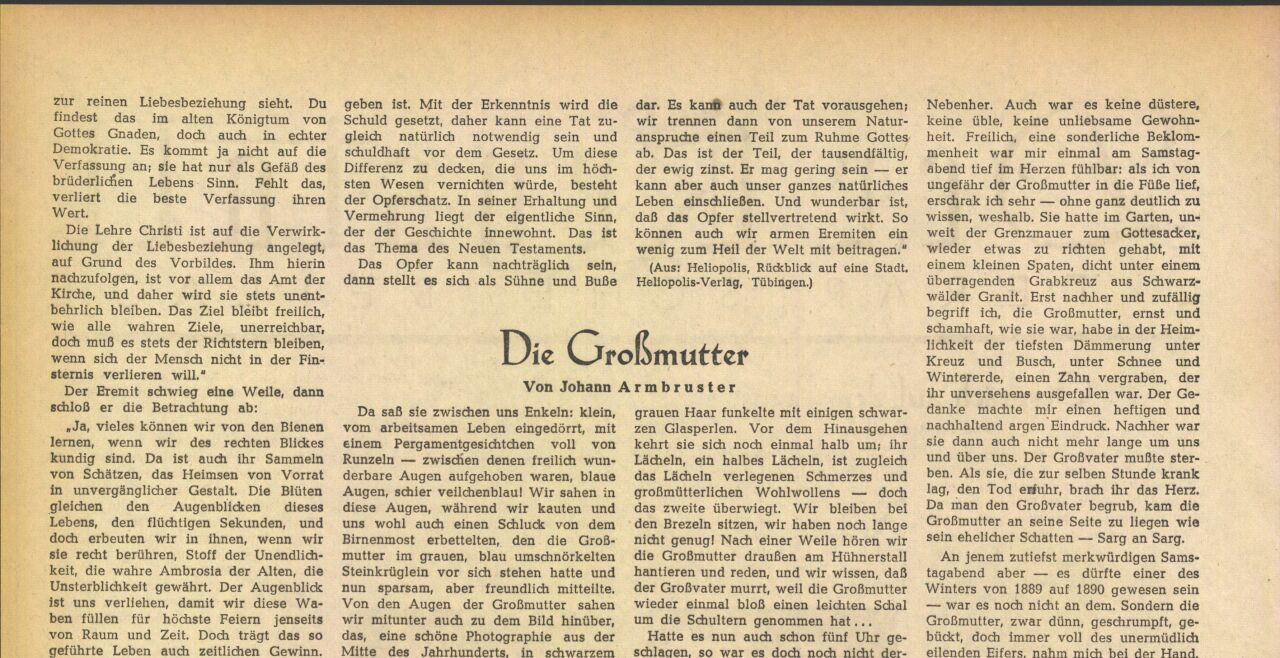
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Großmutter
Da saß sie zwischen uns Enkeln: klein, vom arbeitsamen Leben eingedörrt, mit einem Pergamentgesiditchen voll von Runzeln — zwischen denen freilich wunderbare Augen aufgehoben waren, blaue Augen, schier veilchenblau! Wir sahen in diese Augen, während wir kauten und uns wohl auch einen Schluck von dem Birnenmost erbettelten, den die Großmutter im grauen, blau umschnörkelten Steinkrüglein vor sich stehen hatte und nun sparsam, aber freundlich mitteilte. Von den Augen der Großmutter sahen wir mitunter auch zu dem Bild hinüber, das, eine schöne Photographie aus der Mitte des Jahrhunderts, in schwarzem Oval aus der Zeit des Königs Louis-Philippe (so weiß ich's heute), zwischen den fein gezeichneten, mit Wasserfarben empfindsam abgetönten Bildnissen der anderen hing. Auf dieser Photographie war die Großmutter mit einem weiten, vielfältigen, langen Krinolinenkleid aus Atlas von glänzendem, eher pflaumenblauem Violett angetan (sie selber nannte uns die Farbe) — doch ist es wohl möglich, daß dem modischen Kolorit oder Ton auch etwas wie ein geistlicher Ausdruck eigen war. Am Halsband saß eine große Brosche, wie wir sie kannten: da war inmitten goldener Ranken ein goldenes Weinblatt, das sich heben ließ und, emporgeschlagen, ein Jugendbildchen des Großvaters aus Bräutigamszeiten freigab — Miniatur aus Pariser Malerhand von 1848, mit brandrotem Schopf... Der schwarze Scheitel der Großmutter im Lichtbild also trug auf der Höhe ein dunkles Spitzenhäubchen. Das Angesicht war auf lateinische Weise ebenmäßig, war mit milder Würde erfüllt, war ernst und gut, bex deutend und ehrfürchtig. Im Hintergrund stand das Heidelberger Schloß, wie man es von der großen Terrasse sieht. Die eine Hand der Großmutter lag auf einem Postament, das mitten im Freien eigens bestellt schien, Hände zu tragen — nls wären Hände Denkmäler (und diese waren es vielleicht); die andere Hand hielt vor der Brust ein Gebetbuch, wie unsere Großmutter auch dann noch eine fromme Katholikin blieb, als sie sich für den Großvater photographieren ließ, den Skeptiker und Achtundvierziger, den Mann, der mit Hecker und Struve, mit Venedy und Muser befreundet war...
So sah die Großmutter auf dem Bilde aus. Nun saß sie da, und nur noch die Augen waren wie im Bilde — die Augen und das Spitzenhäubchen. Denn sonst fanden wir keine Ähnlichkeit mehr. Sie saß am Tisch und sie stand auf — ach, jeden Augenblick stand sie auf, um irgend etwas am langen Tische anders zu fügen, um eine Bestellung in die Küche zu geben oder im Haushalt etwas anzuordnen, wo nicht selbst zu tun, das ihr in augenblicklichen Verbindungen der Gedanke zugeschossen war. Dies war also jetzt die Großmutter, die Josephine hieß (mit einem Akzent auf dem e und dem französisch zu sprechenden Namen, denn so, ein bißchen rheinbündisch noch, hielt man es vor hundert und selbst vor fünfzig Jahren im Badischen). Nun ging sie schon wieder hinaus! Sie stützte ihre Hände auf die Lenden, legte den schmerzenden Flanken, dem von Arbeit angestrengten Kreuz die eigenen Hände auf, als wären es die heilkräftigen Hände einer anderen, einer fürsorgenden Person. Oder umgekehrt: indem die Großmutter sich selbst die Hand auflegte, hatte sie einen Ausdruck, nahm sie eine Wendung an, als erweise sie einem anderen Menschen etwas Gutes.
Der Rücken war schmal und vorgewölbt, und an ihm lagen die weißgesäumten Bänder der dunklen Hausschürze kreuzweise aufeinander, nach einem Zeichen, dessen er, Gott weiß es, wert war. Das schwarze Häubchen auf dem grauen Haar funkelte mit einigen schwarzen Glasperlen. Vor dem Hinausgehen kehrt sie sich noch einmal halb um; ihr Lächeln, ein halbes Lächeln, ist zugleich das Lächeln verlegenen Schmerzes und großmütterlichen Wohlwollens — doch das zweite überwiegt. Wir bleiben bei den Brezeln sitzen, wir haben noch lange nicht genug! Nach einer Weile hören wir die Großmutter draußen am Hühnerstall hantieren und reden, und wir wissen, daß der Großvater murrt, weil die Großmutter wieder einmal bloß einen leichten Schal um die Schultern genommen hat...
Hatte es nun auch schon fünf Uhr geschlagen, so war es doch noch nicht dermaßen Nacht, daß wir im Hause verbleiben mußten. Wir fuhren nochmals in die Stiefel, nahmen die Mäntel oder nahmen sie nicht, denn es war uns warm genug und juckte uns, die Kälte zu spüren. Wir gingen zum Küfer in die Werkstatt, zu den Kühen im Unterstall, in den oberen Stall zu den Pferden. Diesen betrat man von der Rückseite, wo der bergige Fußboden höher lag.
Dann war es Zeit, in das Haus zurückzukehren. Aber wie man liebte, die Dinge aufs äußerste zu treiben, so machte man noch den Umweg durch den größeren Hausgarten auf der anderen Seite stadtauswärts. Die Tannen im Garten waren mit Schwarz und Weiß noch kennttlich. In der Mitte des Rasens stand mein Lebensbaum: der Großvater hatte ihn am Tage meiner Geburt eingesetzt, und nun ragte das Bäumchen schon längst über meinen Scheitel, so daß ich nicht begriff, wie wir gleichen Alters zu sein vermochten. Uber der Gartenmauer erschienen die Grabsteine des nachbarlich ansteigenden Friedhofes, der mit seinem oberen Rand aus dunklen Schwarzwaldhängen nicht unschuldig daran war, wenn es uns zur Gewohnheit wurde, nebenher tagein, tagaus einmal an den Tod zu denken.
Nebenher. Auch war es keine düstere, keine üble, keine unliebsame Gewohnheit. Freilich, eine sonderliche Beklommenheit war mir einmal am Samstagabend tief im Herzen fühlbar: als ich von ungefähr der Großmutter in die Füße lief, erschrak ich sehr — ohne ganz deutlich zu wissen, weshalb. Sie hatte im Garten, un weit der Grenzmauer zum Gottesacker, wieder etwas zu richten gehabt, mit einem kleinen Spaten, dicht unter einem überragenden Grabkreuz aus Schwarzwälder Granit. Erst nachher und zufällig begriff ich, die Großmutter, ernst und schamhaft, wie sie war, habe in der Heimlichkeit der tiefsten Dämmerung unter Kreuz und Busch, unter Schnee und Wintererde, einen Zahn vergraben, der ihr unversehens ausgefallen war. Der Gedanke machte mir einen heftigen und nachhaltend argen Eindruck. Nachher war sie dann auch nicht mehr lange um uns und über uns. Der Großvater mußte sterben. Als sie, die zur selben Stunde krank lag, den Tod erfuhr, brach ihr das Herz. Da man den Großvater begrub, kam die Großmutter an seine Seite zu liegen wie sein ehelicher Schatten — Sarg an Sarg.
An jenem zutiefst merkwürdigen Samstagabend aber — es dürfte einer des Winters von 1889 auf 1890 gewesen sein — war es noch nicht an dem. Sondern die Großmutter, zwar dünn, geschrumpft, gebückt, doch immer voll des unermüdlich eilenden Eifers, nahm mich bei der Hand, lächelte und sagte: „Komm, Büble“ — schob mich in die Küche, goß mir von der Soße einer sauren Niere ein wenig auf ein Plättchen, gab mir ein Weckenviertel-chen dazu, zum Tunken. „Da, Büble.“ Sie stand still, sah mich aus schweren Augen an und kreuzte ihre trockenen alten Hände über dem welken Schoß.
Ich tat, wie mir erlaubt war. Dann ging ich in die Stube und setzte mich zum Mühlenspiel. Als ich genug hatte, holte ich mir Papier nebst meinen bunten Kreiden und machte zum soundsovielten Male mir selbst die Probe aufs Exempel: ich zeichnete Afrika unter der heimischen Winterlampe aus dem Gedächtnis und brachte das Blatt zur Großmutter. Der Kongostaat war gelb, Madagaskar lila, die Sahara, Marokko, Algerien desgleichen, der portugiesische Besitz grasgrün, der englische rosa, der deutsche lichtblau. Die Großmutter legte es, freundlich, nickend, meinen ungebärdigen Kopf streichelnd, zum übrigen. Denn sie besaß das nämliche Bild einer heißeren Welt wohl schon im Dutzend.
(Aus: Wilhelm Hausenstein (Johann Armbruster], Lux perpetua. Geschichte einer deutschen Jugend aus des 19. Jahrhunderts Ende. Verlag Karl Alber, München-Freiburg.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!