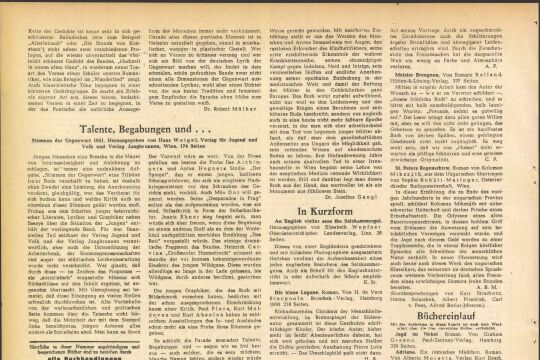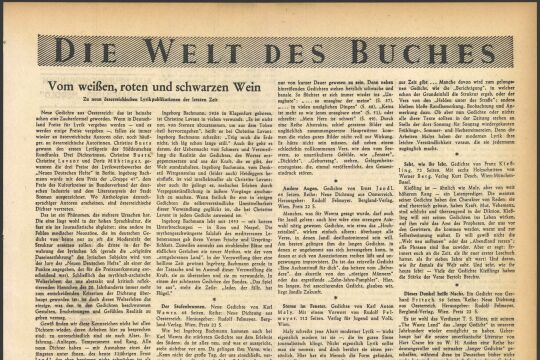Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die jungen Dichter neben uns
Junge Prosaschriftsteller haben es immer noch verhältnismäßig leicht; es wird zwar keiner von ihnen noch ernstlich damit rechnen dürfen, jemals vom Verkaut seiner Dichtungen leben zu können — aber sie sind doch wenigstens nicht von vornherein zum Schweigen verurteilt: wenn's der Zufall will, finden gute Romane oder kleinere Prosaarbeiten auch heute noch einen Verleger und in kleinen Auflagen vielleicht sogar ein verständiges Publikum. Aber die zahlreichen und begabten jungen Lyriker, die mit uns Tür an Tür wohnen? Ihre Gedichte bleiben in den Schreibtischladen liegen —- ja, sie sind sozusagen von Anfang an nur für die Schreibtischlade bestimmt. Wenn sie in engen Freundeskreisen von Hand zu Hand gehen, erreichen sie das Maximum ihrer Verbreitung. Von den vierzehn Autoren beispielsweise, die in der Lyrikanthologie „Tür an Tür zu Worte kommen, hat ein einziger das Glück gehabt, einen eigenen kleinen Gedichtband veröffentlichen zu können. Das dürfte dem allgemeinen Verhältnis zwischen guter gedruckter und guter ungedruckter Lyrik entsprechen. Gelegentliche Zeititngsabdrucke von Gedichten und gewöhnlich schlecht besuchte Lesungen machen den Mangel nicht wett. Und so bleibt den jungen Lyrikern als einzige Möglichkeit des Auftretens in der Öffentlichkeit eigentlich nur die einer Sammeledition, einer Anthologie. Denn einem Dutzend fällt es leichter als einem einzelnen, die zur Drucklegung notwendigen Subskriptionen gutwilliger Verwandter und Bekannter aufzutreiben...
In der Tat, einer, der sich über die heranwachsende Dichtergeneration zu unterrichten wünschte, brauchte keine Kataloge durchzublättern: „Die Sammlung“, eine im Ullstein-Verlag 1948 erschienene Anthologie, das „Tür-an-Tür“-Bändchen von 1950 und allenfalls noch die monatlichen Hefte der „Neuen Wege“, einer höchst schätzenswerten und vom „Theater der Jugend“ herausgegebenen Mittelschülerzeitschrift, wären alle Quellen, die ihm zur Verfügung stünden. Wenig, aber gerade genug, um die Art und den Wert unserer jungen Lyriker erkennen, einiges Bedeutende verfolgen und die Ungerechtigkeit des ganzen Zu-standes bedauern zu können. Die Dichter sind jedenfalls nicht schuld an ihm, denn sie können viel; man kann ihnen nicht einmal vorwerfen, daß ihre Verse „unverständlich“, weil „zu modern“ seien; kaum einer, der etwa Trakl an Sprachschwierigkeiten überträfe ... Doch genug des Beklagens. Die Lyriker haben sich mit ihrer Isolation, wenn schon nicht abgefunden, so doch vertraut gemacht. Sie dichten für sich und in die Stille hinein; man hört das aus ihren, darum nicht glanzloser gewordenen Worten heraus, auch wenn sie nicht so deutlich sind wie Herbert Eisenreichs Zeilen: O selten verstandener Wink: Im Käfig, mit Tüchern verhangen zur Täuschung, der schlagende Fink — Daheim nur aus schattigstem Strauch aufsang er. Doch selbst noch gefangen, gelingt ihm's ... O übten wir's auch. Sie üben es. Und da sie nur zu sich selbst und ihren Freunden sprechen können, die sich beide nicht bestechen lassen, sind sie der Sorge um Effekte und Wirkungen enthoben. So paradox das klingen mag: die Isolation, für die sonst freilich nichts spricht, tut den Gedichten der Jungen gut und läßt sie schneller reifen. In der „Tür-an-Tür“-Sammlung findet man gewiß leise Anklänge an Früheres: Trakl, Weinheber, seltener Rilke, Kramer und einmal sogar Däubler sind in Untertönen hörbar. Aber es fehlen die Verstiegenheiten, Selbst-stilisierungsversudie, Verkrampfungen und Gewalttätigkeiten, die man in .Tugendversen so oft antrifft. Das meiste
Herausgegeben von Rudolf F e 1 m a y e r, Zwei-Berge-Verlag, Wien 1950. 119 Seiten, Preis 10 S. ist sehr einfach und umweglos gesagt.
Der „Gesang des Stromes“ von Bertrand
Alfred E g g e r :
Die dröhnenden Wolken meines Himmels sind meine Wachen, sind immer -ur Hand. Die Schwärme zuckenden Fischgewimmels flechten mein triefendes Schuppengewand. Ich kenne die Berge, die Wälder, die Meere. Mein Atem tränkt das dürstende Land. Die leisen Lieder meiner Schwere wälzen die Steine und tragen den Sand.
Unprätentiöser hätte sich das wohl kaum sagen lasseu. Und Otto Horns „Tür an Tür“:
Einmal sind wir hier im Kellerloch gesessen; alle haben wir aus einem Topf gegessen, nicht gefragt, was weiß ich denn von dir?
Heute hältst du Mahlzeit hinter sicheren
Türen;
Nachbar, komm, bevor wir uns im Haus verirren,
Schließlich leben wir doch alle Tür an Tür wäre zwar schöner, aber kaum ehrlicher auszudrücken gewesen. Die ungemeine Spannweite des Tons, über welche Christine B u s t a — die allerdings schon eine reife und vollendete Individualität ist — spielend verfügt, hat sonst freilich keiner von den vierzehn. S i e kann alles.
Ihr gelingen breite und strahlende
Hymnen:
Mein Geliebter ist der Sommer. Riesig schifft er auf den Strömen hin und wirft nach beiden
Seiten
Sonnengarben in die Felderbreiten und den Rebenhügeln an die Brust. Wenn er hingeht, Wiesen um die Lenden, trägt er Bienenschwärme hoch in seinen
Händen, und die Winde schimmern durch sein Haar.
Auf der Seite daneben steht der bauernfromme „Sermon vom Kamel“; und dann wiederum „Der Gerichtsengel“ aus dem Straßburger Münster, der wahrhaftig vor Schmerz versteinert ist:
Laß mich versteint. Ich mag die Toten nicht wecken!
Ich ging durch die Städte und konnte die Lebenden nicht entdecken:
Wildnis war.
In den Häusern wohnte das Gras, aus den Fenster sahn
Purpurdistel und gelber Löwenzahn, vor den Toren wucherte graues Nesselhaar.
Laß mich versteint. Was kann noch die Lebenden schrecken?
Nein, Christine Busta ist in ihrer Art nicht zu übertreffen. Daß sie, die 35jäh-rige, sicherlich eine der vorzüglichsten Lyrikerinnen des deutschen Sprachraums ist, noch keine Gelegenheit hatte, einen eigenen Versband aufzulegen, ist selbst unter den genannten Umständen schmerzlich. Schade übrigens, daß wenigstens im vorliegenden Band Vera
Ferra, die lange genug mit Christine Busta Schritt zu halten versuchte, aus dem Wettstreit ausgeschieden ist; ihre Gedichte haben zwar nicht an Gefühl verloren, aber gestatten sich zu viele kleine Manierismen.
Die Männer haben-dem Reichtum der echten Dichterin Busta nur mit Mühe etwas entgegenzusetzen. Aber sie besitzen dafür Härte und Rücksichtslosigkeit, wie sich am Beispiel Walter T o m a n s zeigt, der in seinen freien Rhythmen eine Art von wehrhaftem Christentum predigt; er ist ein lyrischer Pamphletist und versucht, was der begabte Reinhard Federmann verbittert unterläßt: aktiv und unbekümmert seine Isolation zu durchbrechen. Im Ton lehrhaften Expressionismus erzählt er vom etwa „unchristlichen“ Siebentonnenlastwagen, der die Passanten schon durch seinen Luftzug „umhaut“ — aber von seinem Fahrer zur Seite und ins Verderben gerissen wird, weil ein Kind auf der Straße steht: Der Mann ist tot. Du aber siehst, daß auch ein Siebentonner mit Anhänger plötzlich ein Christ sein kann. Es kommt auf den
Fahrer an.
Karl Anton M a 1 y versucht, wie Toman, wenn auch eher unter sozialisti-. schem Aspekt, unmittelbar .menschliche Gewissen aufzurütteln; aber auch seine Verse sind im Grunde genommen in der Stille und zu sich selbst gesprochen. Karl W a w r a fällt aus der Reihe der andern heraus. Er ist nicht schwächer als wie sie, aber er ist. artistischer und fabriziert sozusagen literarische Leckerbissen — ein Gedichttitel „Auslage einer Haute-Couture-Firma“ ist charakteristisch dafür. Aber er kann's, und das ist die
Hauptsache. Gelegentlich findet er einen warmen und präzisen Ton, etwa in dem „Schwimmbad, in das kaum noch jemand geht“ und das von Kubin gezeichnet worden sein könnte: m
Der Wasserspiegel grünt ganz unbewegt.
Von Bienen tönen die verwunschnen Hecken, und Hitze brütet flimmernd in den Ecken, in die der Mittag seine Eier legt.
Oder in den „Pfützen“:
Gesehen von gewisser Perspektive, sind sie makaber wie gestocktes Blut, und trotzdem ruht in Ihrem bißchen Tiefe die Nacht so leise uhd der Weg so gut. In seiner Weise ist auch das gut gesehen und schön beschrieben. Es wäre noch manches zu sagen über diese jungen Dichter, die hier, eine Handvoll von vielen, drei oder vier Druckseiten vor die Augen der Öffentlichkeit legen; aber eine Besprechung dieses Bändchens, das man ganz lesen sollte, kann nur mit kurzen Hinweisen das Wichtigste belegen: den Ernst, die Begabung und die Wahrhaftigkeit, welche die österreichische Lyrik von morgen heute schon zeigen kann. Was sie braucht, ist weder Kritik noch Ermunterung, sondern nur Anteilnahme. Möge sie ihr gegeben werden — sie verdient es.
Anzumerken ist noch die selbstlose Arbeit des Herausgebers und die in aller Bescheidenheit ansprechende Ausstattung der kleinen Anthologie; anzukreiden, daß die politische Einstellung der Autoren nur sehr einseitig angegeben wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!