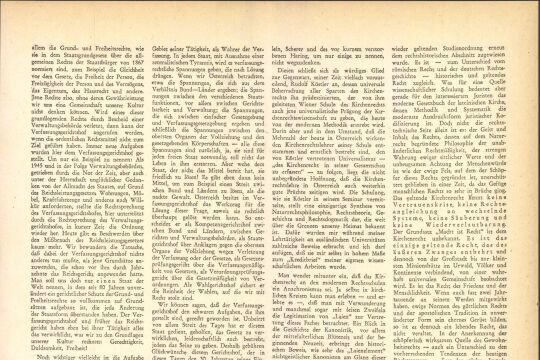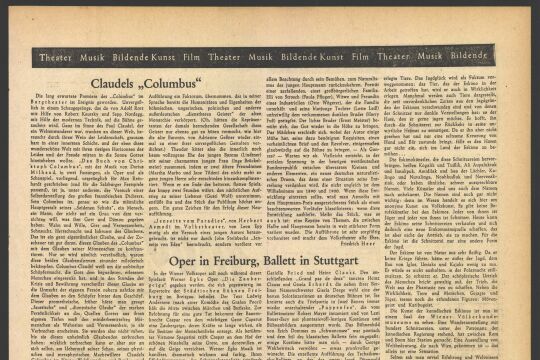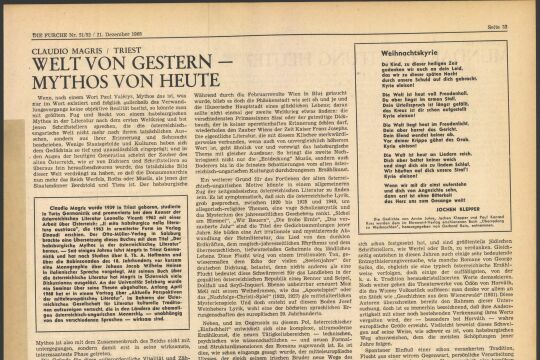Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Magie des Wortes
Vor genau dreißig Jahren sind mit der ersten Aufführung von Hofmannsthals „Jedermann“ in der Reinhardtschen Inszenierung auf dem Salzburger Domplatz die Salzburger Festspiele geboren worden, geboren aus einer nicht minder geistigen wie musischen Idee. Die Magie des Wortes hat die Jahrzehnte hindurch auf diesem herrlichen Festplatz des europäischen Barock inmitten der himmlischen Verklärung einer ebenso lieblichen wie grandiosen Landschaft überdauert, auch wenn die Idee sich gewandelt und die ursprünglichen Grenzen gesprengt hat.
Helene Thimig hat gegenüber dem Vorjahr 7war wieder einige Aktualisierungen und Lockerungen, wie die „tanzenden Engel“, wohltuenderweise gestrichen, dafür jedoch mit dem tanzenden Teufel Harald Kreutzbergs zwar eine Sensation, doch keineswegs 'inen künstlerischen Gewinn zu buchen. Die -“prachdämonie von Hofmannsthals Teufel ins Mimische zu transponieren, ist ein Filmeinfall, der nicht auf den Salzburger Dompatz gehört. So großartig sich die Tanzkunst Kreutzbergs entfaltet, so kläglich versagt er im Wort, was kein Vorwurf für ihn sein kann, da es ja niemand von ihm verlangt und erwartet. Wenn man sich dagegen an Werner Krauss erinnert, der“ im Vorjahr hier einen Gipfel diabolischer Sprachgewalt und Mimik erklomm, begreift man den Abstieg noch weniger. Auch Judith Holzmeisters Debüt als Ruhlschaft wird nach der lebensfeurigen Dagny Servaes zu einer kühlen Beschwörung des Schönen, statt zu einer Entflammung der Sinne, und man wird sich des Abstrakten des Schönen fast schaudernd bewußt. Solchem Abgleiten von der Magie des Wortes und des Gefühls ins Attraktive steht die unverändert qroßartige Leistung Attila Hörbigers wie ein Fels in der Brandung gegenüber, der wie immer das Mysterium in die warmen Bereiche menschlicher Nähe reißt, klar und schön in der Melodie seiner Sprache, die Verse Hofmannsthals wie durchleuchtend mit dem Ton eines wahrhaften Mannes, der sein Leben vom Gipfel zum Abgrund ausschöpft und kein Entweichen erwägt.
Den Stunden des heimlichen Sdiauderns am Domplatz steht heuer im Landestheater Ferdinand Raimunds Verschwender“ als strahlender Anruf des Lebens und als ein Stück Offenbarung Österreichs gegenüber. Selbst Skeptiker einschließlich aller Pro-qrammatiker für die Entwicklung der Salzhurger Festspiele, meistens am falschen Ende Besorgte, werden verstummt sein. Wie nahe sind sich der Jedermann und der Verschwender, fast eine Gestalt, wenn man sie tiefer begreift. Dort das geistliche Spiel, dort der Tod, die Symbolgestalten, hier das pul-sierende Leben, der Bettler, das Handwerk, die handfeste Frau und'die barocke Märchen-qestalt der Fee. Die Inszenierung Ernst Lothars und die Darstellung selbst hat auch den Einwand beseitigt, daß das Stück zu heimatgebunden, zu spezifisch österreichisch sei, also wenig brauchbar für ein Publikum aus aller Welt. Es hat sich jedoch in Salzburg am Erfolg und der weit über das übliche Maß iiinausgehenden Beifallsbezeugung erwiesen, daß Raimund weit mehr als ein Wiener oder österreichischer Lokaldichter ist, daß er ein Stück des abendländischen Barock einerseits und der Volksseele andererseits überhaupt verkörpert. Die echten Herzenstöne seiner Figuren sind gewissermaßen international, ihre Gefühlswelt ist nicht an Dialekte und Lokalkolorite gebunden, sondern nur im Menschlichen unlösbar eingewurzelt.
Der Dreiklang des Stückes, mit dem Übergewicht der überirdischen Welt, des Märchenhaften im ersten Akt, mit der Betonung des festlichen Glanzes, der Lebensfülle im zweiten und der Idyllik des dritten Aktes Ist ausgezeichnet gewahrt und scharf gegeneinander gesetzt. Am stärksten melden sich Einwände noch beim zweiten Akt, der an Dauer und eigenen Einfällen weit über Raimundsche Intentionen hinauswächst und zuweilen den sonst so geschlossenen Rahmen sprengt. Hier hat die amerikanische Lehrzeit Ernst Lothars sein österreichisches Herz ein wenig verdeckt, für den Äußeren Erfolg gewiß auch entscheidend. Aber es ist ein Stück jener eingangs beschworenen Wandlung darin zu spüren, die Salzburgs Idee zu verdunkeln beginnt. Die Lebenshille wird nicht zum Symbol, sondern entartet zur funkelnden Revue, die breit und großartig mit tänzerischen und mimischen Elementen und mit verschwenderischem Prunk an Ausstattung und Kostümen den Augen gibt, was sie dem Ohr und Herzen entzieht. Dennoch bleibt der Einwand am Rande und vermag das Verdienst Lothars nicht zu schmälern, hier der Welt ein Stück österreichischer Kunst beschworen zu haben, das aus den einfältigsten, rührendsten und reinsten Quellen unseres Volkstums und unserer menschlichen Art fließt. Clemens Holzmeisters Debüt als Bühnenbildner verzaubert jede Szene mit vollendeter Einfühlung und weiträumiger Schönheit, in der jede Einzelheit so wohlgelungen erscheint wie das Ganze.
Die schauspielerische Besetzung ließ kaum Wünsche offen. Die große Überraschung des Abends war der Valentin Josef Meinrads. Durch ihn erhielt das Spiel jene menschliche Verklärung, jene Nahrhaftigkeit und Anmut, die Raimunds eigentlichen Zauber bis in die letzte mimische Möglichkeit ausschöpfte. So oft dieser große, blonde Junge mit dem Kinderlächeln, den hilflosen Augen, der fast verschüchterten Stimme Und der aus echter Herzenswärme kommenden Fröhlichkeit die Szene betrat, war man in dem Netz dieses Märchens zwischen Himmel und Wirklichkeit verstrickt. Raimund hat hier einen Volksschauspieler gefunden, der zudem ein fast modernes Fluidum ausstrahlt, dessen Gestalt ganz aktuell geworden ist und uns das Märchen vom treuen Diener eines guten, arm gewordenen Herrn zum Erlebnis des eigenen Alltags macht. Ihm zur Seite steht federnd, spitzbübisch, derb und fröhlich, voll übersprühenden Temperaments und einer reizenden, lebenshungrigen Sinnlichkeit die Rosa Inge Konradis, als Widerpart zur unbeholfenen Schlacksigkeit ihres Valentins eine köstliche Leistung; sie haucht sichtbar dem ganzen übrigen Ensemble etwas vom Feueratem der Jugend ein, die das Merkmal der ganzen Aufführung war. Hans Jaray als Verschwender hatte diese Herzenstöne nicht, er war der elegante, allzu glatte Bonvivant, dem man die Güte weniger glaubte als die Verschwendungssucht. Dafür gab Leopold Rudolf als sein Kammerdiener ein Kabinettstück eines schurkisch-dreisten Domestiken mit fast mephistophelischen Zügen und Shakespearescher Komö-diantenhaftigkeit. Oscar Karlweis entzückte als Chevalier Dumont mit echt gallischer Uber-spitzheit und dabei mit wienerischen Untertönen, die an der Seine doch nicht möglich sind.
Das Trio der Theaterabende der Salzburger Festspiele schließt mit dem furiosen Allegretto von Shakespeares „W a s ihr wollt“. Schon vor zwanzig Jahren hat Max Reinhardt den Versuch gemacht, diese Meisterkomödie der Weltliteratur in die Salzburger Festspiele einzubauen. Wie sehr Shakespeare gerade mit diesem Stüde in den Rahmen Salzburgs paßt, hat das Burgtheaterensemble unter der Regieführung Josef Gielans überzeugend bewiesen. Es war ein Abend echtesten Theaters, wie es heute in Mitteleuropa kaum anderswo in solcher Vollendung aller Mitteln dargeboten werden kann. Man möchte es kaum glauben, daß mehr als 350 Jahre verflossen sind, seit Shakespeare dieses blühende, lyrische Bühnenwerk, das alle Elemente des Schauspiels mit spielerischer Virtuosität vereinigt, schuf. Josef Gielens Verdienst ist es, die berauschende Schönheit der Sprache in den Mittelpunkt gestellt zu haben; von allem Beiwerk frei, entfaltet sie sich in schauspielerischen Höchstleistungen zu einer fast musikgewordenen Tiefe und Weite. Vielleicht ist in einigen Szenen das Komödienhafte zugunsten des Possenhaften zurückgedrängt, aber in der überschäumenden Kraft der Shakespeareschen Intentionen nimmt man solche Überspitzung ohne Groll hin. Die Spitzenleistung des Abends bot Werner Krauss als Malvolio, den eitlen, dummdreisten Alten mit dem Johannistrieb. Seine Darstellung umfaßt alle Züge des Karikierenden, Grotesken, Komischen bis in die Nähe des Ergreifenden. Ewald Baiser gelingt im Junker Tobias eine vollsaftige Fal-staffigur, deren Gegenstück, der Junker von Bleichenwang, durch Josef Meinrad ine zwerchfellerschütternde, sich an Einfällen überpurzelnde Darstellung erfährt. Nach dem Valentin im Verschwender erweist Meinrad hier dde Vielseitigkeit und UnerschöpfMchkeit seine Naturtalents. Der Narr Albin Skodas ist ganz überstrahlt von der federnden Hintergründigkeit lächelnd dargebotener Weisheit, überschattet von Melancholie, und hat dämonische Züge, die des Narren Dasein in die Wirklichkeit des einzig wahren Lebens heben. Susi Nicoletti schenkt der deutschen Bühne eine neue, köstliche Viola, Alma Seidlers Kammermädchen sprüht von Temperament und Lehensfreude. Stephan Hlawas Bühnenbilder atmen die zauberhafte Seligkeit des Südens, mehr' stilisiert als gegenständlich. Die Musik nach Motiven aus der elisabethanischen Zeit schrieb Bernhard Paumgartner mit Einfühlungsvermögen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!