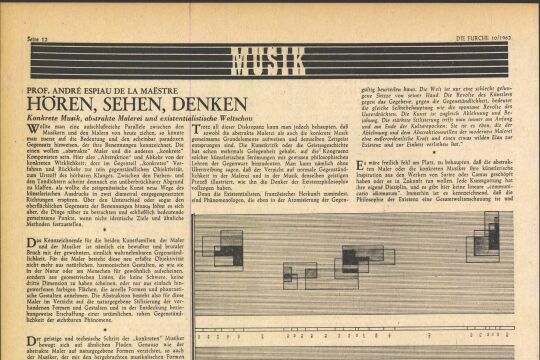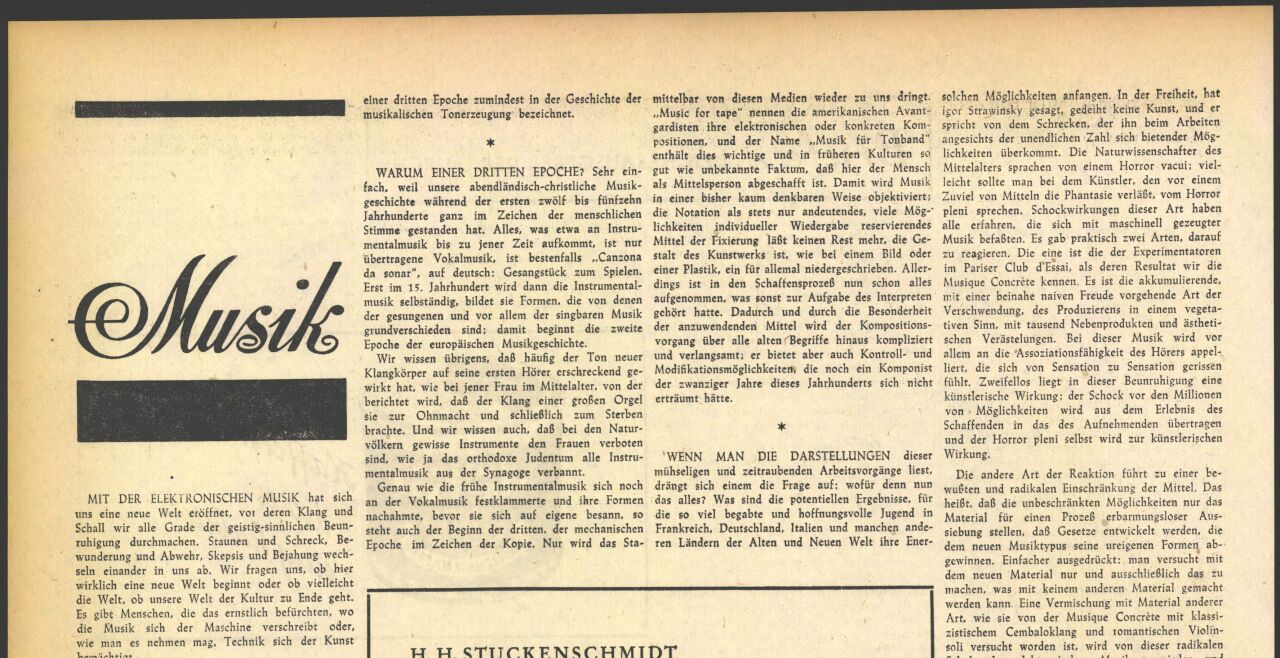
MIT DER ELEKTRONISCHEN MUSIK hat sich uns eine neue Welt eröffnet, vot deren Klang und Schall wir alle Grade der geistig-sinnlichen Beunruhigung durchmachen. Staunen und Schreck, Bewunderung und Abwehr, Skepsis und Bejahung wechseln einander in uns ab. Wir fragen uns, ob hier wirklich eine neue Welt beginnt oder ob vielleicht die Welt, ob unsere Welt der Kultur zu Ende geht. Es gibt Menschen, die das ernstlich befürchten, wo die Musik sich der Maschine verschreibt oder, wie man es nehmen mag, Technik sich der Kunst bemächtigt.
In Hermann Hesses Fabulierbuch steht die ironische Erzählung vom Doktor Faust, der mit Doktor Eisenbart zusammen beim Pokal sitzt und mittels eines mephistophelischen Radiogeräts in die Zukunft lauscht. „Aber was mich stutzig macht“, sagt er, „das sind jene anderen Töne, jene Schreie, die weder .von Menschenstimmen noch von Musikinstrumenten erzeugt sein können. Sie klingen, so scheint mir, absolut teuflisch. Es können nur Dämonen sein, die solche Töne ausstoßen.“ Hesses Vision von 1925 bekundet den Schock, den der elektrisch oder überhaupt der maschinell gezeugte Ton bei erster Begegnung immer auslöst. Sie ist die Reaktion eines Dichters, in dessen romantischer Phantasie auch die sinnlichen Eindrücke das Stigma des Göttlichen oder des Teuflischen tragen.
Was aber an dieser Vision auffällt, das ist die Richtigkeit der Beobachtung. Schreie, die weder von Menschenstiminen noch von Musikinstrumenten erzeugt sein können. Wahrscheinlich ist es ein Effekt, der damals, in den Anfängen des Rundfunks, durch Rückkopplung oder einfach durch das Aufsuchen einer Welle zustande kam, ein Zufalls- und Notprodukt, das man ohne Absicht herbeiführte und, wenn es sich einstellte, möglichst rasch wieder loszuwerden suchte. Tatsächlich stammen die ersten schüchternen Versuche einer elektrischen Musik aus der Beobachtung solcher Störungen und akustischer Zufälle und Abfälle.
ALLERDINGS HAT SIE AUCH EINE VORGESCHICHTE, die sogar in die Anfänge unseres Jahrhunderts zurückreicht. 1906 lernte Fcrruccio Busoni in den Vereinigten Staaten eine Maschinenorgel kennen, die von ihrem Erfinder, Dr. Thaddäus Cahill, „Dynamophone“ genannt wurde. Das Instrument, dem man die Produktion wissenschaftlich vollkommener Musik nachrühmte, wurde damals für Drahtfunkkonzerte verwendet. Busoni erkannte in ihm einen Klangkörper zur Erzeugung von Drittel- und Sechsteltönen, warnte aber gleichzeitig: „Nur ein gewissenhaftes und langes Experimentieren, eine fortgesetzte Erziehung des Ohres werden dieses ungewohnte Material einer heranwachsenden Generation und der Kunst gefügig machen;“
Es bedurfte tatsächlich noch der Arbeiten einer Generation, um zu selbständigen künstlerischen Ergebnissen zu kommen. Die Zwischen Stationen zeigen so bizarre Erscheinungen wie die Aetherwellenmusik ^ des russischen Ingenieurs Leon Theremin, der in den zwanziger Jahren mit seinen Apparaten durch die Konzertsäle Europas zog und ihnen mit den mes-merisch-beschwörenden Gebärden eines Hypnotiseurs klagende Solomelodien entlockte. Mit dem Sphäro-phon von Jörg Mager, den Ondes Martenot von Maurice Martenot, dem Trautonium von Friedrich Trautwein und seiner mehrstimmigen Vervollkommnung durch Oskar Sala sind die wichtigsten Etappen bis zum heutigen Elektronen-Monochord markiert. So verschieden diese Instrumente in ihren technischen und physikalischen Grundlagen sind, so wenig ihre Erfinder sich in der künstlerischen Zielsetzung gleichen, haben sie doch eines gemeinsam: sie produzieren Töne auf eine völlig neue Weise, d. h. anders, als es unsere Chordophone, Aerophone, Idiophone und Membranophone, also die uns aus der Kammer-imd Orchestermusik aller Zeiten und Kulturen vertrauten Instrumente getan haben.
Bei den frühen Versuchen mit diesen verschiedenen Klangapparaturen hat man viel Energie darauf verwendet, die bekannten Klangfarben möglichst getreu oder in „wissenschaftlich vollkommener Weise“ nachzuahmen. Bis man einsah, daß eben ein Geigenoder Oboenton doch am künstlerisch brauchbarsten durch eine wirkliche Geige oder Oboe produziert wird. Dann begann man nach Uebergangsfarben zu suchen, und schließlich betrat man entschlossen die neue Welt von nie gehörtem Klang, die den Beginn einer dritten Epoche zumindest in der Geschichte der musikalischen Tonerzeugung bezeichnet.
WARUM EINER DRITTEN EPOCHE? Sehr einfach, weil unsere abendländisch-christliche Musikgeschichte während der ersten zwölf bis fünfzehn Jahrhunderte ganz im Zeichen der menschlichen Stimme gestanden hat. Alles, was etwa an Instrumentalmusik bis zu jener Zeit aufkommt, ist nur übertragene Vokalmusik, ist bestenfalls „Canzona da sonar“, auf deutsch: Gesangstück zum Spielen. Erst im 15. Jahrhundert wird dann die Instrumentalmusik selbständig, bildet sie Formen, die von denen der gesungenen und vor allem der singbaren Musik grundverschieden sind; damit beginnt die zweite Epoche der europäischen Musikgeschichte.
Wir wissen übrigens, daß häufig der Ton neuer Klangkörper auf seine ersten Hörer erschreckend gewirkt hat, wie bei jener Frau im Mittelalter, von der berichtet wird, daß der Klang einer großen Orgel sie zur Ohnmacht und schließlich zum Sterben brachte. Und wir wissen auch, daß bei den Naturvölkern gewisse Instrumente den Frauen verboten sind, wie ja das orthodoxe Judentum alle Instrumentalmusik aus der Synagoge verbannt.
Genau wie die frühe Instrumentalmusik sich noch an der Vokalmusik festklammerte und ihre Formen nachahmte, bevor sie sich auf eigene besann, so steht auch der Beginn der dritten, der mechanischen Epoche im Zeichen der Kopie. Nur wird das Stadium der Besinnung auf die autonomen Aufgaben sehr viel schneller erreicht.
WENN WIR DAS WORT „SCHALL“ als Dachbegriff für alles nehmen, was als Schwankung des Luftdrucks und somit als Toneindruck dem Hörzentrum im menschlichen Hirn zugeführt werden kann, so haben wir gleichzeitig einen Ansatzpunkt für jede denkbare musikalische Wirkung. Die elektronischen Untersuchungen haben das schwer übersehbare und weite Gebiet in fünf Kategorien aufgeteilt und eine neue Terminologie dafür geschaffen. Ton ist obertonfreies, sozusagen chemisch reines Element der Akustik; er ist nicht mehr teilbar und kommt praktisch nur als sogenannter Sinuston vor. Klang deckt sich ungefähr mit dem. was wir bisher unter Ton verstanden haben; es ist der obertonhaltige Ton, wie wir ihn auf Saiten- und Blasinstrumenten erzeugen, dessen ganzes Konglomerat aber auf eine einzige Naturtonreihe zurückzuführen ist. Was wir bisher Akkord nannten, die Addition mehrerer solcher Klänge, wird nun Zusammenklang genannt. Nur der Begriff Geräusch ist unverändert und bezeichnet einen eigentlich amorphen Schalleindruck. Dazwischen, abseits von diesen Kategorien, gibt es noch Werte, die als Tongemisch bezeichnet werden; es sind Schälle mit nichtharmonischen Elementen, Zusammensetzungen von Tönen verschiedener Naturtonreihen. Bei Glocken, Röhren, Metallstäben und dergleichen finden wir solche Tongemische. — Die neue elektronische Musik bedient sich heute in erster Linie der Sinustöne, d. h. der einfachsten, und der Tongemische, d. h. der außer dem Geräusch kompliziertesten dieser Kategorien.
Diese Musik, die uns da aus Lautsprechern zufließt, ungreifbar und allgegenwärtig, mit allen Möglichkeiten einer erweiterten Stereophonie — sie ist nicht von Menschenkehlen gesungen, nicht von Menschenhänden gespielt. Sie bedarf des Reproduktionsprozesses nicht mehr, da sie dem Magnetophonband oder der Schallplatte oder dem Stille-Draht — je nachdem, welches Verfahren sich praktisch empfahl — unmittelbar aufgezeichnet wurde und ebenso unmiltelbar von diesen Medien wieder zu uns dringt. „Music for tape“ nennen die amerikanischen Avantgardisten ihre elektronischen oder konkreten Kompositionen, und der Name „Musik für Tonband“ enthält dies wichtige und in früheren Kulturen so gut wie unbekannte Faktum, daß hier der Mensch als Mittelsperson abgeschafft ist. Damit wird Musik in einer bisher kaum denkbaren Weise objektiviert; die Notation als stets nur andeutendes, viele Mög-' lichkeiten individueller Wiedergabe reservierendes Mittel der Fixierung läßt keinen Rest mehr, die Gestalt des Kunstwerks ist, wie bei einem Bild oder einer Plastik, ein für allemal niedergeschrieben. Allerdings ist in den Schaffensprozeß nun schon alles aufgenommen, was sonst zur Aufgabe des Interpreten gehört hatte. Dadurch und durch die Besonderheit der anzuwendenden Mittel wird der Kompositionsvorgang über alle alten'Begriffe hinaus kompliziert und verlangsamt; er bietet aber auch Kontroll- und Modifikationsmöglichkeitert, die noch ein Komponist der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts sich nicht erträumt hätte.
'WENN MAN DIE DARSTELLUNGEN dieser mühseligen und zeitraubenden Arbeitsvorgänge liest, drängt sich einem die Frage auf: wofür denn nun das alles? Was sind die potentiellen Ergebnisse, für die so viel begabte und hoffnungsvolle lugend in Frankreich, Deutschland, Italien und manchen anderen Ländern der Alten und Neuen Welt ihre Energien opfert? Lohnen sie diesen einzigartigen Aufwand an Zeit, Phantasie und Kunst?
Die Antwort läutet romantischer als man vermuten mag: ja, die Ergebnisse sind schlechthin unbeschränkt, man kann ihnen überhaupt keine praktischen Grenzen setzen. Die Totalität aller denkbaren Erscheinungen im Bereich des Hörbaren hat sich, zum erstenmal in der Geschichte der Musik, dem Menschen eröffnet. Unbegrenzt sind schon die Möglichkeiten der Tonteilung, und wenn noch in den zwanziger Jahren die Komponisten aus rein praktischen Gründen der Wiedergabe zögerten, Drittel-, Viertel-und Sechsteltöne in ihre Partituren zu schreiben, wenn selbst Alois Häba in Prag sich mit einem sehr umständlichen bichromatischen Klavier und schlecht intonierenden Streich- und Blasinstrumenten für seine Vierteltonmusik begnügen mußte, so ist es heute möglich, jedes Intervall sofort und mit mathematischer Genauigkeit tönen zu lassen. An die Stelle von wenigen brauchbaren Naturtönen und willkürlich ausgewählten Tonleitern tritt die Fülle der gleitenden Skala mit unendlich vielen Stufen, wie sie nur im Portamento und Glissando der Stimme und einiger Instrumente bisher dargestellt werden konnte.
Ebenso unbegrenzt ist die Menge der Klangfarben; auch hier wird eine Kunst der Uebergänge gesichert, deren Gesamtheit das Beispiel des Prismas aus dem Bereich des Optischen beschwört. Schließlich hören auch die mechanischen Begrenzungen der Geschwindigkeit auf, und die Dynamik läßt sich vom äußersten Pianissimo bis zu donnerndem, brüllendem Fortissimo beliebig und in beliebiger Schnelligkeit steigern. Die Musik tritt damit aus dem Reich des Menschen und seiner tausendfachen physischen Hemmungen in das phantastische Reich der technischen Allmacht. Olivier Messiaen, praktisch wie theoretisch gleichermaßen erfahren in utopischen Klangwelten, hat die Situation mit den Worten formuliert: „La musique a maintenant atteint son pla-fond“. Die Musik — besser läßt das Bild sich deutsch nicht ausdrücken — hat jetzt den Gipfel ihrer Möglichkeiten erreicht.
SEHEN WIR ZU, WAS DIE KOMPONISTEN mit selchen Möglichkeiten anfangen. In der Freiheit, hat igor Strawinsky gesagt, gedeiht keine Kunst, und er spricht von dem Schrecken, der ihn beim Arbeiten angesichts der unendlichen Zahl sich bietender Möglichkeiten überkommt. Die Naturwissenschafter des Mittelalters sprachen von einem Horror vacui; vielleicht sollte man bei dem Künstler, den vor einem Zuviel von Mitteln die Phantasie verläßt, vom Horror pleni sprechen. Schockwirkungen dieser Art haben alle erfahren, die sich mit maschinell gezeugter Musik befaßten. Es gab praktisch zwei Arten, darauf zu reagieren. Die eine ist die der Experimentatoren im Pariser Club d'Essai, als deren Resultat wir die Musique Concrete kennen. Es ist die akkumulierende, mit einer beinahe naiven Freude vorgehende Art der Verschwendung, des Produzierens in einem vegetativen Sinn, mit tausend Nebenprodukten und ästhetischen Verästelungen. Bei dieser Musik wird vor allem an die Assoziationsfähigkeit des Hörers appelliert, die sich von Sensation zu Sensation gerissen fühlt. Zweifellos liegt in dieser Beunruhigung eine künstlerische Wirkung; der Schock vor den Millionen von Möglichkeiten wird aus dem Erlebnis des Schaffenden in das des Aufnehmenden übertragen und der Horror pleni selbst wird zur künstlerischen Wirkung.
Die andere Art der Reaktion führt zu einer bewußten und radikalen Einschränkung der Mittel. Das heißt, daß die unbeschränkten Möglichkeiten nur das Material für einen Prozeß erbarmungsloser Aussiebung stellen, daß Gesetze entwickelt werden, die dem neuen Musiktypus seine ureigenen Formen abgewinnen. Einfacher ausgedrückt: man versucht mit dem neuen Material nur und ausschließlich das zu machen, was mit keinem anderen Material gemacht werden kann. Eine Vermischung mit Material anderer Art, wie sie von der Musique Concrete mit klassizistischem Cembaloklang und romantischen Violih-soli versucht worden ist, wird von dieser radikalen Schule der elektronischen Musik vermieden und theoretisch bekämpft.
UNTER DEN JUNGEN KOMPONISTEN, die sich um eine autonome Elektronenmusik bemühen, ist Karlheinz Stockhausen mehrfach als Wortführer hervorgetreten. Auch er spricht in einem französisch veröffentlichten Aufsatz vom „composer avec des timbres“, also vom Komponieren in Klangfarben. Darunter ist nun allerdings etwas sehr Konkretes zu verstehen, nämlich die Klangfarbe, wie sie Schönbetg in dem dritten seiner fünf Orchesterstücke opus 16 frei macht und als neues Bauelement am Schluß seiner Harmonielehre anführt. Die Tendenz aller weit vorgetriebenen modernen Musik, in festgefügten und — wie Ernst Krenek es nennt — in total prädeterminierten Formen abzulaufen, sieht ihre Erfüllung m den mechanischen und elektronischen Verfahren. Wie im Kanon der Renaissancemusik und in den isorhythmischen Prozeduren der mittelalterlichen französischen Meister die Form eines ganzen Werks a priori festgelegt ist, wie rhythmische und melodische Gestalt zu ganz bestimmten Strukturen und Architekturen sich vermählen, so sind hier Tonfolge, Rhythmus, Klangstärke und Farbe einem Prozeß der Abfolge unterworfen. Die Ergebnisse sind außerordentlich verwickelt und bedürfen, um verstanden zu werden, intensiver geistiger Mitarbeit beim Hörer. Aber das ist schließlich eine Eigenschaft, die sie mit aller hochpolyphonen Musik gemeinsam haben.
DER WEG ZUM ERLEBNIS SOLCHER MUSIK führt immer über die Assoziation. Denn sie tritt dem Menschen als etwas Unvertrautes, als nie gehörter Klang entgegen. Sie entspricht genau dem. was der Physiker Werner Heisenberg als ..die vom Menschen völlig verwandelte Welt“ kennzeichnet. Und ebenso wie, nach Heisenberg, in den Naturwissenschaften nicht mehr die Natur an sich Gegenstand der Forschung ist, sondern die der menschlichen Fragestellung ausgesetzte Natur, so ist auch unser Musikbild ein Bild unserer Beziehungen zur Musik. Die Elektronenmusik hat keine Vorbilder in der Natur; die konkrete Musik benutzt solche Vorbilder nur als Rohstoff, um sie bis zur Unkenntlichkeit zu deformieren. So ist die unvermeidliche psychologische Wirkung ein Akt der Aufsuchung von Analogien in anderen Bereichen. Die Phantasie des Hörenden flüchtet in andere Sinnenbezirke. Sie tastet traumhaft ihre Erfahrungsräume nach ähnlichen Wirkimgen ab. Und so sind es fast immer optische oder haptische Empfindungsketten, Erinnerungen an sichtbare oder fühlbare Erscheinungen, die sich einstellen, ja geradezu aufdrängen. Spiralenklänge, das Singen von Metallen, der Ton von kristallinischen Symmetrien, die Schreie hybrid gekreuzter Lebewesen, tönende Projektile, schwellende und schrumpfende Organismen, wie sie der Zeitraffer des Films anschaulich gemacht hat, und tausend mögliche Visionen dazu.
Je häufiger wir aber diesen Klangphänomenen begegnen, desto stärker fesseln sie uns. Aus der anfänglichen Abwehr, aus dem negativen Erlebnis, schält sich Neugier und Interesse heraus, das Erlebnis wird positiv, die nie gehörten Klänge, nunmehr oft gehörte, verlieren den Charakter der Bedrohung. Wir erkennen sie als künstlerische Bestandteile unserer Welt, dieser technisierten Welt, die unser Leben in allen seinen Teilen verwandelt und neu gestaltet hat. Schon hat sich die wahrhaft unerhörte Materie zu künstlerischen Formen prägen lassen, schon ist eine junge Generation am Werk, die Formen zu großen Kunstwerken auszubauen. Wir wollen dieser lugend vertrauen; das Schöne, sagt Baudelaire, ist immer bizarr. Vielleicht wird bald die Bizarrerie dieser Klänge uns als eine neue Schönheit aufleuchten, als Musik aus dem Geist einer Zeit, die den Menschen gelehrt hat, sich vogelgleich in dröhnenden Maschinen zu den Wolken zu erheben und zwischen Himmel und Erde zu, schweben.