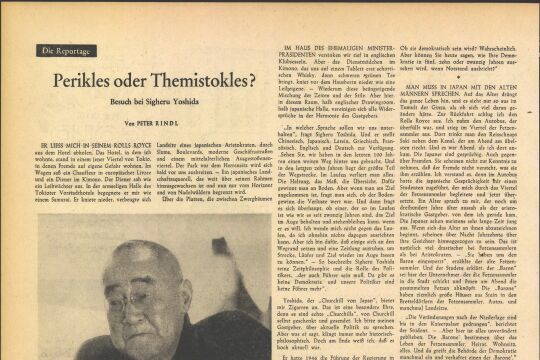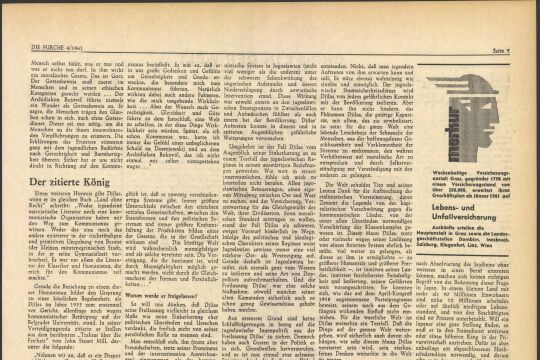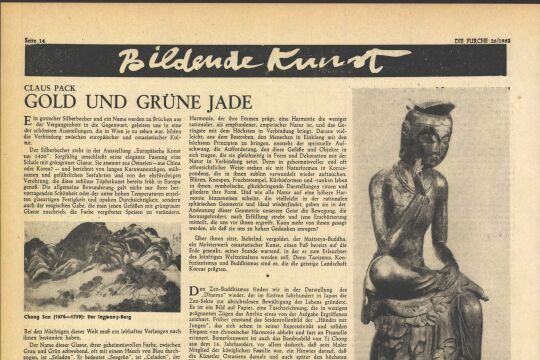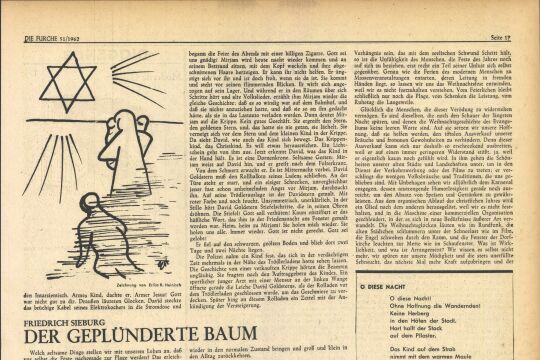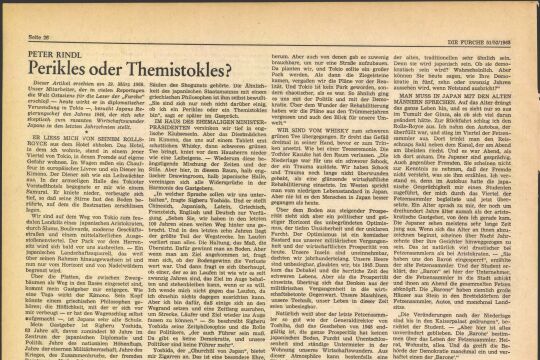Die starke Orientierung der Japaner an der Gemeinschaft ist für westliche Beobachter oft schwer zu verstehen. Die damit verbundene stoische Ruhe hat religiöse Wurzeln.
Dramen sind anders in Japan. Das kann man beim Noh-Theater miterleben, wenn sich die Helden sehr langsam über die Bühne bewegen und in konzentrierten Gesten weinen, kämpfen oder der Toten gedenken. Die Kette von Katastrophen, die Japan heimsucht, ist jedoch bittere Wirklichkeit. Dass sich Japaner trotzdem scheinbar ruhig und unbewegt zeigen, verwundert viele Nicht-Japaner. Via Fernsehen oder Youtube erscheinen die Menschen, die die zerstörten Städte nach Angehörigen absuchen wie Akteure in einer Guckkastenbühne. Manche Betrachter mögen das Pathos vermissen, das sie von den großen Bühnen gewöhnt sind. Leicht übersehen und überhören sie die feinen Signale der Verzweiflung in den Gesichtern, im Klang der Stimme, die auf eine Kommunikation im "Zwischen“ abzielt, in einem Beziehungsraum. Weinen und Lachen ist nicht laut und dramatisch, sondern leise und verhalten. Die Schwester, die ihren Bruder sucht, die Kinder, die ihre Eltern ertrunken finden, weinen leise, ohne große Gesten; weinen in diesem Zwischenraum, der sich in Beziehungen eröffnet.
Der Ort der Gefühle
Das klingt abstrakt, doch für Japaner sind die Beziehungsnetze zwischen Menschen und die Nuancen der Kommunikation in diesem Beziehungsraum entscheidend. Hier ist der Ort der Gefühle - das erklärte mir ein japanischer Freund, von dem ich mich herzlich verabschieden wollte, und zeigte mir, wie sich Menschen, die einander zugetan sind, vor einander verneigen. Mit Kühle hat das nichts zu tun, eher mit einem Gespür für ki, die Lebenskraft, das Atmosphärische zwischen den Menschen. Dieses Wort ki taucht in vielen japanischen Ausdrücken auf. Die Begrüßung genki desuka? wird mit "wie geht’s?“ übersetzt. Doch tatsächlich heißt es: "Wie geht es Ihrem ki?“ Ki prägt eine Situation: ki ga kiku meint: erspüren, was in einer bestimmten Situation angemessen und wichtig ist. Und deswegen, weil ki die zwischenmenschlichen Atmosphären so wichtig sind, nimmt man Rücksicht - man will die anderen nicht belästigen. Zudem: Wenn man spürt, was das Gegenüber bewegt, braucht es nicht viele Worte.
Das ist natürlich ein Verhaltensideal, das sich aus Buddhismus, Shintoismus und Konfuzianismus nährt. Nach buddhistischer Lehre sind Menschen und Welt in einem dichten Beziehungsgeflecht verbunden: ein Selbst gibt es nur in Beziehung zu anderen. Der Buddhismus wurde 594 n. Chr. durch Prinz Shotoku zur Staatsreligion erhoben, als Mittel zur sozialen Befriedung und zur Festigung der zentralen Macht des Kaisers. Der Shinto war eine Familien- und Dorfreligion, wurde aber im 19. Jahrhundert zur Staatsreligion. Neben einer starken Naturfrömmigkeit ist konfuzianistischer Einfluss spürbar - etwa die Betonung der Loyalität dem Staat gegenüber oder der Pietät gegenüber der Familie. Die Menschen sind eingebunden in den Kosmos, dessen Harmonie erhalten bleiben soll. Alle können an ihrem sozialen Ort dazu beitragen.
Bewusstsein gegenseitiger Abhängigkeit
So fuhren etwa Feuerwehrleute in Autos so lange als nur möglich durch die Straßen, um Bewohner zu warnen. Dabei wurden sie vom Tsunami weggewischt. Die Hunderttausende, die ihr Heim verloren haben oder wegen Strahlungsgefahr evakuiert wurden und in Notunterkünften dicht gedrängt miteinander leben, bewegen sich mit großer Rücksicht. Auch die Millionen, die in Tokio auf U-Bahnen warten. Im Bewusstsein, in gegenseitiger Abhängigkeit zu leben, versuchen die Menschen, wechselseitig auf Wünsche einzugehen. Das erzeugt subtile bis heftige Spannungen, enorme soziale Kontrolle und scharfe Ausgrenzungen für jene, die nicht dazugehören. Dass in Extremsituationen jemand überraschend explodiert und gewalttätig wird, gehört zu den Schattenseiten dieser Kultur der Gegenseitigkeit.
Der starke Gruppenbezug in der japanischen Gesellschaft ist für Europäer überraschend und wurde oft abgewertet. Doch haben in Japan die klimatischen und ökonomischen Bedingungen diese gegenseitige Unterstützung gefördert. Das japanische Volk hat durch Jahrhunderte vor allem von Fischfang und Reisbau gelebt. Beides ist arbeitsintensiv und wurde als Gruppenarbeit durchgeführt. Das hat die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt zwischen den Menschen kulturell gestärkt. Dörfliche Solidarität beinhaltet, dass sich alle an Erhaltungsarbeiten an Straßen und Wegen beteiligen; dass Kaufleute einander nicht konkurrenzieren, sondern ihre Waren aufeinander bezogen anbieten, sodass alle profitieren. Symbolisch zeigt sich das etwa beim O-Bon-Fest, dem Totenfest mitten im Sommer. An rituellen Rundtänzen nehmen möglichst alle Dorfbewohner teil, aber auch Verwandte, die zu diesem Anlass aus der Stadt kommen - und auch die Toten, eingeladen von der Familien und der Dorfgemeinschaft. Das macht verständlich, warum Plünderungen selbst in der gegenwärtigen Krisensituation ausgeschlossen sind.
Um die scheinbar stoische Haltung der Japaner verstehen zu können, darf man jedoch nicht nur auf ihre religiöse und ethische Tiefenkultur blicken. Bis Ende des Zweiten Weltkriegs war Japan so arm, dass viele auswanderten, um anderswo ihr Glück zu suchen. Die meisten Japaner, die heute in den USA, in Brasilien oder Peru leben, sind Nachkommen jener Auswanderer, die nicht "mit einem Zahnstocher im Mund noch lächeln“ wollten - eine Redewendung, die ausdrückte, dass man selbst mit einem leeren Magen weder Fassung noch Selbstbeherrschung verlieren sollte. Diese Bescheidenheit und Zurückhaltung hat den Charakter der japanischen Kultur geprägt, auch wenn die Konsumkultur nach 1945 vieles verändert hat. In Notfällen wie diesem kann man darauf zurückkommen - so sagte Premierminister Naoto Kan in einer Ansprache an die Japaner: Wenn die Nation zusammenhält, werden wir diese Krise meistern.
* Die Autorin ist Religionsjournalistin beim ORF-Hörfunk
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!