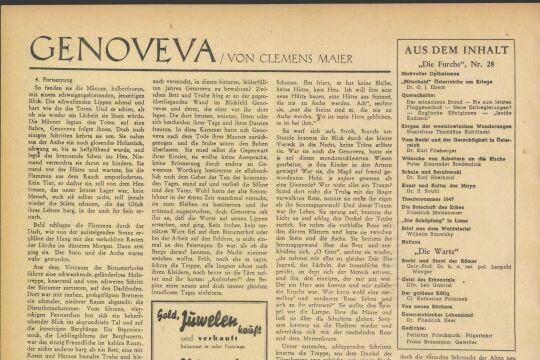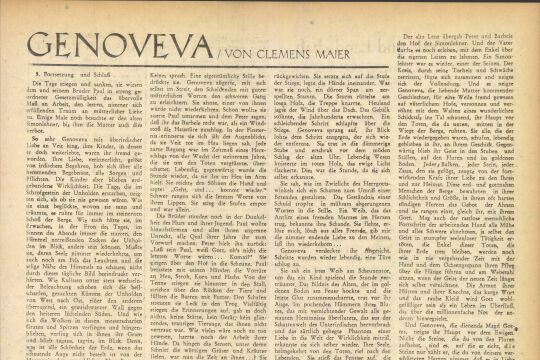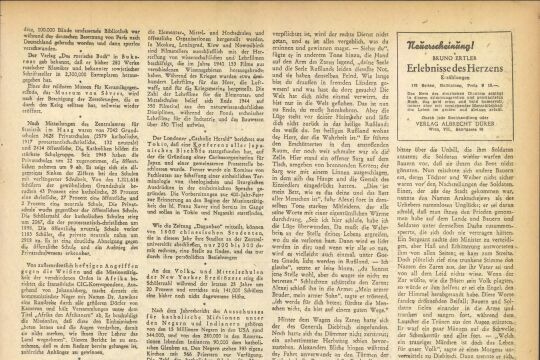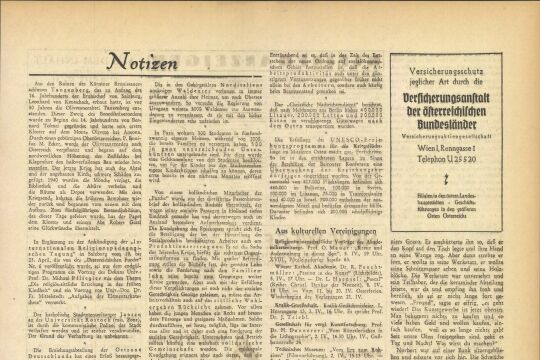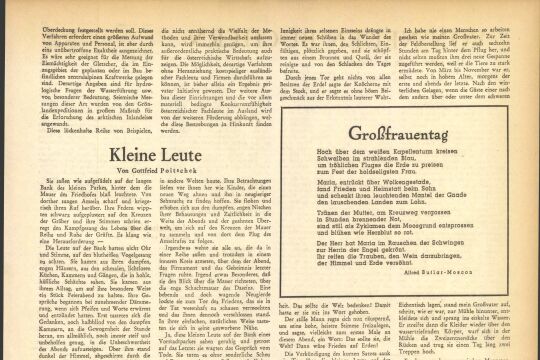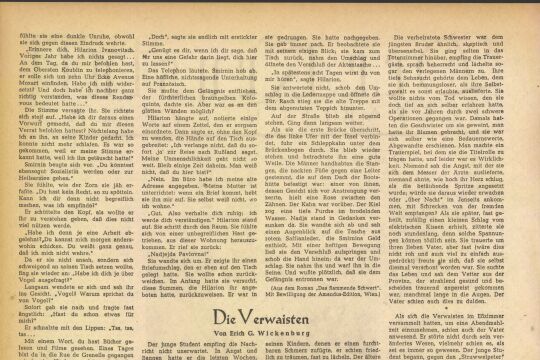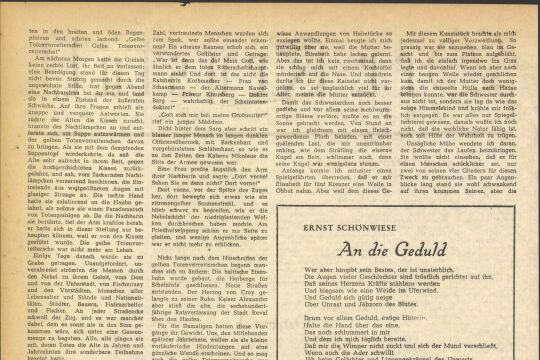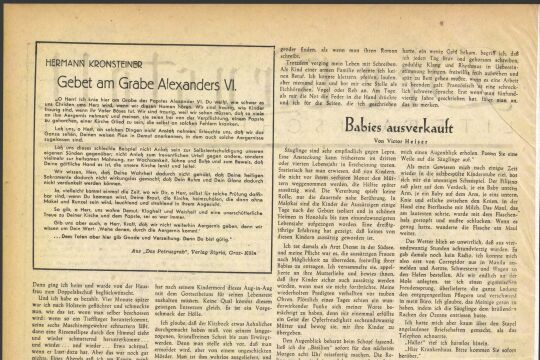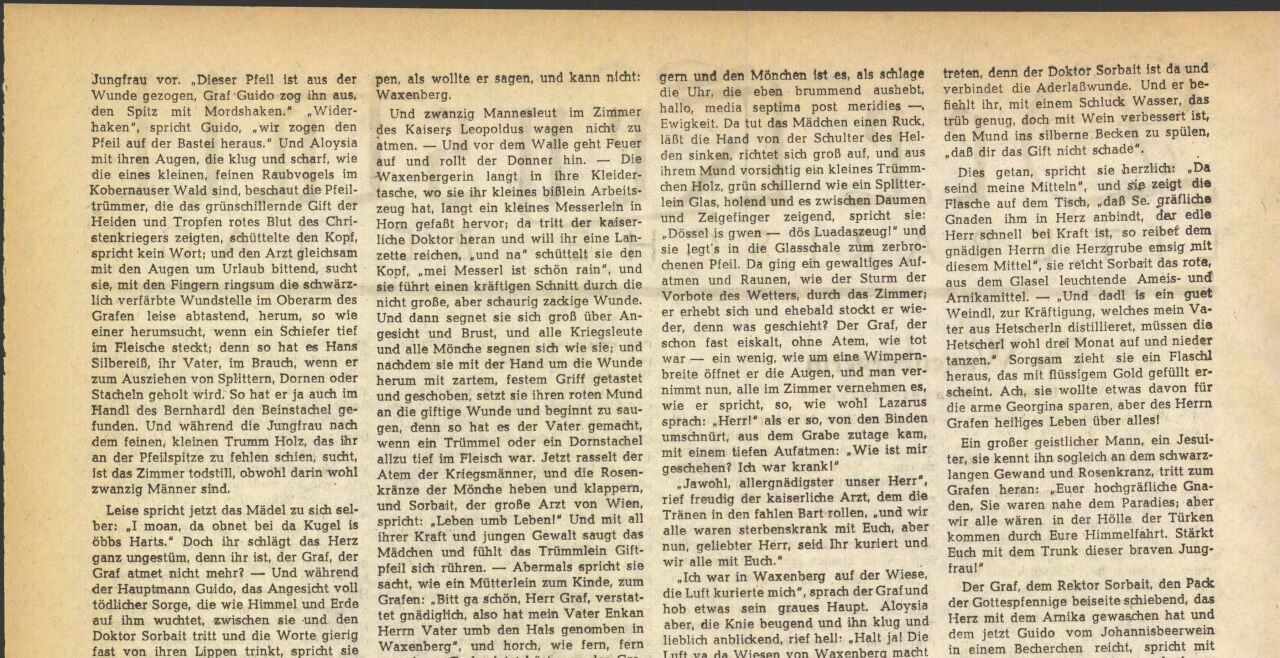
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Verlobung von Saint-Malô
Es war im Lazarett zu Saint-Malô, mitten im letzten Krieg, als mir der Tod zum ersten Male in freundlicher Gestalt erschien. Vierzehn Tage lagen Stephan und ich schon beisammen, verliebten uns wechselweise in Schwester Claudia und schauten morgens, mittags und abends übers Meer hinüber auf das Kap: in der ersten Frühe von der sanften Dichte eines Schleiers, unter der Abendröte als kräftige Silhouette, untertags aber als dunkle Felsenstirn über dem weißen Zwirnsfaden der Brandung, so leuchtete es unseren unersättlichen Augen entgegen, eine Insel der Seligen, holde Nahrung unseren Träumen. Auch Schwester Claudia sah oft hinüber, wenn sie neben uns stand, oder tat doch so, hielt ihr Haupt gegen die schöne Ferne gewandt, indes ihre niedergeschlagenen Augen auf Stephan ruhten, der seit Tagen sterben sollte und doch fröhlich zu leben fortfuhr, als vermöchte er eines Militärarztes Diagnose Lügen strafen.
Es war alles so gekommen: Drüben auf der Insel Guernsey, Londons immergrünem Tomatengarten einer heillos fernen Friedenszeit, hatte man uns unversehens zu einer erneuten Musterung befohlen und auch von der alsbaldigen Abstellung aller Gesunden in den gefürchteten Osten gesprochen. So hatte sich unsere ganze Kompanie mit allerlei alten und neuen Gebrechen gewappnet, nur Stephan, unser Benjamin, und ich waren ratlos gesund vor dem Arzt gestanden, der Gewißheit ergeben, als erste reisen zu müssen. In der Tat waren wir dann auch als die ersten gefahren, denn merkwürdig über alle Maßen, man hatte ausgerechnet uns beide für gefährlich erkrankt erklärt und Stephan ein unheilbares Herzleiden, mir eine fortgeschrittene Lungensache zubefohlen, wir hatten's, ungläubig lächelnd, nicht zu ändern vermocht. Der Leutnant hatte uns sofort abgeschrieben und auf einem alten verstaubten Zementfrachter ins Hauptlazarett nach Saint-Malô geschickt, zwei fröhliche Leichname, die auf ihre Gesundheit schworen.
Im Lazarett hatte sich meine Todkrankheit nach wenigen Untersuchungen zu dem Verdacht einer verkapselten Tuberkulose gemildert, doch mit Stephan stand es weiterhin schlimm, es konnte nicht schlimmer um ihn stehen, und die Wahrheit ist, daß der Oberarzt und Claudia Tag um Tag auf den letzten Schlag seines Vogelherzens warteten. Ich habe es bald erfahren, es war auch unschwer zu begreifen, denn seit drei Tagen hielt die Schwester an Stephans Lager Nachtwache, und er bekam, was er nur wollte: Früchte, Schokolade, auch Bohnenkaffee. Er nahm freilich wenig von diesen selten gewordenen Köstlichkeiten, er trachtete nach anderem, trachtete nach den Blicken unserer Schwester Claudia und nach einer Berührung ihrer weißen, nimmermüden Hände. Immer, wenn sie ihm seine verschiedenen Pillen zureichte, griff er scheu nach ihrer Hand und behielt sie oft, der Glückselige, die Schwester ließ sich's gefallen, ich sah treu aus dem Fenster. Je mehr es seinem Ende zuging, von dem er nichts ahnte, desto verzehrender liebte Stephan die Schwester, das stille kühle Geschöpf aus dem äußersten Norden Deutschlands, wie unter Reif erblühend. Er liebte sie mit der so anmutigen als ungestümen Innigkeit des Knaben, dem der erste Gipfel des Lebens als dessen einziger erscheint, liebte sie aber zugleich mit so heftiger Inbrunst, als wisse er von seiner letzten Frist, als müsse er sich eilen, eine letzte — ach, eine erste Erfüllung zu erfahren. Und doch ahnte er nichts, wußte er von nichts, der Tag und Nacht von seiner morgendlich leuchtenden Zukunft sprach, von dem schönen Vaterhaus am oberen Inn und einer vielgeliebten Mutter, der freilich jeden dritten Satz bei dem Namen Claudia enden ließ, ob die Schwester anwesend war oder nicht, der Schelm schloß sie unbekümmert in seine Träume ein, und sie ließ sich's lachend gefallen. Vielleicht lächelte sie nur mit den Lippen, denn oft mußten sich unsere Blicke begegnen, und dann sprachen wir uns wortlos Mut zu, daß nur keiner wanke, keiner die unsagbare Wehmut verrate, die unsere Herzen füllte... Schöne, tapfere Schwester Claudia! Sie war zwanzig Jahre alt, und die strenge Schwesterntracht erhöhte sie zur Frau, die weiße Haube, das schlichte gestreifte Kleid, wir verehrten es beide, und war es darauf angekommen in jener Zeit, wir hätten allen Künsten modischer Frauentracht leichter Hand abgeschworen. Ja, auch ich, denn auch ich hatte bald einer üppig wuchernden Neigung standzuhalten.
Am fünfzehnten Tage unseres Aufenthaltes im Lazarett von Saint-Malô geschah es dann nach einer längeren Visite des Oberarztes, bei der es nicht ohne vielerlei verlegenes Getätschel und väterlich rauhes Zureden abgegangen war, daß mich Stephan bat, ich möchte mir doch die Ohren verstopfen, er hätte mit Schwester Claudia Gewichtiges zu bereden. Meine vorsichtige Abwehr fruchtete wenig, ich mußte mich alsbald abwenden, vernahm aber doch, was ich nicht hätte hören sollen und was mir Wort für Wort unvergeßlich geblieben für alle Zeit. Stephan erklärte, zitternd in glücklicher Bangnis, seine geschwächte Stimme noch einmal erhebend, erklärte zum hundertsten Male seine Liebe und wurde zum hundertsten Male mit schwesterlich herzlicher Gebärde abgewiesen —, ja, ja, es sei doch alles gut, er allein hause in ihrem Herzen, aber nun sei es genug, jetzt hieße es sich schonen ... Oh, Stephan gedachte ganz und gar nicht, sich zu schonen, er protestierte gegen Schwester Claudias lächelnde Abwehr mit flammender Rede, nein, es dürfe nun nicht mehr bei schönen Worten allein bleiben, noch morgen könne er fortkommen und ihr heillos entschwinden, der Augenblick sei teuer und, kurz und gut, jetzt müßten sie einander verloben, bitte, Schwester Claudia, bitte — Claudia ... Die Schwester erschrak ob des verwandelten Tones und suchte sich, keines Wortes mehr fähig, abzuwenden, doch gleich bezwang sie sich wieder tapfer zur Gelassenheit und prüfte seinen Puls, ich bewunderte sie, die immer noch die Tränen bannte, während sie mir längst hilflos in die Kissen rannen. Ebenda, als ein erneutes Drängen Stephans Schwester Claudia abermals in Not brachte —, ebenda sah ich den Oberarzt im Türrahmen stehen, er mochte schon einige Zeit dort gestanden haben, nun winkte er Schwester Claudia heftig zu und dann, geschah es: sie beugte sich plötzlich herab und küßte die bleiche Knabenstirn des Verblüfften, nahm abermals seine Hände und versprach sich ihm mit guten leisen Worten der Liebe. Dann, während sich Stephan glückselig zurückstreckte, erhob sie sich und gedachte vielleicht zu fliehen, doch da lief sie gleich dem Oberarzt in den Arm, der mit einer Flasche Sekt am Wege war und nun laut nach den Schwestern Renata und Christine rief, daß sie nur geschwind herbeikämen, fröhliche Zeugen zu sein bei einem wichtigen Ereignis. Dies war Schwester Claudia gar nicht recht. Es kam in dem Sterbezimmer zu einer
feierlichen Zeremonie. Der Arzt und die Schwestern saßen an Stephans Bettrand, es wurde Sekt getrunken und auf eine frohe Zukunft angestoßen, ja, und es wurden Ringe gewechselt, der Oberarzt hatte sie herbeizuzaubern verstanden, und es wurde gar eine festliche Rede gehalten, Lächeln und heiteres Geplauder erfüllten unsere Stube —, bis Schwester Renata und mir das Herz entsprang: wir brachen in ein lautes Schluchzen aus. Das war ein gefährlicher Augenblick. Aller Herzen waren gestimmt, eine Nacht zu weinen, aber der tüchtige Oberarzt fuhr uns mit scharfen Blicken ins Gewissen, und noch einmal gewannen wir alle unsere Fassung wieder. Dann entschwanden die tapferen Zeugen nach und nach. Stephan bekam abermals eine Spritze und eine Tasse Bohnenkaffee, Schwester Claudia saß weiterhin an seinem Lager und sah tränenlosen Blickes in die Nachtschwärze hinaus, das Lächeln überwundenen Schmerzes auf der bräutlichen Stirn. Ich weiß nicht mehr, wie lange Stephan sie noch angeblickt, plötzlich schlief er ein, das blasse Lächeln floh, da war es sechs Uhr in der Frühe.
Ich sah all dem zu, ohne Trauer, von einem unnennbaren Gefühl glücklichen Wandels erhoben. Als seine Augen erloschen waren, stieg, eine leuchtende Kulisse, unser Kap aus dem Nebel. Schwester Claudia drückte Stephan die Augen zu und holte den Oberarzt. Der untersuchte ihn nochmals, gab ihm dann einen kräftigen Backenstreich und sagte: „Nun, hast du's ja geschafft, mein Junge!...“ Als er gegangen war, kam Schwester Claudia, die Herbe, mit raschen Schritten an mein Bett gelaufen und stürzte in meine Arme. „Ich habe ihn lieb gehabt, verstehst du, ich habe ihn doch lieb gehabt“, rief sie und weinte, weinte immerzu, bis uns der erste Strahl der Sonne traf.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!