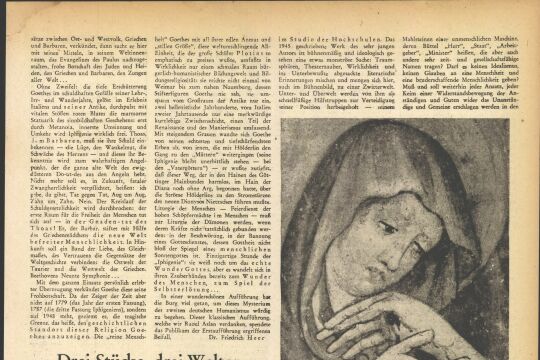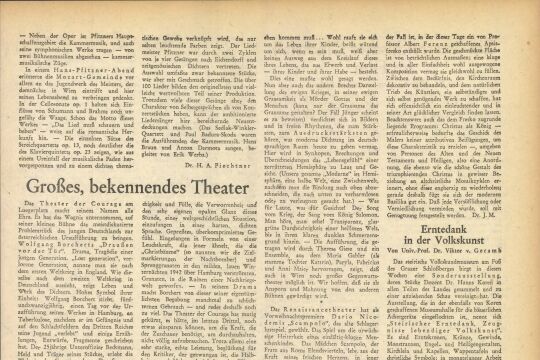Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Welt der versteinerten Herzen
Seit Strindberg als unmittelbarer Vorläufer der literarisch so entwickelten Existenzangst, eines modernen Verfolgungswahnes aus dem Bodenlosen, gilt, hat sich die Einstellung zu seinen Werken gewandelt. Man begegnet ihnen mit einem günstigen Vorurteil. Selbst in einem so sehr der naturalistischen Tradition verhafteten Stück wie „Der Vater“, dem Drama des irrsinnigen Geschlechterkampfes, gleitet das Geschehen aus dem alltäglich Zufälligen bisweilen ins bedrückend Überwirkliche. Jenseits des Individuellen wird der alte Widerstreit zwischen patriarchalischer Geistherrschaft und mutterrechtlicher Lebensordnung fühlbar. Der Mann (hier der Rittmeister) erscheint dann manchmal als Vertreter der Klarheit, Vernunft und Logik, gegen den sich die Verschwörung aus weiblichem Egoismus, falscher Gefühlsamkeit, aus Bigotterie und Aberglauben richtet. Die Frau will das Kind und die Macht über alles Lebendige, das dunkel und geheimnisvoll ist. Aber schließlich ist der Mann der vom Gefühl zur Raserei Getriebene, während Laura, seine Frau, ihn kalt und logisch überwältigt.
Heinrich Schnitzler inszenierte die Tragödie im Theater in der Josefstadt textgetreu zu dem etwas langatmigen Schluß hin eher als psychologisches Privatdrama zwischen dem an seiner Vaterschaft bis an die Grenzen des Wahnsinns zweifelnden Vater und der mit eisiger Willenskälte begabten Furie von Mutter. Susanne Almassy spielte sie mit erbarmungsloser Starre, während Jochen Brockmann von Anfang an das Dumpf-Gequälte, Gefühlsgebundene des Mannes spüren ließ, der zeitlebens dem Mütterlichen verhaftet bleibt. Die Amme von Dorothea Neff wirkte durch Spiel und Erscheinung wie eine dar unheimlichen Nor-nen. Der Beifall am Ende blieb gemessen.
•
„Daß sein Andenken erlöschen dürfte, daß er unzeitgemäß geworden sei, uns nichts mehr zu sagen habe, ist Vorurteil und Wahn.“ Seit der Schiller-Rede von Thomas Mann sind zehn Jahre vergangen, und immer noch bewegt und fasziniert „Kabale und Liebe“, die kolportageartige Historie von der Willkür an deutschen Fürstenhöfen, trotz den bis zum Überdruß bekannten Szenen und den erstarrten Zitaten; immer noch entwickelt die Sprache Schillers ihre Kraft und ihren Glanz. Die große Dichtung ist nicht müde geworden. Man muß „Kabale und Liebe“ spielen, weil es das schönste deutsche Liebesdrama ist und zugleich ein Gleichnis vom Recht des Menschen auf sein Glück. In Ferdinand trat eine junge Generation zum Protest an gegen die Kabalen der Väter.
Schiller bat Rollen zu vergeben, jedoch gehört das Stück nicht zu seinen leichten, weil die Eid- und Brief mechapik darin nun einmal recht gewaltsam anmutet, weil die Intrigenmechanik, welche die Liebe planvoll in Eifersucht verwandelt, stets nur schwer annehmbar sein wird. Leopold Lindtberg vermied jedenfalls in seiner Neuinszenierung im Rahmen des Schiller-Zyklus im Burgtheater jede Bildungslangweile, dämpfte das rhetorisch Überhitzte, ohne dem Stück das Feuer zu nehmen. Aber auch er ließ sich nicht die naturalistischen Effekte der Miller-Szene entgehen, und dann muß die Millerin (Alma Seidler tut es freilich sehr komisch) immer wieder Geschirr in der Küche zerschlagen, wenn Musikus Miller (Attila Hörbiger) sie recht temperamentvoll der Kuppelei zeiht, und er muß sich vor dem Spiegel einseifen — und was so der überflüssigen Mätzchen mehr sind.
Eine Luise und einen Ferdinand zu finden, ist Glückssache. Er müßte wie eine Mischung aus Mars und Apollo wirken, sie, die fröhliche Schönheit von sechzehn Jahren, naiv und doch selbstsicher sein. Elisabeth Ort (unverkennbare Tochter der Paula Wessely) und Klaus Jürgen Wussow erreichen es annähernd, ohne die letzte Leidenschaft ganz glaubhaft zu machen. Sonja Sutter ist eine attraktive und gefühlvolle Lady Milford. Ungewohnt verhalten spielen Heinrich Schweiger den schurkischen Secretarius und Josef Meinrad den Kammerdiener. Paul Hoffmann (Präsident) und Boy Gobert (Kalb) setzen der üblichen Auffassung dieser Rollen keine neuen Lichter auf. Die Bühnenbilder (etwas zu geräumig die Behausung des Musikus, prächtig in den Adelspalästen) stammen von Teo Otto, Starker Beifall.
Bert Brecht schrieb „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ zwischen 1929 und 1931. An einer Heilsarmeegeschichte aus Chikago wollte er die Unzulänglichkeit der frommen Wohltaten angesichts des Elends in dieser Welt zeigen. Mit der ganzen Kraft ihrer erkennenden Unschuld will die kleine Johanna Dark („d'Arc“), das Mädchen aus den Reihen der „Schwarzen Strohhüte“ (der Heilsarmee), dem Fleischkönig Pierpont Mauler, übermächtiger Repräsentant der kapitalistischen Gewaltherrschaft, Trotz bieten. Johanna ist die erste tragische Mädchengestalt Brechts, Vorgängerin der stummen Kattrin in „Mutter Courage“, der Grusche im „Kreidekreis“ und des „Guten Menschen“ Shen Te. Immer wieder läßt sie sich vom moralischen Schein täuschen, mit dem Mauler seine Spekulationen umgibt. Rührend irrt sie durch die Welt der versteinerten Herzen, Wärme spendend, echte Wärme, echte Liebe. Am Ende, todkrank vor Hunger und Kälte, bekennt sie sich zur revolutionären Veränderung der Gesellschaft, verfluchend das „System“, das „ohnegleichen“ ist,
„tierisch und also unverständlich“, und ihren Auftrag an die Nachwelt weitergebend: „Sage ich euch: / Sorgt doch, daß ihr die Welt verlassend / Nicht nur gut wart, sondern verlaßt eine gute Welt!“ Denn Johanna hatte gelernt, daß der Armen Schlechtigkeit von der Armut kommt und die Sozialordnung eine Schaukel ist (viele müssen unten sein, damit sich wenige oben halten können). Doch ihr Bekenntnis wird vom vereinigten Chor der Fleischspekulanten, der Schlächter, Viehzüchter, Aufkäufer und der Schwarzen Strohhüte übertönt. Ihnen liegt daran, in der Sterbenden eine Märtyrerin der christlichen Wohltätigkeit zu feiern. Auf zynische Weise betreiben sie ihre „Kanonisierung“, um ihren Opfertod groß „aufzuziehen“, damit die Welt sehe, „daß die Menschlichkeit bei uns einen hohen Platz einnimmt“.
Das episch breit angelegte und dramatisch doch scharf gefaßte Stück ist in Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise 1929/30 entstanden, heute also politisch und ökonomisch längst überholt. Aber das große Gedicht vom Fleisch enthält Werte und Absichten, die über das Kampfstück von vorgestern hinausreichen. Johanna geht auch den Weg „in die Tiefe“ des christlichen Gewissens. Und selbst aus dem scheinbar blas-phemischen Satz gegen Gott ist der Schrei des Menschen zu hören, daß Gott unsichtbar bleibt, während gepredigt wird, er hülfe doch. Die Unruhe des Gewissens hält an und so auch die Beziehung zur Wirklichkeit von beute.
Die Inszenierung von Gustav Man-ker im Volkstheater war ohne vergröbernde Akzente und behielt bei allem makabren Witz die dunkle Poesie und den bitterbosen Ernst hinter allem bei. Aus dem großen Ensemble ragten Tatjana Schneider in der Titelrolle und Herbert Probst als der Fleisohkönig Mauler hervor. Das Volkstheater fordert hier seinem Abonnementpublikum recht Ungewohntes ab. Der Beifall schien darum doch wohl in erster Linie den Schauspielern zu gelten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!