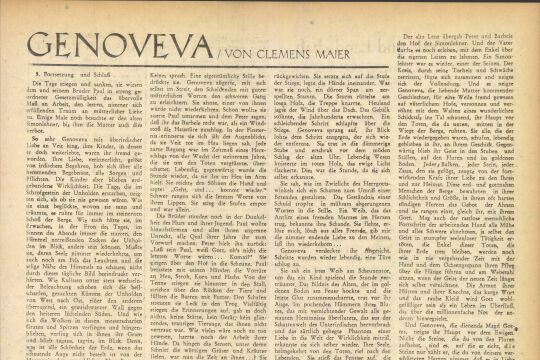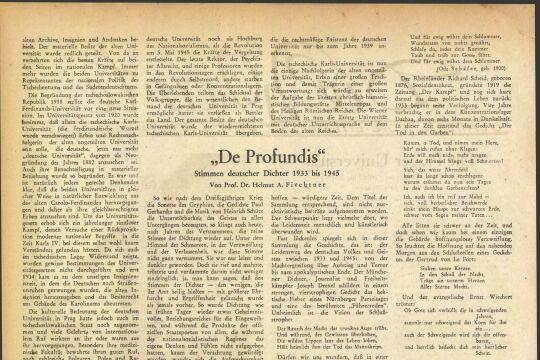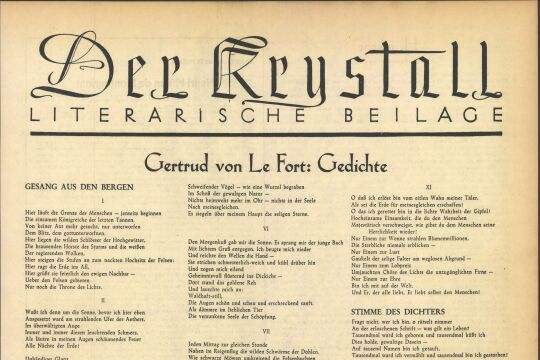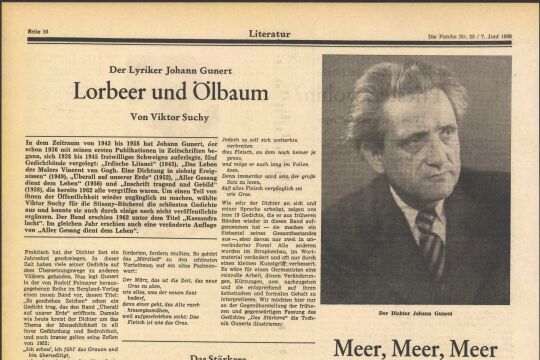Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Welt im Gedicht
Das Gedicht ist nicht nur jenes „schwerelose Gebilde aus Worten“, deren Aneinanderreihung nach „Auswahl, Maß und Klang“ erfolgt, wie man um die Jahrhundertwende in den „Blättern für die Kunst“ lesen konnte, sondern es ist auch Spiegel des Dichters, seines Weltbildes und seiner Weltanschauung in des Wortes wörtlicher und übertragener Bedeutung. „Gesänge von der Erde“ hieß eines der frühen Versbüdier von Hans Leifhelm, in welchem der Dichter die Schönheit der Natur rühmend verkündet Nun ist aus dem Nachlaß des Dichters, der 1947 in Riva nach schwerer Krankheit in vollkommener Einsamkeit starb, die Sammlung „Lob der Vergänglichkeit“ erschienen und legt Zeugnis ab von der hohen Meisterschaft und dem Formenreichtum ihres Schöpfers1. Auch in diesem Band nehmen die Naturgedichte den breitesten Raum ein. Die große und die kleine Welt wird hymnisch besungen, von der Wucht und Erhabenheit der Alpen bis zum golden besonnten Falter, dessen Augen schwarz wie Turmalin glänzen und auf dessen Flügeln sich schneeige Monde, Sommerwolken gleich, abzeichnen. „Det; Dichter ist aus diesem Buch verbannt — Es kündet zwar, was er aus sich bekannt — Doch es verschweigt, was tief im Herzen brannte“, beginnt das Eingangsgedicht. Di Mitmenschen konnten seine Stimme nicht mehr hören —
Doch Einen mag die Botschaft wohl erreichen,
Der zu entwirren weiß des Rätsels Stränge,
Den Sinn erkennend der geheimen Zeichen.
Für die Naturlyrik mit ihren weitgespartn- ten Rhythmen mögen einige Zeilen aus dem Gedicht „Sommersonnwend in den Alpen“ stehen:
Hinter den Tälern sinkt nieder der Mond und schwarz steht der Wall starrender Fichten, die Tiefen vergehn, aber klar wie Kristall zieht des Urgebirgs riesige Linie weit durch die Nacht,
von des Siebengestirns auffahrenden Zeichen funkelnd bewacht.
1 Lob der Vergänglichkeit. Von Han Leifhelm. Otto-Müller-Verlag, Salzburg.
Die südliche Landschaft, in 'der der Dichter seine letzten Jahre verbrachte, spiegelt sich in der Reihe: Erinnerung an Maloja, In Latium, Römische Brunnen. Den zweiten Teil des Bandes bilden kunstvolle Übertragungen aus dem Italienischen, in die viel von der Musik dieser volltönenden, vokalreichsten Sprache eingegangen ist. Von dem zehnstrophigen „Liebesgesang des heiligen Franz von Assisi“ 6tehe hiefür als Beispiel der Anfang und der Schluß:
Ich brenn im Feuer der Liebe,
Ich brenn im Feuer der Liebe,
Vor Liebe lodernd ich brenne,
Seit idi den Geliebten kenne,
Das Lamm, das mir gegeben,
Den Ring zum Unterpfand ,
Mich fesseln der Liebe Bande,
Mich traf der Pfeil der Liebe,
Mich traf ins tiefste Leben.—
Ich brenn im Feuer der Liebe.
Und da ich die Liebe vergolten,
Gewann ich mit Ihm den Frieden.
Der Liebe, der wahrhaft gezollten,
Ist Christi Liebe beschieden
In seine 1 Liebe beschlossen,
So leb ich gesegnet hienieden,
Die Glut der göttlichen Liebe Ist mir ins Herz geflossen,
Mein Herz ist neu gegossen Im sengenden Feuer der Liebe.—
Kaum ein größerer Gegensatz ist denkbar als der zwischen dem musikalischen Naturlaut Leifhelms, des aus Westfalen gebürtigen Wahlösterreichers, und der harten, plastischen Fügung der „Statischen Gedichte“,1 des Berliner Arztes Gottfried B e n n, dessen Name in der Zeit des Expressionismus nach dem ersten Kriege viel genannt wurde und dann lange Zeit verschollen war. Die Natur, als rein Anschauung, existiert für ihn nicht. Er muß sie denkend analysieren. Dies geschieht aber nicht, wie in seinen früheren Gedichten, mit dem Mikroskop und dem Hörrohr des Arztes, sondern mit dem die Oberfläche der Scheinwelt durchdringenden Blick des ge-
1 Statisch Gedichte. Von Gottfried Benn. kt .Verlag der „Arche“, Zürich.
schichtshewußten Menschen, ja des Prähistorikers. „Quartär“ nennt Benn einen Zyklus, dessen erstes Stück lautet:
Die Welten trinken und tränken sich Rausch zu neuem Raum, und die letzten Quartäre versenken den ptolomäisdien Traum.
Verfall, Verflammen, Verfehlen — in toxischen Sphären, kalt, noch einige stygisdie Seelen einsam, hoch und alt.
„Vergänglichkeit“ könnte als Motto auch über den Gedichten von Gottfried Benn stehen, Vergänglichkeit und Hinfälligkeit des einzelnen Menschen, der Völker und ganzer Rassen. Für diese Stimmung findet er ergreifend melancholische Töne, die in strenge, statische Formen gebannt sind:
Tag, der den Sommer endet,
Herz, dem das Zeichen fiel: die Flammen sind versendet, die Fluten und das Spiel.
Die Bilder werden blasser, entrücken sich der Zeit, wohl spiegelt sie noch ein Wasser, doch auch dies Wasser ist weit.
Du hast eine Schlacht erfahren, trägst noch ihre Stürme, ihr Fliehn, indessen die Schwärme, die Schatten, die Heere weiterziehn.
Rosen und Waffenspanner,
Pfeile und Flammen weit —: die Zeichen sinken, die Banner —: Unwiederbringlichkeit. —
Zwischen diesen beiden Extremen hält C a r o s s a die Mitte, die Goethesche Mitte zwischen Natur und Geist. Wer das Prosawerk des Dichters, besonders aber seine große Goethe-Rede aus dem Jahre 1938 kennt, die damals nicht ohne offiziellen Widerspruch blieb, wird nicht erstaunt sein, aus Carossas neuem Gedichtband1 vertraute Goethesche Töne zu vernehmen, freilich in sehr eigenen, selbständigen und um die Untertöne der Gegenwart bereicherten Varianten. Die Prägnanz und Konzentriert-
1 Gesammelte Gedicht . Von Hans Carossa. Im Verlag der „Arche“, Zürich.
heit der Form erinnert manchmal auch an fernöstliche Lyrik:
Blasser Mond mit blau verschwommnem Rande Schwebte über tageshellem Lande.
Als ich in die Schlucht stieg, um zu trinken, Da begann sein heimlich stärkres Blinken. Nun im tiefen, dunklen Quellengrunde Leuchtet er wie in der Dämmerstunde.
Carossa ist Arzt und Humanist. Von seinem Beruf kommt ihm der nüchtern-klare, aber niemals lieblos-kalte Blick. Die tiefe Verbundenheit mit der alten Kultur unseres Erdteils läßt ihn immer wieder, in aller Zerstörung und Unmenschlichkeit, auf Heilung und geläutertes Menschentum sinnen. So kannten wir ihn aus seinem nach dem ersten Weltkrieg geschriebenen „Rumänischen Tagebuch", und so klingt seine Stimme auch wieder zu uns aus der „Abendländischen Elegie" 1943:
Wird Abend über uns, o Abendland?
Was wir erdulden, haben deine Seher Vorausgelitten, vorausgesagt.
Sie schaun das Kommende, doch nur von fern. Sie wissen auch, wodurch wir uns verfehlen, Doch wenden sie nichts, und wenn Verhängnis eintrifft,
Erkennen sie ’s nicht mehr, nennen es Rettung. Das Verhängnis trat ein: fliegende Geschwader jagten über den Heimathimmel, Städte sanken in Trümmer, das Schriftwerk der Völker, in hohen, hellen Sälen aufgestellt, wurde zu Asche, Rauch stieg empor, und wie ein warnender Finger redete sich da und dort die Spitze eines verschonten Domes durch Brandwolken zum Himmel. Benommen stehen die Menschen um das Irr- sal. Wo ist Trost, wo Rettung?
O Abendland, yO reich in der Verarmung,
Blick auf. Laß das Vergängliche vergehn.
Du weißt es doch, daß in der obem Sphäre Nicht alles mitstürzt, was im Irdischen fällt. Wer alles retten möchte, rettet nichts...
Aus Trümmern steigt einmal ein Segentag,
Wo wir das Licht nicht mehr verhehlen müssen Und wieder frei mit Urgewalten spielen.
Ja war’s kein Tag, war’s eine Stunde nur,
Wo wir in einem reinen Anfang stehen, Mitwehend an dem Stemenplan der Erde,
Wir trügen froh die Jahre der Verdunklung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!