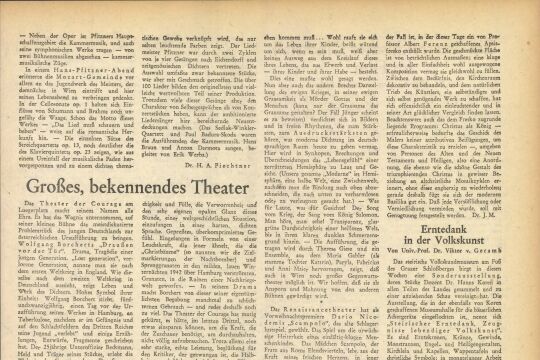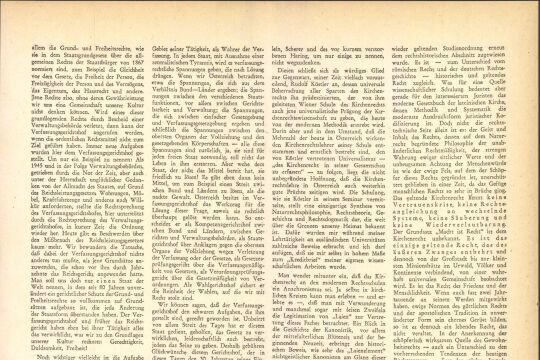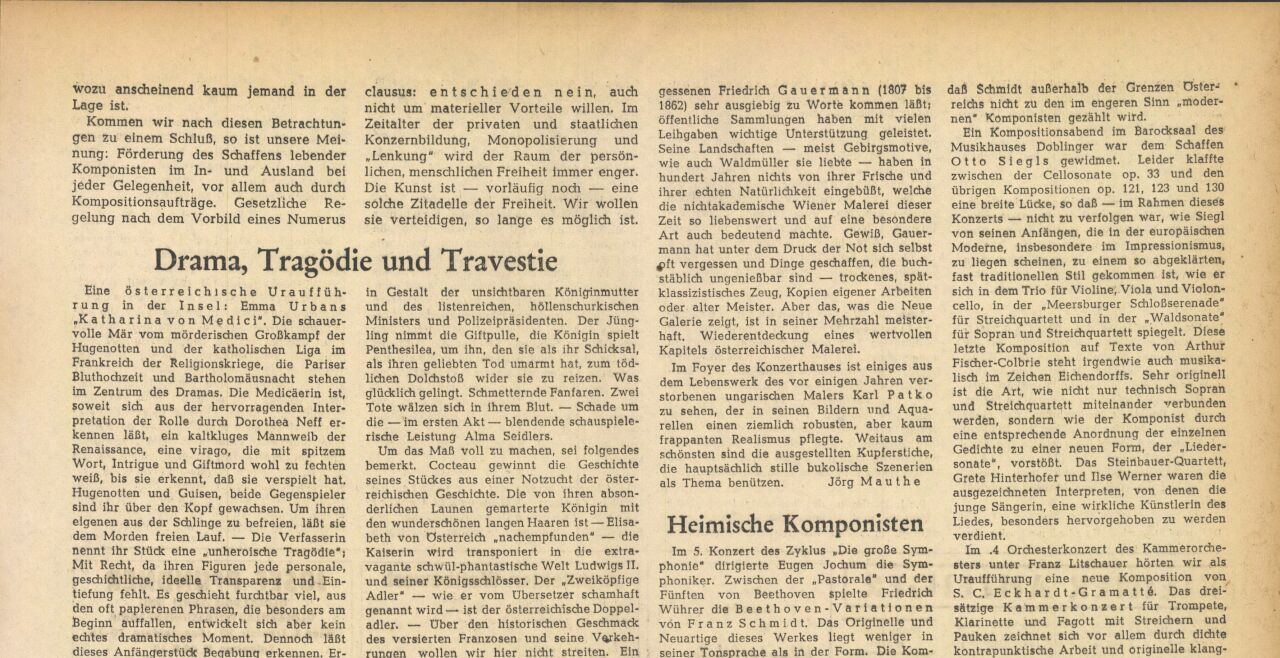
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Drama, Tragödie und Travestie
Eine österreichische Uraufführung in der Insel: Emma Urbans Katharina von Medici“. Die schauervolle Mär vom mörderischen Großkampf der Hugenotten und der katholischen Liga im Frankreich der Religionskriege, die Pariser Bluthochzeit und Bartholomäusnacht stehen im Zentrum des Dramas. Die Medicäerin ist, soweit sich aus der hervorragenden Interpretation der Rolle durch Dorothea Neff erkennen läßt, ein kaltkluges Mannweib der Renaissance, eine virago, die mit spitzem Wort, Intrigue und Giftmord wohl zu fechten weiß, bis sie erkennt, daß sie verspielt hat. Hugenotten und Guisen, beide Gegenspieler sind ihr über den Kopf gewachsen. Um ihren eigenen aus der Schlinge zu befreien, läßt sie dem Morden freien Lauf. — Die Verfasserin nennt ihr Stüde eine „unheroische Tragödie“: Mit Recht, da ihren Figuren jede personale, geschichtliche, ideelle Transparenz und.Eintiefung fehlt. Es geschieht furchtbar viel, aus den oft papierenen Phrasen, die besonders am Beginn auffallen, entwickelt sich aber kein echtes dramatisches Moment. Dennoch läßt dieses Anfängerstück Begabung erkennen. Erstaunlich und lobenswert, was die sehr sorgfältig von Regie, Bühnenbild und Ensemble betreute Aufführung der Insel aus ihm gemacht hat: der Zuschauer folgt ohne Ermüdung mit Interesse dem Ablauf der Verwicklungen.
Eine großartige Aufführung in der Josefstadt: „Der Tod des Handlungsreisenden“ von Arthur Miller. Ubersetzung: Ferdinand Bruckner. Regie: Ernst Lothar. Das Stück hat in den USA Stürme der Begeisterung entfesselt. Es ist an sich ein Reißer von jener neuromantisch-realistischen Art, die gegenwärtig auf den Bühnen des Westens Triumphe feiert. — Am Vortage seines Sterbens erkennt Willy Loman, der Salesman, seine Lebenslüge: er hat zeitlebens seine Frau, seine Söhne, sich selbst betrogen. Seine Jungen, Tunichtgute und Gecken, hielt er für die tüchtigsten Söhne der Welt, sich selbst — fast — für einen Mann des Erfolgs. Nicht erkennt er, daß er diese Fiktionen brauchte, um durchhalten zu können in dem wilden Existenzkampf, den New York, den ein soziales System ohne jede Sicherheit und Sicherung dem kleinen Handlungsreisenden aufzwingen, dessen Erfolg von tausend Ungewißheiten abhängt. Mit großem Geschick malt nun Miller seine einfache story vom Sterben des kleinen Mannes zum Hohen Lied des kleinen Mannes aus, Illusionen, Lügen, kleine Kniffe, ja auch Sllerien in einem dutzend-, ja millionenfach gleichgestanzten Leben? Ja, aber da ist noch etwas, und dieses schwer definierbare Etwas, in Worten kaum sagbar, in Bildern nur andeutbar, wird von der Regie Lothars ausgearbeitet in einer minutiösen, pointillistischen Präzisionsarbeit, die die Licht-, Schatten-, Ton- und Zeitlupenmagie meisterlich beherrscht, um die Luft, die Stimmung dieses „Etwas“ richtig zu mischen: jene Atmosphäre eines Lebensgefühls des modernen großstädtischen Menschen, in ihrer Mengung greller, dumpfer, bunter und bleicher Töne und Farben. Lust, Schwermut und Trauer, Ekel und Enthusiasmus, Hoffnungslosigkeit und Überschwang, Täuschung und Enttäuschung. Unheroisch, unpathetisch, gedämpft, verschattet zu feinsten Nuancen, letzte Grausamkeit und letzte Tröstung eines durchschnittlichen Lebens. Die Humanität einer durchschnittlichen Begabung, eines mittelmäßigen Charakters, eines alltäglichen Lebensweges. Diese unmythische Welt wird doch noch von einer mythischen Figur überwölbt, die bezaubert in ihrer lichten Klugheit, Demut, dichten Menschlichkeit: Lomans Gattin, die Mutter seiner Söhne, die Ordnungsmacht dieser wirren Welt. Eine kleine schlichte Frau, die alles versteht und alles verzeiht. Die Hintergründigkeit der dienenden Liebe. Adrienne Geßner gestaltet sie zum Erlebnis.
Erste Premiere im Akademietheater nach dem großen Streik. „Der zweiköpfige Adler“ von J. Cocteau. Nur eine blinde Sucht, große Autorennamen der Gegenwart und große Rollen auf dem Programm zu haben, kann die Aufführung dieses krud-grausamen Kitsches durch unsere Staatsbühne erklären, niemals aber rechtfertigen. Eine Spielerei, raffiniert und albern zugleich, mit den Schauer- und Spukrequisiten der Münchner Historienmalereien, Markartscher Plüschkultur, gebeizt durch psychoanalytische Soßen. Eine hysterische Königin, deren Gemahl kurz nach der Hochzeit dem Mordstahl (Ha! Ha!) eines tückischen Mordgesellen erlag, üoerreizt, übererregt, verquält in selbstverschuldeter Einsamkeit und Maskerade, wird die Geliebte jenes ehrenwerten Dichterstudenten und Anarchisten, der, sie zu morden, in der Gewitternacht beim Fenster einsteigt. Schon droht •dem Liebespaar das Verderben — in Gestalt der unsichtbaren Königinmutter und des listenreichen, höllenschurkischen Ministers und Polizeipräsidenten. Der Jüngling nimmt die Giftpulle, die Königin spielt Penthesüea, um ihn, den sie als ihr Schicksal, als ihren geliebten Tod umarmt hat, zum tödlichen Dolchstoß wider sie zu reizen. Was glücklich gelingt. Schmetternde Fanfaren. Zwei Tote wälzen sich in ihrem Blut. — Schade um die — im ersten Akt — blendende schauspielerische Leistung Alma Seidlers.
Um das Maß voll zu machen, sei folgendes bemerkt. Cocteau gewinnt die Geschichte seines Stückes aus einer Notzucht der österreichischen Geschichte. Die von ihren abson-derlidien Launen gemarterte Königin mit den wunderschönen langen Haaren ist —Elisabeth von Österreich „nachempfunden“ — die Kaiserin wird transponiert in die extravagante schwül-phantastische Welt Ludwigs II. und seiner Königsschlösser. Der „Zweiköpfige Adler“ — wie er vom Übersetzer schamhaft genannt wird— ist der österreichische Doppeladler. — über den historischen Geschmack des versierten Franzosen und seine Vvkeh-rungen wollen wir hier nicht streiten. Ein anderes ist die Geschmack- und Instinktlosig-keit der österreichischen Urheber dieser Wiener Staatstheateraufführung: Menschen, die nicht wissen, woher wir kommen, wohin wir gehen, wo wir heute stehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!