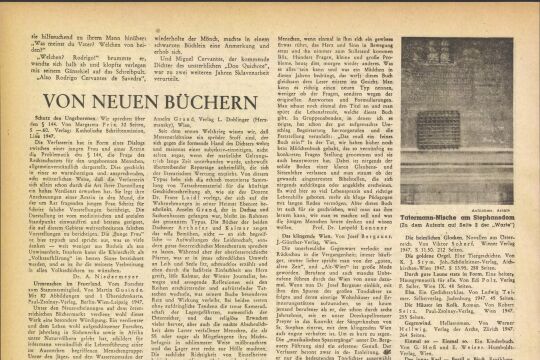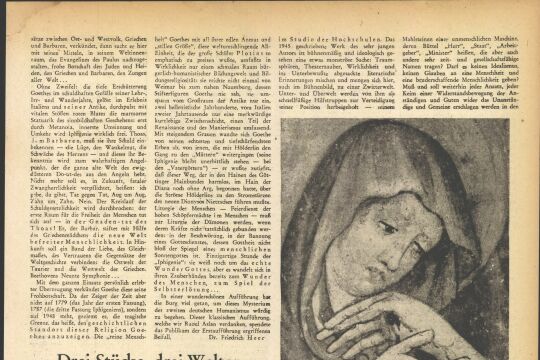Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Dramatisches Panoptikum
Wir kennen den gar nicht so typisch amerikanischen Dramatiker und Epiker Thornton Wilder, Autor so ausgezeichneter Bühnen werke wie „Unsere kleine Stadt“, „Wir sind noch einmal davongekommen“ oder seine Irdisches und Überirdisches kühn verbindenden „Einakter und Dreiminutenspiele“ als den Gegentyp des hartgesottenen Realisten der Verzweiflung, der Langeweile, des Lebensekels. Mit seiner witzig-einfallsreichen, herzensstarken Kunst vertrieb er immer wieder den Alpdruck der Angst. Seit je war für ihn der eigentliche Sinn der Literatur: „die Notation des Herzens“. Wenn er jetzt in seiner vorläufig letzten Arbeit j für die Bühne, in dem geplanten Einakterzyklus „Die sieben Lebensalter des Menschen“, wieder einmal die Abenteuer, Wunder und Schrecken des Alltags aufzeichnen will, so bleibt er damit durchaus im Rahmen seines Werkes. Auffällig ist nur eine weit stärkere Einbeziehung psychoanalytischer Erkenntnisse und ein nicht zu überhörender pessimistischer Unterton, der Wilders „Menschenfreundlichkeit“ zu überdecken scheint.
Das gilt vor allem für seine dramatische Studie „ln den Windeln“, Darin unterhalten einander zwei Säuglinge in ihren Kinderwagen über den Sinn beziehungsweise Unsinn der Welt und die albernen Erwachsenen. Die sind vertreten durch eine unwahrscheinlich dummes Zeug Schnatternde Mutter, ein Kindermädchen, dessen Phantasie in Vorstellungen sentimentaler Kitschromane schwelgt, und einen beschränkten Polizisten, welcher dejr Nurse nachstellt. Die Babys (dargestellt von zwei erwachsenen Schauspielern) beobachten das Treiben der Großen mit überscharfen Augen und enthüllen als echte Freudianer ihre unbewußten Haßkomplexe, Ängste und Begierden. Es ist klar, was Wilder damit gemeint hat: den Abgrund der Verständnislosigkeit zwischen den schon hoffnungslos verbildeten Erwachsenen und den Babys, denen noch alle Möglichkeiten der Bildung und Verbildung offenstehen. „Sie wollen nicht, daß wir gut werden und immer besser und besser“, greinen sie, „sie wollen uns stoppen. Sie nehmen uns nicht ernst. Wir sind ihnen im Weg, wir sind zu klein.“ Was groteske Farce scheint, besonders wenn die erschreckend greisenhaft anmutenden Gesichter der Schauspieler aus dem Kinderwagen hervorlugen, ist manchmal urkomischer, aber bitterer Ernst. Die Inszenierung von Veit Relin im Kleinen Theater der Josefstadt im Konzerthaus ist viel zu sehr auf Effekt bedacht, übersteigert das Groteske und bringt dadurch den Einakter um seine eigentliche Wirkung.
Besser gelingt es ihm, im zweiten Einakter, „Kindheit“, das gleiche Motiv des Fremdseins zwischen Eltern und Kindern zu realisieren. Die leicht erhitzte Phantasie der Zwölfjährigen, der Zehnjährigen und des Sechsjährigen läßt sie den Tod der Eltern spielen, wonach sie als Waisenkinder (endlich aller Aufsicht und Ermahnungen ledig) eine Traumfahrt unternehmen, von der sie am Ende doch wieder reuig zu den wirklichen Eltern heimkehren. Diese symbolhafte Busfahrt in Verbindung mit einer Art dramatischer Pädagogik ist freilich nicht ganz frei von Sentimentalität. Gespielt wurde in beiden Fällen ausgezeichnet: Sigrid Marquardt war die unausstehliche und sanft verschat- tete Mutter, Helly Servi ein köstliches Kindermädchen, Peter Matic und Walter Varndal je einer der gräßlichen Säuglinge, Curt Eilers der dümmliche Polizist und herzhafte Vater; Christine Merthan, Michaela Trescher und Peter Toifl spielten eindringlich die Halbwüchsigen. Das annehmbare Bühnenbild stammte von Jan Veenenbos.
Der Wiener Theodor Tagger schrieb unter dem lang gehüteten Pseudonym Ferdinand Bruckner in den Jahren 1929 bis 1931 seine aufsehenerregenden und aufregenden „psychoanalytischen Dia gramme“ der Nachkriegsjugend, die Dramen: „Krankheit der. Jugend“, „Die Verbrecher“ und „Die Kreatur“. Darin zeigte er, wie in den hektischen zwanziger Jahren die Zeit aus den Fugen geraten war. Dort war es die Krankheit des Lebens, welche die Jugend verzehrte, hier das Laster des Verbrechens, dem die Erwachsenen wie die Jugend anheimfielen. Denn wir alle sind Verbrecher, lautete seine These, ! Verbrecher vor der Justiz oder heimliche, unerkannte. Die Justiz aber irrt, läßt Schuldige freigehen und Unschuldige arme Kreaturen die ganze Härte des Gesetzes treffen. Bis zuletzt hielt Bruckner an seinem Lebensgefühl und seiner alten These fest: „Einer Abschaffung der Tragödie müßte die Abschaffung des Menschen vorangehen.“ Den Vorwürfen gegen seine schockierenden Themen hielt er einen Satz aus einem Essay aus dem Jahr 1917 entgegen: „Man muß manchmal jemanden kranker machen als er schon ist, upi ihn gesund zu machen “
Im Volkstheater versuchte man unter Regie von Gustav Manker eine Wiederaufführung des 35 Jahre alten Zeitstücke „Die Verbrecher“. Bruckner reißt die Fapsade eines Hauses in einer „Stadt in SUddeutschland, um 1926“ ab und verknüpft in filmartiger Verwandlungsfähigkeit auf sieben neben- und übereinander ‘ geschalteten Schauplätzen das menschliche Nebeneinander der Zeitgenossen von Anno dazumal. Im ersten
Akt geschehen böse Dinge: Mord, Kindestötung, Abtreibung, Erpressung, Meineid, Diebstahl, Bedrohung, Bestechung und so fort. Der zweite Akt zeigt die Angeklagten vor den Schranken einer unfähigen Justiz und reaktionären Richtern. Vier Justizirrtümer sind das klägliche, höhnisch angeprangerte Ergebnis. Im dritten Akt büßt ein Teil der „Verbrecher“ die verhängten Strafen ab, während die übrigen ihr flottes Schandleben weiterführen. Denn keine Schuld rächt sich auf Erden, und es gibt gar keine Verbrecher, lauten die zweifelhaften Thesen, die damals, im Nachkriegsjahrzehnt der Auflösung aller Werte als Schock gedacht waren.
Bruckner ist ein effektvoller Dramatiker. Sein Dialog charakterisiert — von einigen expressionistischen Übersteigerungen abgesehen — knapp und treffend die jeweilige Gestalt, die auf der Simultanbühne wie im Blitzlicht nur minutenlang aufscheint. Zentralfigur des Geschehens ist die Köchin Ernestine Puschek, die in triebhafter Hörigkeit den stellenlosen Kellner und Falotten Gustav Tunichtgut liebt, ihm ein fremdes Kind als eigenes unterschieben will und in rasender Eifersucht die liederliche Schankwirtin des Hauses erwürgt. Der Kellner, ein eher gutmütiger Sexualprotz und Weiberheld, muß als Unschuldigster der Verbrecher die härteste Strafe, den Tod, auf sich nehmen. Die beiden Gestalten, vor allem aber die der Köchin, legitimieren Ferdinand Bruckner als echten Dramatiker. Hilde Sochor und Edd Stavjanik wurden den beiden großen Rollen durchaus gerecht.
Aber auch viele andere unter den mehr als drei Dutzend Mitwirkenden boten eindrucksvolle Leistungen. Die Regie Gustav Mankers erreichte ihren Höhepunkt im ersten (übrigens besten) Aufzug, verflachte dann im dritten sichtlich und übersteigerte den Schluß leider in grelle Hysterie. Das Bühnenbild stammte von Wolfgang Vollhard. Die zweckmäßige Stahlröhrenkonstruktion ermöglicht einen erstaunlich raschen Umbau (vom ersten zum zweiten Akt). Das Publikum feierte die Schauspieler, war aber angesichts des ihm gebotenen Panoptikums voller Unheil und Verkommenheit doch recht verblüfft.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!