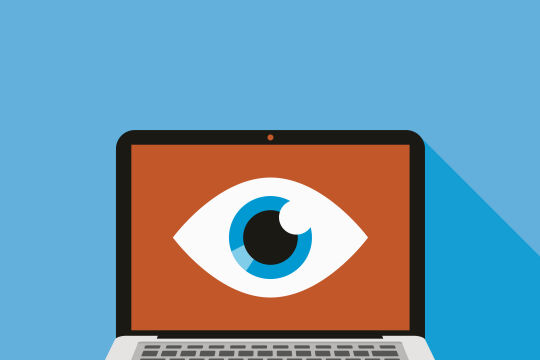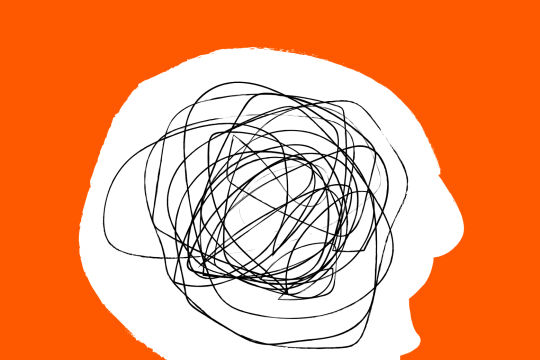Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Droht uns eine neue Volkskrankheit?
Es begann in einer Gondel hoch über Sölden im Ötztal. Eigentlich genoß ich den Ausblick. Ich nahm meinen Fotoapparat und wollte das Bergmassiv knipsen. Ein Blick durch den Sucher und plötzlich - ein Kribbeln in den Händen, den Füßen, am ganzen Körper, nicht mehr enden wollend. Das Herz begann zu rasen, immer mehr und immer mehr. Kalter Schweiß stieg auf die Stirn. Panik brach aus.
Langsam beruhigte ich mich wieder, ich war nicht alleine in der Gondel. An einem meiner beiden Freunde hatte ich mich festgekrallt in meiner Todesangst. Das war der Anfang. Ich war damals 18 Jahre.“
So schildert Josef S, heute bereits über 30, den Ausbruch seiner Krankheit. Die Angst vor solchen unberechenbaren Panikattacken ist seither sein ständiger Begleiter geworden und dirigiert sein Leben. Eine seelische Störung, die jeden Menschen treffen kann, denn Josef S. ist kein Einzelfall.
In Wien wurde sogar eine eigene Ambulanz für solche Patienten eingerichtet. Der Leiter dieser Panikattacken-Ambulanz an der Klinik für Psychiatrie im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) ist Peter Berger. Der Arzt schätzt die Zahl jener, die von schweren, ständig wiederkehrenden Panikanfällen betroffen sind, auf etwa drei Prozent der Bevölkerung. 30 Prozent der Österreicher haben irgendwann in ihrem Leben eine starke Angst in Form einer Panikattacke erlebt.
Angst, ein lebensnotwendiger Schutzmechanismus, kann bei vielen Menschen zur krankhaft werden: Der erste Panikanfall kommt ohne ersichtlichen Grund. Im Supermarkt, im Bus oder Ajuto. Die meisten wissen gar nicht, was mit ihnen geschieht. Sie fürchten in der ersten Beaktion eine schwere körperliche Erkrankung, etwa Herzinfarkt oder eine Gehirnblutung. Die Angst steigert sich zur Todesangst. Oft wird sofort ein Arzt oder die Notaufnahme eines Krankenhauses aufgesucht. So habe ein Patient in seiner Furcht vor einem drohenden Herzanfall ständig den Wohnblock des Arztes umkreist, beschreibt Friedrich Strian, Leiter der Neurologischen Ambulanz des Max-Planck-Institutes für Psychiatrie in München (siehe Bücher-Kasten). „Die Panikattacke“, erklärt Strian, „ist eine plötzliche, für den Patienten ohne erkennbaren Grund, gewissermaßen aus heiterem I limmel hereinbrechende, exessive Angst, die für ihn den Charakter einer existentiellen, tödlichen Bedrohung hat und der er hilflos, unkontrollierbar ausgesetzt ist.“ In den meisten Fällen bemerken die Mitmenschen den Panikanfall nicht einmal, obwohl der Betroffene meint, die ganze Welt müßte ihm ansehen, wie schlecht es im geht, denn die körperlichen Beschwerden sind zahlreich und heftig:
■ Beschleunigter Herzschlag und Herzpochen;
■ Benommenheit, Gefühl der Ohnmacht, Veränderung des Bewußtseins, Wirklichkeitsverlust;
■ Atemnot, Beklemmungs- und Erstickungsgefühle;
■ Schmerzen in der Brust;
■ Schwitzen, Hitze- und Kältegefühl;
■ Furcht, die Kontrolle zu verlieren und „verrückt zu werden“;
■ Übelkeit und Bauchbeschwerden;
■ Taubheitsgefühl (Kribbeln).
„Normalerweise“, so versichert. Oberarzt Berger vom AKH, „passiert dem Betroffenen während der Attacke nichts“. Obwohl die Angst unvermittelt einsetzt, wird der Angstgipfel bereits nach wenigen Minuten erreicht und klingt meist innerhalb von 20 Minuten wieder ab.
In den meisten Fällen tritt die erste Attacke zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auf. Warum diese Krankheit überhaupt zum Ausbruch kommt, so Peter Berger im Gespräch mit der furche, ist noch nicht ganz geklärt. Bei der Hälfte seiner Patienten trat in unmittelbarer Vorzeit ein belastendes Ereignis auf: Trennung, Verlust des Arbeitsplatzes oder der Tod eines Angehörigen.
Als typische Beakti-on im Langzeitverlauf beginnen die Betroffenen Situationen zu meiden, bei denen sie bereits einen Panikanfall erlitten haben. Phobien entstehen. Mit jeder neuen Panikattacke verkleinert sich ihr Bewegungsspielraum. Ein Teufelskreis. Das Vermeidungsverhalten kann soweit gehen, daß sie sich kaum mehr ohne Begleitung aus dem Haus trauen und sich vollkommen ver-schließen.
„Schon auf der Treppe spürte ich, wie die Angst langsam in mir hochkroch, ich ging wie auf Yciue unu schleunigst wieder umgekehrt“, beschreibt eine Patientin in dem Buch „Die Angst aus heiterem Himmel“ ihre seelische Not (siehe Bücher-Kasten). Das Leben wird zur Hölle. Die meisten Menschen vermeinen, in ihrer Todesangst alleine zu sein und versuchen, ihre Gefühle zu verbergen. Das Schlimmste, sagen viele Betroffene, ist die „Angst vor der Angst“.
Sind solche Panik- und Angststörungen auf dem besten Weg, eine Volkskrankheit zu werden?
Der Begriff „Panikattacke“ ist in der Medizin relativ neu. Erst seit 15 Jahren gibt es eine klare Definition. Die Krankheit selbst hat es vermutlich immer schon gegeben. Johann Wolfgang von Goethe soll, zumindest zeitweise, ebenso davon betroffen gewesen sein wie Blaise Pascal und Fjodor M. Dostojewski. Angststörungen sind vermutlich auch keine Zivilisationskrankheit, meint AKH-Arzt Berger. „Das gibt es offenbar schon lange und überall auf der Welt. Bei den Eskimos genauso wie in Europa oder Südamerika. Auf dem Land genauso wie in der Stadt.“ Sigmund Freud hat sich erster mit Angstneurosen auseinandergesetzt. In den letzten 20 Jahren begannen sich Mediziner und Psychologen dann vermehrt mit den verschiedenen Angstaspekten zu beschäftigen. Neue Therapien und Medikamente wurden speziell auf Panikpatienten zugeschnitten (siehe nebenstehendes Interview).
Panikattacken sind keine typische Frauenkrankheit. Zwar sind bei der Behandlung mehr Frauen anzutreffen, allerdings deshalb, weil Frauen eher bereit sind, sich einem Arzt anzuvertrauen. Männer versuchen hingegen oft „die Flucht nach vorne“ anzutreten oder die Angst mit Alkohol wegzuspülen.
Ein Erfahrungswert, den auch Oberarzt Berger in seiner Station bestätigen kann. „Zwei Drittel der Patienten sind Frauen. Analysiert man aber alle Betroffenen, dann überwiegen die Frauen nur geringfügig.“
Die Panikattackenambulanz im AKH wurde im Mai 1992 gegründet. Pro Jahr kommen 100 neue Patienten. Zu viele, bedauert Berger. Einige der Hilfesuchenden, vor allem aus den Bundesländern, müssen an regionale Ärzte verwiesen werden. Die seien aber heutzutage durchaus mit dem Problem vertraut, versichert der Experte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!





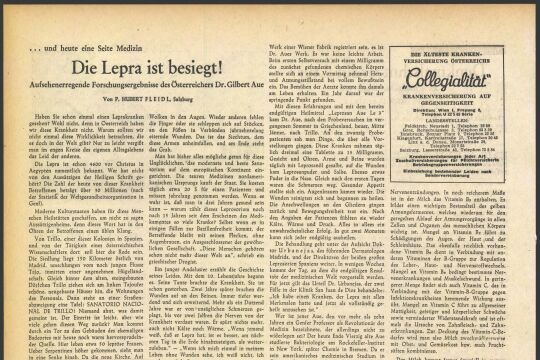
































































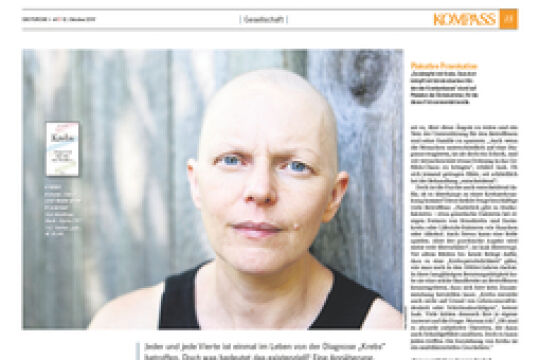



.jpg)