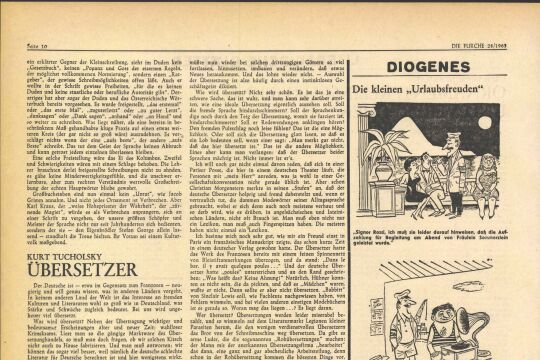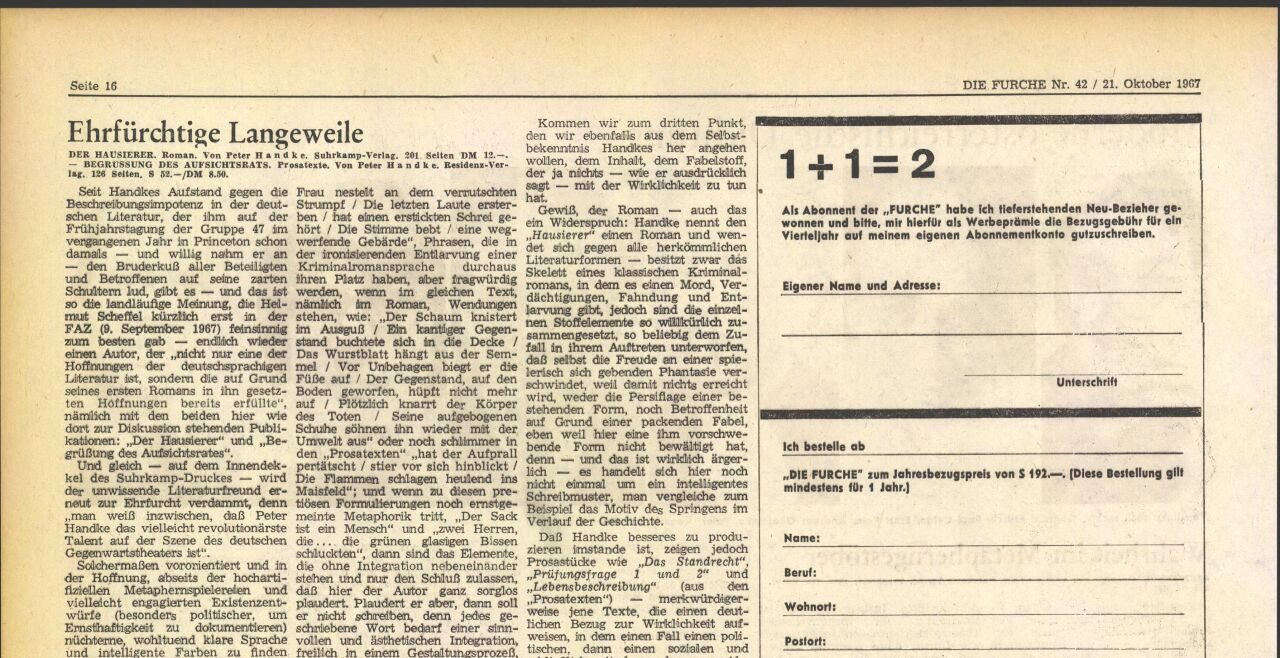
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ehrfürchtige Langeweile
DER HAUSIERER. Roman. Von Peter H a n d k e. Suhrkamp-Verlag. 301 Seiten DM 13.—. - BEGRÜSSUNG DES AUFSICHTSRATS. Prosatexte. Von Peter H a n d k e. Residenz-Verlag. 186 Seiten. S 52.-/DM 8.30.
Seit Handkes A/ufstaind gegen die Besthreibungstapotenz in der deutschen Literatur, der ihm auf der Frühjahrstagung der Gruppe 47 im vergangenen Jahr in Prdnceton schon damals — und willig nahm er an — den Bruderkuß aller Beteiligten und Betroffenen auf seine zarten Schultern lud, gilbt es — und das ist so die landläufige Meinung, die Helmut Scheffel kürzlich erst in der FAZ (9. September 1967) feinsinnig zum besten gab — endlich wieder einen Autor, der „nicht nur eine der Hoffnungen der deutschsprachigen Literatur ist, sondern die auf Grund seines ersten Romains in ihn gesetzten Hoffnungen bereits erfüllte“, nämlich mit den beiden hier wie dort 2ur Diskussion stehenden Publikationen: „Der Hausierer“ und „Begrüßung des Aufisichtsrates“.
Und gleich — auf dem Innendek-kel des Suhrkamp-Druckes — wird der unwissende Literatuirfreund erneut zur Ehrfurcht verdammt, denn „man weiß inzwischen, daß Peter Handke das vielleicht revolutionärste Talent auf der Szene des deutschen Gegenwartstheaters ist“.
Solchermaßen voronientiert und in der Hoffnung, abseits der hocharti-fiziellen Metaphernspielereien und vielleicht engagierten Existenzenb-würfe (besonders politischer, um Ernsthaftigkeit zu dokumentieren) nüchterne, wohltuend klare Sprache und intelligente Farben zu finden (da man ja auch weiß, daß Handke fast sieben Semester Jura in Graz studierte, bevor er sich entschloß, als freier Schriftsteller größeren Ruhm zu erringen), wird die Niedergeschlagenheit bei der Lektüre seiner neuen Prosabücher von Seite zu Seite größer.
Was Handke will, sagte er deutlich in der Zeitschrift „Akzente“ (1966): ..Ich selber bin nicht engagiert, wenn ich schreibe. Ich interessiere miich für die sogenannte Wirklichkeit nicht, wenn ich schreibe ... Wenn ich schreibe, interessiere ich mich nur für die Sprache... Ich schreibe von mir selber.“
Das läßt aufhorchen, denn wer wagt heute schon zu behaupten, er sei nicht engagiert, er würde sich nur der Sprache hingeben; das wäre übelster Sprachästhetizismus, den ja schon die gegen die Jahrhundert-wenideliteraitur tobenden Schriftstel-leir mit Kmdergelalle auszutreiben versucht hatten; das wäre die Rückkehr in einen neuen Elfenbeinturm. Schließlich noch zu behaupten, „Ich schreibe von mir selber“, bringt uns fast in Verlegenheit, haben wir doch damit einen neuen Kafka, dessen dichterische Entwürfe in ihrer Qualität unumstritten sind, eben vielleicht wegen der starken, nur aus sich heraus produzierenden, hinter jedem Text stehenden Existenz.
So radikal dieser Ansatz ist, so radikal wird er in seiner vorliegenden Realisation aufgehoben. Und was bleitot?
Gewiß, das Vorbild Kafka erkennen wir deutlich, besonders leibhaft in den „Prosaitexiten“ und dort in der Erzählung „Das Feuer“, deren Anfang fast alle Motive der Kafkaschen Parabel „Auf der Galerie“ enthält und der 70 Seiten später die Nacherzählung des Romans „Der Prozeß“ mit der Widmung „für Franz K.“ folgt.
Gewiß, die Sprache erzeugt mit Ihrer einfallslosen syntaktischen Grundfigur: Subjekt — Prädikat — Objekt, eine beachtliche Monotonie, den Eindruck einer Wortfläche, in der — so scheint es zunächst — kein einziges Wort herausfällt, sondern stich stets auf gleicher Höhe der anderen hält; das ist sicher ein Zeichen für vorhandenes Sprachgefühl, für die Arbeit am Wort, wenn auch die Lutstlosigkeit des Lesers, verstärkt durch alle Spielarten bekannter rhetorischer Wiederholungsfiguren, von Passage zu Passage am Weiterlesen wächst; das ist nichts Negatives, sondern lediglich der Befund einer ästhetischen Wirkung, die sogar bewirken könnte, eingefahrene Lesererfahrunigen an herkömmlichen Liiteraturformen abzubauen. Doch seihen Wir genauer hin., erwächst die wenig zur Lektüre fesselnde Wirkung aus dem Zerfall der Sprachinhalte. Gemeint ist hier nicht die mit dem Mittel der Beschreibung vorgenommene Zersetzung der Inhalte, Dinge und Handlungen zum Beispiel, und ihre neue, mosaikartige Zugammentfüigung, die interessante Brechungen ermöglicht und damit die Gegenstände leichter durch-schaubar macht, sondern der Zerfall in dieser Bemühung, in diesen Elementen selbst.
Auf der einen Seite will Handke nur beschreiben, die reine Zuständ-lichkeit mit möglichst exakter Sprache abbilden oder Handlungen mit klaren, einfachen Sätzen direkt benennen, ohne daß er methapho-risch einkleidet oder ausdeutet in gefühlsbestimmten Epitheta, das wäre eine sachliche Bestandsaufnahme, die um der Deutlichkeit der Aussage willen begeistern könnte; auf der anderen Seite läßt er sich aber au* AMgemetoplätoe ein wie: „Die
Prau nestelt an dem verrutschten Strumpf / Die letzten Laute ersterben / hat einen erstickten Schrei gehört / Die Stimme bebt / eine wegwerfende Gebärde“, Phrasen, die in der ironisierenden Entlarvung einer Kriminalromansprache durchaus ihren Platz haben, alber fragwürdig werden, wenn im gleichen Text, nämMich ibn Roman, Wendungen stehen, wie: „Der Schaum knistert im Ausguß / Bin kantiger Gegenstand buchtete sich in die Decke / Das Wurstblatt hängt aus der Semmel / Vor Unbehagen biegt er die Füße auf / Der Gegenstand, auf den Boden geworfen, hüpft nicht mehr auf / Plötzlich knarrt der Körper des Toten / Seine aufgebogenen Schuhe söhnen ihn wieder mit der Umwelt aus“ oder noch schlimmer in den „Prosatexten“ „hat der Aufprall pertätscht / stier vor sich hinblickt / Die Flammen schlagen heulend ins Maisfeld“; und wenn zu diesen pre-tiösen Formulierungen noch ernstgemeinte Metaphorik tritt, „Der Sack ist ein Mensch“ und „zwei Herren, die... die grünen glasigen Bissen schluckten“, dann sind das Elemente, die ohne Integration nebeneinander stehen und nur den Schluß zulassen, daß hier der Autor ganz sorglos plaudert. Plaudert er alber, dann soll er nicht schireiben, denn jedes geschriebene Wort bedarf einer sinnvollen und ästhetischen Integration, freilich in einem Gestaltungsprozeß, dessen Gesetze vom Autor vollkommen frei bestimmt werden können.
Findet man auch nirgends mehr die Spur solcher durchgehenden Gesetze (wenigstens das Gesetz der Gesetzlosigkeit, beziehungsweise der ständige Wechsel deutlich geschiedener und somit exakt benennibarer Realisationsstufen) für wen schriebe dann noch der Autor, wen will er ansprechen, wenn kaum einer weiß, was er will., und hat er dann — so stellt sich die Frage — überhaupt etwas zu sagen, spielt er nicht vielmehr Versteck oder versucht dem gutwilligen Leser ein X für ein U vorzumachen. Doch auch das wäre noch ein ganz legitimes Verfahren, bloß etwas würde dann mißfallen, nämlich daß der Autor — wie es Handke tut — sich selbst ernst nimmt.
Kommen wir zum dritten Punkt, den wir ebenfalls aus dem Selbstbekenntnis Handkes her angehen wollen, dem Inhalt, dem Fabelstoff, der ja nichts — wie er ausdrücklich sagt — mit der Wirklichkeit zu tun hat.
Gewiß, der Roman — auch das ein Widerspruch: Handke nennt den „Hausierer“ einen Roman und wendet sich gegen alle herkömmlichen Literaturformen — besitzt zwar das Skelett eines klassischen Kriminalromans, in dem es einen Mord, Verdächtigungen, Fahndung und Entlarvung gibt, jedoch sind die einzelnen Stofieroente so willkürlich zusammengesetzt, so beliebig dem Zufall in ihrem Auftreten unterworfen, daß selbst die Freude an einer spielerisch sich gebenden Phantasie verschwindet, weil damit nichts erreicht wird weder die Persiflage einer bestehenden Form, noch Betroffenheit auf Grund einer packenden Fabel, eben weil hier eine ihm vorschwebende Form nicht bewältigt hat, denn — und das ist wirklich ärgerlich — es handelt sich hier noch nicht einmal um ein intelligentes Schreibmuster, man vergleiche zum Beispiel das Motiv des Springens im Verlauf der Geschichte.
Daß Handke besseres zu produzieren imstande ist, zeigen jedoch Prosastücke wie „Das Standrecht“, „Prüfungsfrage 1 und 2“ und „Lebensbeschreibung“ (aus den „Prosatexten“) — merkwürdigerweise jene Texte, die einen deutlichen Bezug zur Wirklichkeit aufweisen, in dem einen Fall einen politischen, dann einen sozialen und schließlich mit dem gelungenen Abbau religiös-mystischer Glaubensherrlichkeit einen ethischen.
Heinz Piontek (Welt der Literatur 12. Mai 1966) und Wolfgang Werth (Die Zeit, 17. Juni 1966) hofften noch in ihrer vernichtenden Kritik der „Hornissen“, dem Romanerstling Handkes, daß das zweite Buch das „Vixierrätsel Handke“ lösen helfen könnte; vielleicht — so dürfen wir jetzt vermuten — ist unsere Ratlosigkeit nicht ganz unibegründet, weiß einfach dieser junge Autor noch nicht, wie er sein — ganz sicher richtiges — Unibehagen an unserem heutigen Literaturbetrieb mit einem Gegenenitwurf umsetzen und zu einer echten Sensation werden könnte. Vorläufig bleibt uns nur ehrfürchtige Langeweile.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!