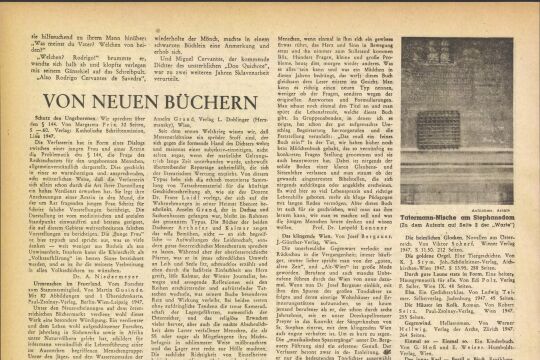Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Festival in Hemdsärmeln
In Berlin hatte man schon seit jeher eine gewisse Schwache für intellektuelle and sonstige Extravaganzen. Trotzdem setzte es den Kenner der Mentalität dieser Stadt und ihrer Bewohner einigermaßen in Erstaunen, zu erleben, daß man gerade an diesem Platz, wo der einzelne beinahe täglich die „Segnungen“ kommunistischer Ideologie und Realität am eigenen Leibe verspürt, ein im Grunde doch entscheidend der künstlerischen und ästhetischen Auseinandersetzung zugedachtes Filmfestival von einer sich radikal gebärdenden Minderheit zu einer politisch-weltanschaulichen Demonstration ultraroter Färbung ummanipulieren Meß.
In Berlin hatte man schon seit jeher eine gewisse Schwache für intellektuelle and sonstige Extravaganzen. Trotzdem setzte es den Kenner der Mentalität dieser Stadt und ihrer Bewohner einigermaßen in Erstaunen, zu erleben, daß man gerade an diesem Platz, wo der einzelne beinahe täglich die „Segnungen“ kommunistischer Ideologie und Realität am eigenen Leibe verspürt, ein im Grunde doch entscheidend der künstlerischen und ästhetischen Auseinandersetzung zugedachtes Filmfestival von einer sich radikal gebärdenden Minderheit zu einer politisch-weltanschaulichen Demonstration ultraroter Färbung ummanipulieren Meß.
Von den dreißig Wettbewerbsfilmen aus 15 Nationen trugen etwa die Hälfte in Form und Inhalt den Stempel dieser unter dem Schlagwort „progressiv“ angepriesenen Gesinnung, die überdies mit einer optisch sich ungehemmt auf der Leinwand austobenden Sexualität und Brutalität Hand in Hand geht. Diese zumeist von pubertär-unausge-gorenen Regungen beeinflußten Exzesse aber vollziehen sich unter dem Signum des Rechtes auf demokratische Freiheit und mit dem Anspruch auf künstlerische Wertung. Hier aber liegt der entscheidende und neuralgische Punkt dieser Entwicklung, den gerade die 19. Berlinale in ihrem von besten Absichten getragenen Bemühen um eine möglichst fortschrittliche und moderne Haltung in seiner unterschwelligen und gefährlichen Demagogie besonders deutlich sichtbar werden ließ. Denn es wird mit einem Freiheitsbegriff operiert, der einem schrankenlosen Sichausleben gleichgesetzt wird, statt seinen jugendlich-provokanten Propheten ins Gedächtnis zu rufen, daß Freiheit bei individueller Selbstbeschränkung ihren Anfang nimmt. Ebenso absurd aber mutet es auch an, bei vielen dieser von politischen Schlagworten und Phrasen durchzogenen Machwerke von Kunst zu sprechen. Wohl die treffendste Antwort zu diesem Problem hat der deutsche Innenminister Ernst Benda anläßlich der jetzigen Verleihung der Bundesfllmpreise in der Berliner Akademie der bildenden Künste gefunden, als er zur künstlerischen Be Wertung eines Films meinte: „Wicht jeder Film muß sich dieser Frage stellen. Fr kann nur agitieren, er kann versuchen, allein Tabus einzureißen und Gesellschaftskritik zu üben. Der Film ist ein Medium, das sich trefflich zu solcherlei Dingen eignet, und es ist jedermanns gutes Recht, sich — im Rahmen des Gesetzes — dieser seiner spezifischen Möglichkeiten zu bedienen. Nur kann dann nicht von Kunst die Rede sein.“ Eine Feststellung, die auf viele der
während der zwölf Tage gezeigten Fülme, ganz besonders aber auf den von Jean-Luc Godard hier zur Welturaufführung gebrachten Streifen „Die fröhliche Wissenschaft“ zutraf. Mit einer geradezu diabolischen Freude scheint Godard, das seit Jahren verhätschelte Wunderkind der Berlinale, seinen faszinierten Gönnern an der Spree, dieses Kuckucksei ins Nest gelegt zu haben, um zu eruieren, welches Maß von Unsinn und Langeweile man einer eingeschworenen und daher urteils-losen Bewundererschar zumuten kann, ohne daß sie sich gegen eine solche geistige Verhöhnung auflehnt. Kunterbunt und verworren mischt er in seinem Film Elemente der Pop-art und Collagen mit einem ebenso unklaren, oft sinnlosen Kommentar, den der junge und sympathische Jean-Pierre Leaud sowie Juliette Berto über große Strecken mit der Monotonie von Markthändtem her-unterhaispeln. Eine kommunistisch angehauchte Phraseologie, völlig allen optischen Gesetzen des Films widersprechend, breitet sich mit ermüdender Langeweile aus. Minutenlang bleibt mehrmals die Leinwand dunkel, und die statische Kamera hält die beiden Kommentatoren in Einstöllungen fest, die sich kaum verändern. Ein Antifilm, wie er im Buche steht, vielleicht eine intellektuelle Farce, nur geboren aus dem Bestreben, die Umwelt zu schockieren und alle bisherigen Formen filmischen Schaffens ziu zertrümmern. Trotzdem wird es sicher zahlreiche Menschen geben, die in dieses ver-schmockte Oeuvre Erkenntnisse und Aussagen hiineingeheimnissen werden, worüber sich Godard im stillen Kämmerlein köstlich amüsieren wird.
Im Zuge der Umstrukturierung dieses Festivals bestimmten Blue Jeans und Pullis auch das äußere Bild der Veranstaltung. Smokingträger waren von vornherein als Repräsentanten des zu bekämpfenden Establishments suspel.t. Und selbst der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz
wünschte bei dem offiziellen Be-grüßungs- und Schlußempfang nur dunklen Anzug, um ja nicht den Zorn der revolutionären jungen Männer von der APO und ähnlichen Organisationen zu erregen. Man demonstrierte ein „Arbeiterfestival' im schlichten Sparta-Look.
Neu waren auch die öffentlichen Diskussionen, die sich an jede Vorführung anschlössen sowie die Erweiterung der Festspiele durch Vorstellungen mit Wettbewerbsfilmen in drei Kinos der Bezirke Kreuzberg, Wedding und Zehlendorf. Auch hier hatten die Besucher Gelegenheit, sich mit den Regisseuren über die Intentionen ihrer Filme auseinanderzusetzen, was teilweise zu recht aufschlußreichen Konfrontationen führte. Die beiden österreichischen Regisseure Georg Lhotzky und Helmut Pfandler, deren Filme „Moos auf den Steinen“ und „Neurotica“ außer Konkurrenz in der Internationalen Filmschau sowie im Kristallpalast am Wedding gezeigt wurden, machten mit der bohrenden Diskussions-freudigkeit der Berliner Bekanntschaft. Oft verloren sich freilich diese Rededuelle fernab der filmischen Betrachtung in eine ausschließlich politisch und weltanschaulich ausgerichtete Suada.
Mit seiner zum 13. Mal durchgeführten Kulturfilm-Matinee gab Österreich mit gutem Pufolikumserfolg seine zweite filmische Visitenkarte ab. Zu echten Publikumsfavoriten aber wurden die in der Retrospektive gezeigten amerikanischen Film-Musicals aus den dreißiger und vierziger Jahren, bei denen sich die filminteressierten Berliner von den Gegenwartsexperimenten und ihren von Sex und Politik durchsetzten Schocktherapien erholten.
Ehe in Paris
Das Theater in der Briennerstraße Münchens absolviert zur Zeit ein Gastspiel im Wiener Raimundtheater mit dem Stück „Ehe in Paris“. Wie jede Ehe hat auch diese ihre Ehestifter. Serge Veber schrieb ein Lustspiel „Madame, je vous aime“, Peter Loos übersetzte es ins Deutsche, Per Schwänzen textierte es für die musikalische Fassung, und Peter Fenyes schrieb die Musik. Was herauskam, ist trotz des musikalischen Aufputzes auf Dialogen basierendes
Unterhaitungsstück leichtester Art mit dem uralten Thema des Ehedreiecks, das indes durch die Darstellung so viel Frische und Unmittelbarkeit gewinnt und so geschickt aus dem Handgelenk gespielt wird, daß Heiterkeit und Vergnügen des Publikums, durch ständige Überraschungen genährt, bis zum Ende sich steigern und den vollen Erfolg sichern. Ursula Borsodi als das Stubenmädchen Christine ist der Motor durch alle Verwirrungen und Entwirrungen, ein echtes Theatertemperament, das schon durch ihr Vorhandensein elektrisiert. Helga Goal als Madeleine Dubreux eine elegante und überlegene, weil heimlich raffinierte Gattin. Bob Fntnco, der Mann zwischen zwei Frauen, spielt seinen bedrängten, überlisteten, zappelnden Casanova am Rande der Lächerlichkeit, so gut es eben
geht. Gute Figuren von nicht sehr wahrscheinlicher, aber wirksamer Art machen Ellen Frank als Madame Tabry, Mama der Gattin, und Lutz Altschul als Vater des jungen Ehemanns, und auch Walter Mauckner als diskreter Hauswart hat seine guten Szenen, Für die musikalische Begleitung sorgen OUy Gubo, virtuos auf dem Klavier, Wolf gang Hardegg und Herbert Mogg (Hammondorgel), Franz Kraml (Schlagbaß) und Kart Palatzky (Schlagzeug). Für Choreographie zeichnet Leslie Gonda, das Bühnenbild schuf Dettia Fiedler, i Musikalische Einrichtung, Bearbeitung und Regie verantwortet Geza v. Földessy. Sechs Schauspieler und fünf Musiker: sie unterhalten besser (und wohl auch billiger) als mancher groß aufgezogene Pomp. Weil: sie können ihre Sache.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!