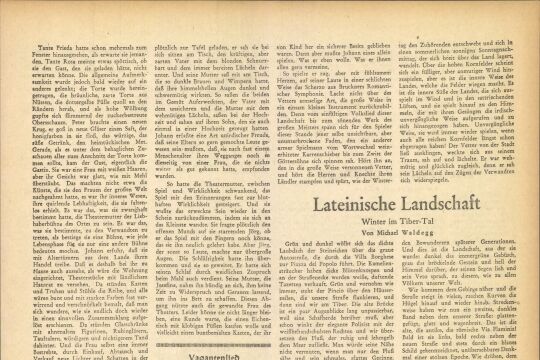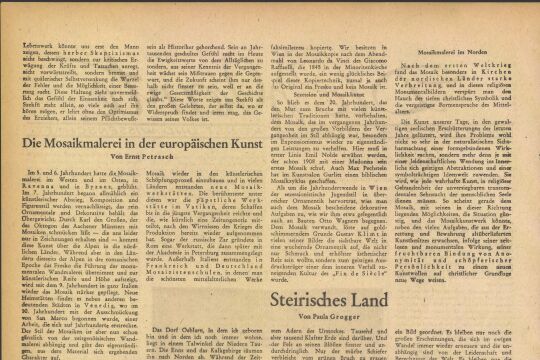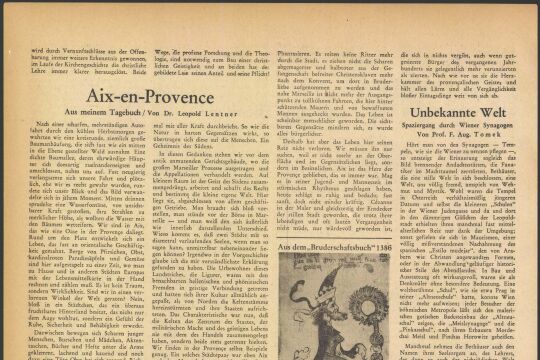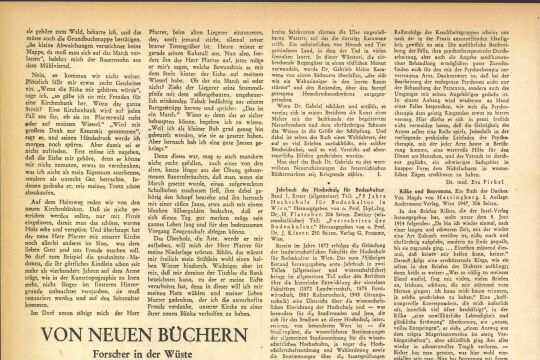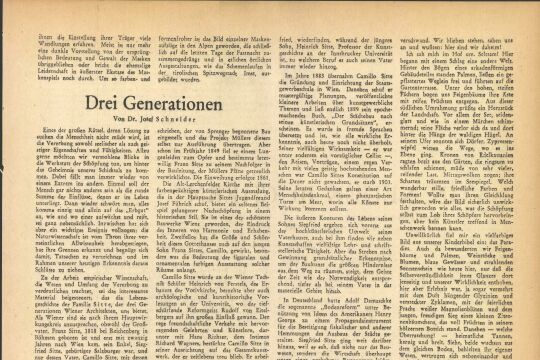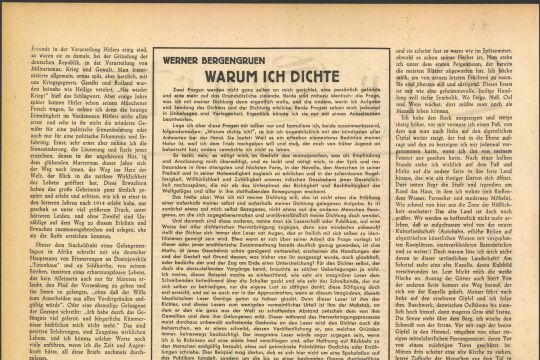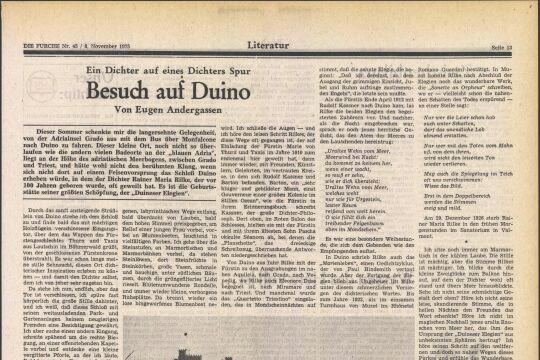Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„... EIN KIND, DAS GEDICHTE WEISS“
Ronda besaß ich in den Träumen. Seit Jahren trug ich ein Photo von einer Stadt auf steiler Höhe mit mir umher. Da gähnten felsige Abstürze, eine abenteuerliche Brücke darüber, die angeblich zwei Teile der Stadt über die Tiefe hinweg verband, den maurischen und den christlichen Teil. Und dann wußte ich seit dem Erscheinen der „Sonette an Orpheus“, daß Rilke hier gewesen ist. In Wochen, die ihm körperlich ernstlich zu schaffen machten und seine Begeisterung für diese „spanischeste der spanischen Ortschaften“ beeinträchtigten. Rilke war nach einem mehrwöchigen Aufenthalt von Toledo gekommen; Madrid hatte er, wie Goethe Florenz, nur gestreift (den Prado bewahrte er sich für die Rückreise). Toledo hatte ihm die Erwartungen, die er in diese Stadt gesetzt hatte, in besonderem Maß erfüllt; sie war ihm der geistige Aufschwung geworden, den er nötig hatte. Sie ließ ihn jubeln und erschauern. Als es ihm hier, im November 1912, zu kalt wurde, ging er nach dem Süden, vorerst nach Sevilla. Doch er wäre nicht der „Dottore sera-fioo“, wie ihn seine mütterliche Freundin Marie Thum und Taxis nannte, gewesen, wenn er nicht gefunden hätte, „daß Ihm die Städte, die zu offenkundig im Ruf der Schönheit stehen, weniger bedeuteten“. So fand er im Dezember 1912 zu dem nahen Ronda, wie er nach Worpswede, nach Borgeby in der Provinz Skäne, nach Duino gefunden hatte, lauter Orte abseits der großen Straßen, in denen er das Fluidum seines Geistes zurückgelassen und die durch ihn bei den Eingeweihten einen Hauch von Poesie empfangen hatten. Er mietete sich in der „Reina Victoria“, einem vornehmen Hotel eines amerikanischen Besitzers, ein, in dem, als ich im vergangenen Frühjahr hinkam, leider kein Zimmer mehr zu haben war.
Aber ich konnte die kaum veränderten Räume betrachten, wo Rilke als einziger Gast am warmen Kamin gesessen haben mag, dessen offenes Feuer er schlecht vertrug; den nun prangenden Garten, der damals vermutlich winterlich öde dalag, denn Rilke hat ihn mit keinem Wort erwähnt, und die großartige Aussicht auf den Felsenzirkus der Serrania, in dessen Mitte Ronda thront.
Aber lassen wir Rilke selbst sprechen; niemand wird es auf so eigene Weise wie er tun: ..Die Ortschaft, phantastisch und überaus großartig auf zwei normale steile Gebirgs-massive hinaufgehäuft, die die enge, tiefe Schlucht des Guadiaro auseinanderschneidet. Die starke reine Luft (es liegt 750 Meter hoch), die über das weithin geöffnete, von Feldern, Steinchen und Ölbäumen freundlich ausgenützte Tal aus dem die spannendste Ferne bildenden Gebirge herüberweht.“ Es muß damals sehr einsam in Ronda gewesen sein, denn auch jetzt im Frühjahr war von Fremden kaum etwas zu merken. Ich begriff auch nicht, wo sich die Gäste der „Reifia Victoria“ aufhielten, die ich nie zu Gesicht bekam und die mir das Wohnen in diesem sympathischen Hotel verwehrten. Aus dieser Einsamkeitsstimmung heraus mußte wohl Rilkes Wunsch geboren werden, Stifter zu lesen, den er bis dahin kaum kannte.
Es kann auch auf andalusischen Höhen im Frjihjahr noch frisch sein — auch in Granada fror man —, und es war nicht nur, wie Rilke schrieb, „in der Frühe Winter und zu Mittag mindestens August“, sondern jede Wolke, die die Sonne verdeckte, brachte eine sehr fühlbare Abkühlung. Dennoch blühte alles in Fülle. Vor meinem Zimmerfenster prangten Bäume mit tausenden violetten Blüten, und im gegenüberliegenden Stadtgarten, der Alameda, standen in der ersten warmen Sonne die frischergrünten Platanen. Flieder und Oleander, unzählige Reihen lavendelblauer Schwertlilien, Pfingstrosen, weiß Gott, eine Fülle von Blumen. Da sind Sittichgehege und Ententeiche zur Schaulust der Kinder. Am Ende des Parks aber gibt die Felsterrasse, der 1952 errichtete „Mirador dos reyes catolicos“, die großartige Aussicht frei über das grünende Land, in der Tiefe mit den blitzenden Schlingen der kleinen Flüsse und den Bergen der Sierra im Hintergrund. Kinder spielen hier oben in der frischen Bergluft und tanzen einen Choro. Ich denke an das Lied der Waisenkinder einer Ktosterschule in Ronda, das in Rilke nachklang, als er eines seiner schönsten Sonette an Orpheus
gestaltete: .....Erde /ist wie ein Kind, das Gedichte weiß,/
viele, o viele .. .Wir wollen dich fangen, / fröhliche Rede. Dem Frohesten gelingt's ... / und was geduckt steht in Wurzeln und langen / schwierigen Stämmen: sie singt's, sie singt's!“
★
Neben den Kindern sitzt eine Gesellschaft von alten Männern auf einer Bank. Auch sie lassen sich von der Sonne wärmen und gleich wieder die frischen Winde um die Ohren wehen. Sie werfen keinen Blick auf das junge Laub und nicht auf die heroische Landschaft rundum. Sie debattieren über die Kunst des Stierkampfes, und immer tritt einer in die Mitte des Kreises und demonstriert die Kampftechnik seines Lieblings unter den Matadoren; er stellt sich in Positur und mimt Angriff und Abwehr. Mit diesen Gesten erlebt man die furchtbaren Stöße, die er mit seinem imaginären Degen dem unsichtbaren Tier versetzt — bis es zusammenbricht. Dann kommt der nächste Alte: „Ich erinnere mich...“, beginnt er.
So vergehen die Tage für die Pensionisten in Ronda, das nicht von ungefähr ganz in der Nähe des Parks den ältesten Bau einer Stierkampfarena in Spanien beherbergt. Sie ist noch teilweise aus Holz, stammt aus dem Jahre 1784 und aoll an dem Tag ihrer Einweihung zusammengestürzt sein. Wieder aufgebaut, verschaffte sie ihrem jugendlichen Helden, dem Rondeser Pedro Romero, weit über die Grenzen des Landes reichenden Ruhm. Er begann als Fünfzehnjähriger, unterwiesen von seinem Vater, die Laufbahn des Torero und verließ sie als Sechsundsiebzigjähriger, nachdem er einen strengen Kanon der Kampfregeln aufgestellt hatte, der heute noch maßgebend ist. Am Eingang des Parks wurde ihm 1954, zweihundert Jahre nach seiner Geburt, ein Denkmal errichtet, dessen Inschrift die ganze Weisheit des Matadors in nuce verkündet: „Immer etwas klüger sein als die Stiere!“ Am berühmtesten vielleicht ist Romero, der sechstausend Stiere in seinem Leben erlegte, durch das Porträt Goyas geworden.
Einige Schritte weiter, am Rathaus vorbei, und am Ende der Neustadt, des Mercadillo, geht es zum Puente Nuevo, den Aldehuela 1761 erbaute. In schwindelnder Höhe überbrückt er mittels dreier kühner Bögen die Felsschlucht. In der Tiefe rauscht der Guadalevin in seinem grünen Bett. Ein schönes, hohes Gitter — die Spanier lieben die Gitter, nicht nur in den Kirchen, auch bei den Schaltern — schützt den
Betrachter vor dem Absturz und soll auch den Selbstmörder zurückhalten. Man kann auch über eine unterirdische Felsenstiege von 365 Stufen, die im Haus des einstigen Mohrenkönigs — er hieß Alumelek — beginnt, in die Tiefe gelangen. Denn der Blick aus dem Tal zur Höhe an den alten Mühlen vorbei, ist ebenso reizvoll.
*
Von der Casa del Rey Moro ist es nicht weit zu den beiden älteren Brücken der Stadt, zur Römerbrücke San Miguel und zur alten maurischen Brücke. Vornehme, nicht auftrumpfende, Paläste stehen hier in La Ciudad, dem maurischen Teil vori Ronda, mit schönen, metallbeschlagenen Toren, gleich neben einfachen, weißgekalkten Landhäusern. Die Wege sind steinig und verlaufen im Zickzack; bei den Brunnen sieht man die Frauen stehen, die Krüge füllen oder beim Warten ihren Plausch absolvieren, wie überall in der Welt.
Die Kathedrale hat noch stark maurische Relikte; ein gotisierter Kuppelbau ist Santa Maria la Mayor. Im Innern überrascht ein interessantes Renaissancechorgestühl. An den Ruinen der alten Maurenburg, der Alcazaba, vorbei führt die Straße in den Vorort San Francisco mit dem doppelten Torbogen, dem romanischen und dem maurischen. Die Straßen sind hier eng, die Häuser schmal und niedrig und oft fast
Höhlen gleich unter dem Straßenniveau. Unzählige Esel kommen einem hier entgegen mit ihren Treibern. Sie bringen die Körbe mit frischem Gemüse aus der fruchtbaren Tiefe in die Stadt, in deren Felswänden Adler horsten und Eulen ihren Wohnsitz haben. Ferkel laufen quiekend über den Weg oder werden gejagt; das Leben ist auf der Straße oder vor den Haustoren wie im Orient. Berber haben hier einst nach den Römern residiert, und Afrika bezaubert heute hier noch den Wanderer durch die Romantik der Architektur und des unbekümmerten Lebens. Nach der Besetzung durch die Almohaden war Ronda dem Königreich Granada Untertan; erst 1485 erzwangen die Konquistadoren, die durch zwanzig Tage mit eisernen Kanonenkugeln (zum erstenmal!) diese schier uneinnehmbare Feste beschossen hatten, die Übergabe.
Ich wandere noch über San Francisco mit seinen malerischen Winkeln hinaus, an einem alten Konvent vorbei, in die Landschaft. Ein Ölbaumhain begleitet hier fruchtbares Ackerland; die Welt ist still, nur Vögel singen, ein Bauer führt den Pflug wie vor tausend Jahren; dort reitet eine junge Frau auf einem Maultier, ihr roter Rock leuchtet aus der Ferne... Pinien stehen auf dem Berghang ... Der herbe Duft von Feldblumen erfüllt die Luft... Die Sonne blendet nicht; man atmet tiefer hier, fern von den Zeiten, die auch Ronda nicht übersehen haben... In solcher Traumverlorenheit stehe ich, umsponnen von Gedanken... „Die Erde ist wie ein Kind, das Gedichte weiß, viele, o viele.“ Langsam nur wende ich mich wieder am Ende des Tages der Stadt zu.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!