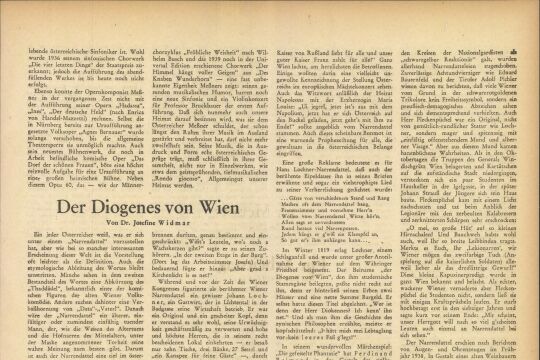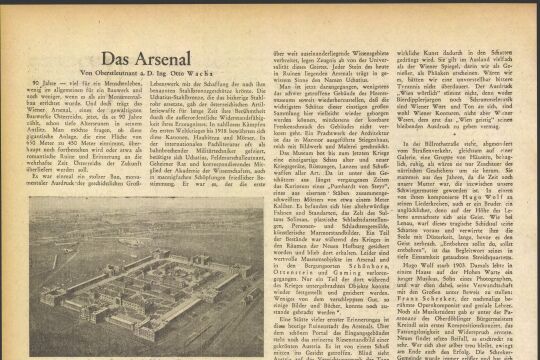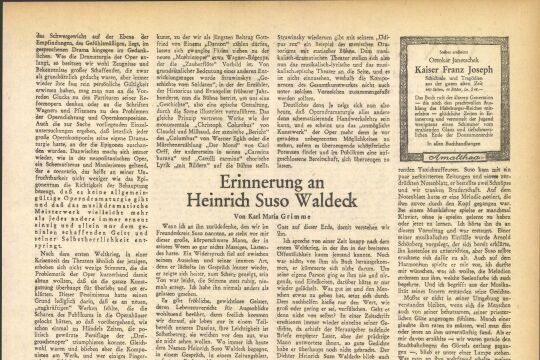Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Liddd — drei, vier!
Bemüht, ständig Kontakt mit der Oeffentlich- keit und den Jugendverbänden zu halten, hat die Wehrpolitische Abteilung des Bundesministeriums für Landesverteidigung eine Enquete veranstaltet und den Entwurf des 72 alte und 12 neue Kompositionen enthaltenden Soldatenliederbuches vorgelegt. Die darüber entbrannte Diskussion war lebhaft. So beschloß man, nochmals zu prüfen, zu sichten, ehe die Truppe singend weiter durch die Straßen zieht.
Irgendwo steht es geschrieben: die alten Germanen pflegten bei ihren Angriffen zu singen, um die Römer zu erschrecken. Dieser Kriegsgesang, der ältest bezeugte Vorfahre soldatischen Massensingens, bewies, daß singende Truppen partout kein Opemchor sind. Singen war fast nie Selbstzweck. Die Wehrmacht des Dritten Reiches bediente sich des Gesanges in hohem Maße, darum hing er den unfreiwillig Singenden bald zum Halse heraus. Immer singen: in der Nacht („Frühmorgens, wenn die Hähne krähn“), beim Marschieren („Ein Heller und ein Batzen“), unter der Gasmaske („Es ist so schön, Soldat zu sein“), auf den Bäumen („Im tiefen Keller sitz ich hier“). Das permanente Singen gehörte damals zum nur von Sondermeldungen und Volkskonzerten unterbrochenen Alltag. Wo immer Menschen eine Uniform trugen, ertönte bald eine ölige Grölstimme: „Ein Liddd — drei, vier!“ Herms Niels ungeschlachte Schöpfungen, Liebe, Tod und Botanik, die Weltanschauung, wurden durchgesungen: es war ein Parforceritt durch die Jahrhunderte. Sang die Truppe nicht laut genug, hieß es: „Was, Ihr wollt nicht! Nach rechts weg, marsch, marsch!“ Prustete man falsch, was bei Sturmgepäck, umgehängten MG-Gurten und dergleichen Geschirr die Regel war, hieß es: „Wollt ihr wohl die Schnauze halten!" Hielten sie die Marschierer, donnerte die Stimme: „Wollt Ihr wohl die Schnauze aufmachen!“ Da es die einzige Gelegenheit war, sie aufzumachen, brüllte man eben los. Den banalen Texten der NS- Ruhmesredner legte die Truppe einen banalen, aber unpolitischen, zuweilen obszönen. Jext unter. Jeder, der einmal einen Brotbeutel trug, weift davon- „ein Lied «zuAsingen“. Daß-die singenden Kolonnen unseres Bundesheeres die angestauten Ressentiments ausbaden müssen, ist traurig.
Wozu und zu welchem Zweck wird denn in einem Heer musiziert und gesungen? In der Tat, eine angesichts der Vollmotorisierung doppelt berechtigte Frage. Die alten Diener wissen es. Aus dem Brücker Lager marschierten sie hundemüde nach Wien zurück. Am Stadtrand wartete die Regimentskapelle, und nach dem Trommelwirbel vor dem Einsetzen der Marschmusik (12 Takte tiefe Trommel, 12 Takte höhere Trommel, sechs Takte hohe Trommel, fünf mächtige Paukenschläge) riß es auch den müdesten Marschierer hoch. Der Schönfeld-Marsch, der 84er Regimentsmarsch, das ging ins Blut. Also Stimulanz, zugleich Betäubung. Die Sätze aus der Selbstbiographie Comte de Vėlans sind psycho logisch aufschlußreich: „Ich habe magische Musik seit Strawinsky oft und oft… empfunden als eine sehr unangenehme Beeinflussung, ja Hemmung des freien Willens, der sich durch die dumpfe Eintönigkeit der Musik betäubt und gebannt fühlte. Eben diese Empfindung war es auch, die sich mir seitdem stets bei preußischer Militärmusik und dem Gleichschritts- und Paradestampfen auf drängte.“ Am anschaulichsten kann man das in Ernst v. Salomons „Kadetten“ nachlesen, wo er den Auszug der Karlsruher Leibgrenadiere im August 1914 schildert. Die militärmusikalischen Möglichkeiten könnten aber durch diese Beispiele leicht mißdeutet werden. Eugen Rosenstock zum Beispiel hat den deutschen Männergesang sehr richtig mit der Stimmung des Bismarck-Reiches in Zusammenhang gebracht: alles sei so militärisch, exakt, geordnet, mächtig und drückend gewesen. Stimmt nur teilweise, weil das weiter zurückreicht in die Freiheitskriege, Sturm und Drang, und zum Gemeindegesang der Reformationszeit. Im Heere selbst hatte man weniger gesungen, als gemeinhin angenommen wird, es sei denn „Fern bei Sedan" im „Argonnerwald um Mitternacht“.
Im ersten Weltkrieg stand das landsmannschaftliche Liedgut im Vordergrund. Bayern, Preußen, Hessen und Rheinländer konnten, wie alle deutschen Stämme, auf ein reiches Repertoire verweisen mit viel Juvivallera und Hussasa. Zum Marschieren geeignete Lieder standen, was bemerkenswert ist, in krassem Mißverhältnis zu den zahlreichen bedächtigen Weisen. Aber auch das echte Volkslied ging zurück, der Massengesang fand schon vor dem ersten Weltkrieg seine Kritiker. Man erinnere sich an die schöne Geschichte Ludwig Thomas von dem Professor, der Volkslieder sammeln ließ: „Singen denn eure Burschen nicht?“ — „Ja scho, bal’s bsuffa san!“ Von da, über „SA marschiert“ bis zu den heruntergelassenen Hosen der Possenreißer (Trula- la) in „08 15“, erster Teil, war der Weg gepflastert mit tausend Unarten.
Ob man in der k. u. k. Armee viel gesungen habe, fragten wir einen alten Oberst. Ja, schon, aber im Unterstand. Als das 1. Tiroler Kaiserjägerregiment etwa bei Tarnoczyn 1914 ein schweres Waldgefecht bestanden hatte, stieg „am Abend, aus tausend Tiroler Kehlen gesungen, das Kaiserlied durch das wolhynische Gehölz“. Bei der Musikalität der Völker Altösterreichs war Singen selbstverständlich. Bei Rawa- ruska sangen die Tschechen sogar das „Kde domov muj“ (was schon Kronprinz Rudolf mochte), die Ungarn oft den Gassenhauer „Körösi lany“, slowenische Truppen gern das „Brambovska dobra volja“. Auf den Ortler schleppten die Tiroler gar eine Zither mit, eine Geige kratzte am Isonzo. Aber einem schwerbepackten Marschbataillon das Singen zu befehlen, nein, das blieb dem Dutzendjährigen Reich vorbehalten. Damit wurde auch der Soldatengesang ad absurdum geführt. Altösterreichs Militärmusik, zündend und feurig und weltberühmt, wurde stets, was bei der Mehrsprachigkeit verständlich ist, dem Gesang vorgezogen. Die k. u. k. Armee hatte die schönsten Signale, komponiert hat sie Michael Haydn. Ein österreichisches Hornsignal kündigt im „Fidelio“ Freiheit und Erlösung an. Die Signale! „Das in Musik gesetzte Räkeln und Gähnen der Reveille, der helle Generalmarsch, der musikalische Rippenstoß des „Habt acht!“, das Herzklopfen des Sturmsignals, das heiter resignierte Achselzucken des, „Abblasens“ (Friedländer). Ja in einem Land, in dem noch aus Stempelkissen Musik erwuchs (bekanntlich fiel Ą. W. Jurek die Melodie gum Deutsciimeister-Regimentsmarsch beim Stempeln der Urlaubscheine ein), konnte man getrost auf das Kommando „Ein Liddd- — drei, vier!" verzichten.
Die Diskussion enthüllte die ganze Unsicherheit in Fragen militärischer Tradition. Darum spielte man die neuesten Lieder vor, zu deren Komposition das Bundesheer aufgefordert hatte. Es waren ihrer zwölf. Sie glichen einander wie ein Ei dem anderen. Textlich: ein Gang durch die öden Rieselfelder der Sprache. In sentimentalem Latschendeutsch kehrten Berge, Gipfel, Pfade und Matten periodisch wieder. Sie hätten kolorierten Rührschnulzen wie dem „Wilderer vom Silberwald“ gewiß adäquate Untermalung gegeben. Aber für eine Truppe? Dem bekannten Dichter trockener Lyrik Artmann, hätten sie allesamt den Ruf entlockt: „Vü zvü Schmoiz!“ Es war einfach nichts drinnen. Melodie und Rhythmus konnten den Zeitgeist schwer verleugnen. Daß man den „Westerwald“ auf den „Index“ setzte und anderen räudigen Schafen aus dem NS-Pferch auf den Zahn fühlte, ist höchste Zeit. Warum die „Blauen Dragoner“ — wenn überhaupt — plötzlich zu den „Hügeln“ und nicht mehr zu den „Dünen“ hinaufritten, blieb allerdings in Dunkel gehüllt. Es zeugte aber für das geistige Niveau eines emsigen jungen Teilnehmers, wenn er fragte, wer denn „Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd“ gedichtet habe. Es zeugt für die Antwort, die gelautet hat: „Friedrich Schiller, ,Die Räuber'." lind das im Schiller-Jahr! „Vater, ich rufe Dich“ das berühmte Gedicht Körners, war vielen Jungen fremd gewesen.
Soldatenlieder zu dichten, kann man nicht befehlen — eine Binsenwahrheit, steht doch bei den populärsten und zugleich ältesten von ihnen der Vermerk: „Verfasser unbekannt.“ Typisch dafür ist die Entstehung des berühmtesten österreichischen Soldatenliedes. Ein Trompeter beim Kürassierregiment Herberstein dichtete und komponierte das Lied vom „Prinzen Eugen, dem edlen Ritter" und sang es fünf Reitern, die mit ihm auf Patrouille waren, in einem Dickicht am Saveufer vor — und bald sang es die ganze Armee … Man kommandiere also um Himmelswillen nicht den Gesang, sonst könnte es geschehen, daß die Soldaten ihren Ausbildern etwas pfeifen — etwa den River-Kwai-Marsch.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!