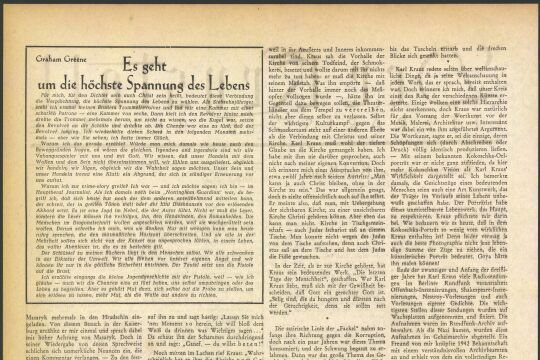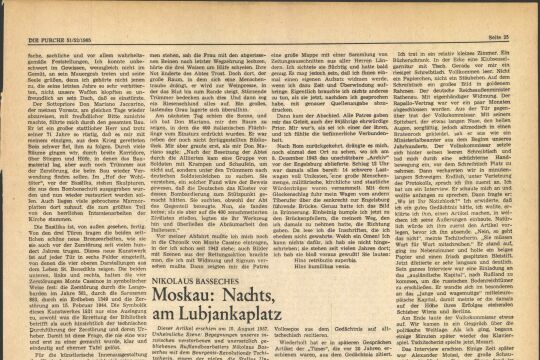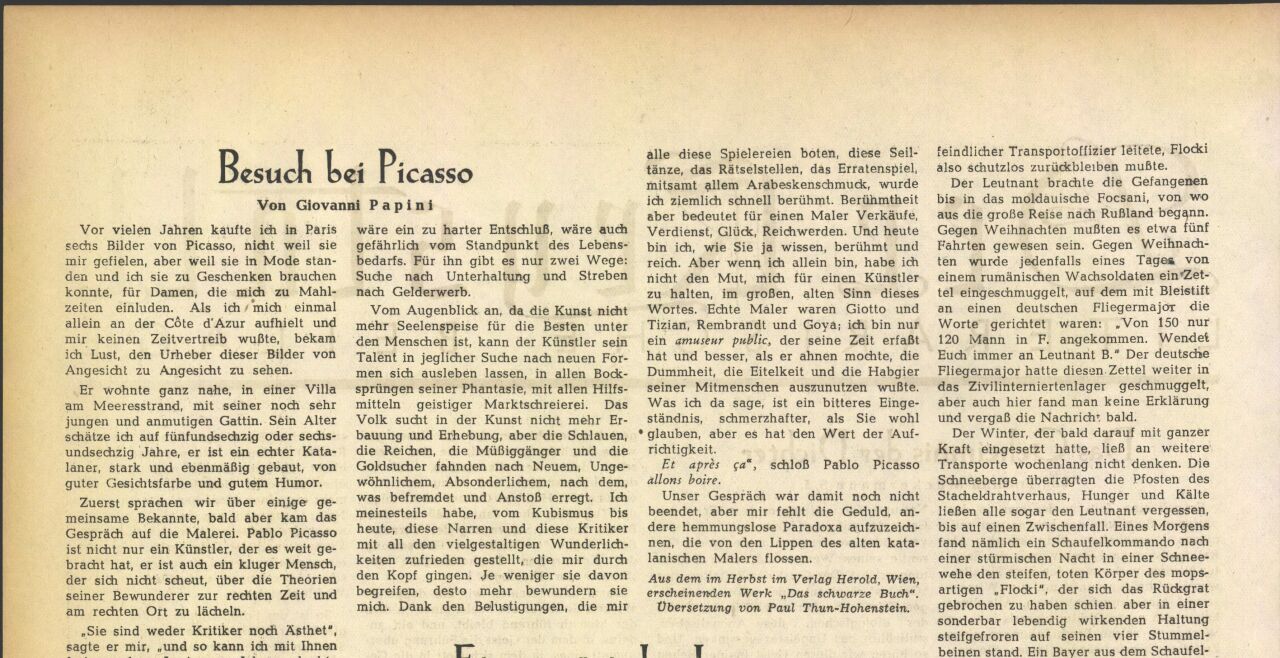
Daß eigentlich niemand genau wußte, wieviel Offiziere dem Lager zugeteilt waren, mochte zum Teil daran liegen, daß Kriegsgefangene und Zivilinternierte gewissermaßen getrennt verwaltet wurden, vielleicht aber noch mehr daran, daß in jenen Monaten, die zwischen der Waffenstreckung, der russischen Besetzung und dem Ende des Königreiches Rumänien lagen, nicht nur in Armee und Kriegsministerium laufend personelle Veränderungen stattfanden. Aber die erstaunliche Tatsache, daß der Leutnant im Generalstab Grigore B. von Anfang an bis zur Auflösung oder, besser, zur Verwandlung des Kriegsgefangenenlagers in ein solches für politische Häftlinge der Kommandantur angehörte, beschäftigte die Gefangenen weit weniger als die Person des Leutnants selbst. Denn, so erstaunlich es klingen mag, nicht die Offiziere der Roten Armee, ihre Autohupen, die den verlassenen Haufen immer in panische Angst vor der Verschickung nach Osten versetzte, nicht der Hunger, die Hitze, das Ungeziefer, die Krankheiten oder die quälende Sorge um Heimat und Familie machten diese paar tausend Gefangenen zu einem Lager, sondern der Haß gegen diesen jungen Leutnant des Generalstabs. Und was vielleicht noch verwunderlicher war: nicht nur die gefangenen Soldaten, Diplomaten, Frauen und Kinder haßten ihn, auch die Wache und die Offiziere, vom Kommandanten bis zum dicken, skatspielenden Reservehauptmann Slatineanu, konnten ihn nicht leiden, ja selbst der gefürchtete russische Oberst vermied es, ihm im Zeichen der neuen Bundesgenossenschaft jemals die Hand zu geben.
Von den Gefangenen kannte ihn niemand näher, auch keiner der zahlreichen Offiziere, die hier auf ihre Deportation warteten. In der Kommandantur aber wußte man nicht mehr, als daß Leutnant B„ ein Moldauer und Sohn eines früh- verstorbenen Diplomaten, über ausgezeichnete Beziehungen verfügte, die erstaunlicherweise den politischen Wetterstürzen standzuhalten schienen. Er selbst sprach nie über sich selbst und noch weniger mit den Gefangenen. Klein, fein- knochig, das blauschwarze, glänzende Haar sorgfältig gescheitelt, die Uniform ohne jeden Tadel und sichtlich dem ersten Salon der Haupstadt entstammend, die Lackstiefel mit blitzenden Sporen ohne Stäubchen oder Schmutzspritzer, die Waschlederhandschuhe in blendendem Weiß, pflegte er seine Inspektionsrunden durch das Lager nie ohne Reitpeitsche zu unternehmen, mit der er nachdrücklich seinen Befehl zu unterstreichen wußte, daß die Gefangenen, gleichgültig ob Mann oder Frau, Kind oder Greis, Legationsrat oder Küchenhilfe, ihn in militärischer Habtachtstellung zu grüßen, ansonsten aber nicht zu belästigen hätten. Spielende Kinder wies er mit der gleichen Gerte aus seinem Weg, ohne sie je eines Blicks zu würdigen, wie er auch peinlich vermied, mehr als mit einer lässigen Bewegung seiner Hand zur Mütze die spöttischen, devoten oder bewußt nachlässigen Grüße zu erwidern. Klagen über die mangelhafte Verpflegung, das Fehlen von Verbandstoff für die Verwundeten, von Milch für die Kinder, von Seife oder Medikamenten quittierte er stets mit dem stereotypen Satz: „Sie sind Gefangene und haben keine Wünsche vorzubringen“, wobei er unter seinem dünnen Schnurrbart spöttisch zu lächeln schien und seine makellose Zahnreihe zeigte. Als er eines Tages, in Hörweite dreier Sowjetoffiziere, einen blinden deutschen Soldaten, der von seiner Bank nicht rechtzeitig aufsprang, mit „deutsches Schwein“ titulierte, schien das Maß voll. Jedenfalls rebellierte die Hälfte der Kriegsgefangenen und drohte mit Hungerstreik, was erst nach einer drohenden Ansprache des rangältesten Russen verhindert werden konnte.
Zu dem Haß gegen den jungen Leutnant kam kurz nach dem ersten Schneefall noch der Hohn. Von dem runden Dutzend streunender Hunde, die die Zigeunerviertel mit der näheren und nächsten Umgebung der Barackenstadt vertauscht hatten, hatte ein mopsartiges, fast weißes Etwas anscheinend Gefallen an dem Leutnant gefunden und wich ihm trotz zu kurzer, verkümmerter Beine und asthmatischem Gekeuche nicht von der Seite. Weder Drohungen noch Reitpeitsche halfen: der bildschöne Leutnant mußte sich dem kaum verhohlenen Gelächter der Gefangenen aussetzen, die das kleine Vieh „Flocki“ riefen und keine Gelegenheit ausließen, um es mit Steinen, Erdbrocken oder Unrat zu bewerfen und zu verjagen. Erst recht dann, als die Deportationen einsetzten, die zum Entsetzen der Betroffenen, aber zur Erleichterung der Hinterbliebenen der Leutnant Grigore B. als mehr als zuverlässiger, betont deutschfeindlicher Transportoffizier leitete, Flocki also schutzlos Zurückbleiben mußte.
Der Leutnant brachte die Gefangenen bis in das moldauische Focsani, von wo aus die große Reise nach Rußland begąnn. Gegen Weihnachten mußten es etwa fünf Fahrten gewesen sein. Gegen Weihnachten wurde jedenfalls eines Tages von einem rumänischen Wachsoldaten ein’Zet- tel eingeschmuggelt, auf dem mit Bleistift an einen deutschen Fliegermajor die Worte gerichtet waren: „Von 150 nur 120 Mann in F. angekommen. Wendet Euch immer an Leutnant B.“ Der deutsche Fliegermajor hatte diesen Zettel weiter in das Zivilinterniertenlager geschmuggelt, aber auch hier fand man keine Erklärung und vergaß die Nachricht bald.
Der Winter, der bald darauf mit ganzer Kraft eingesetzt hatte, ließ an weitere Transporte wochenlang nicht denken. Die Schneeberge überragten die Pfosten des Stacheldrahtverhaus, Hunger und Kälte ließen alle sogar den Leutnant vergessen, bis auf einen Zwischenfall. Eines Morgens fand nämlich ein Schaufelkommando nach einer stürmischen Nacht in einer Schneewehe den steifen, toten Körper des mopsartigen „Flocki“, der sich das Rückgrat gebrochen zu haben schien aber in einer sonderbar lebendig wirkenden Haltung steifgefroren auf seinen vier Stummelbeinen stand. Ein Bayer aus dem Schaufelkommando schlug nach diesem alle belustigenden Fund vor, „Flocki“ auf ein Brett zu stellen, mit Reisig zu garnieren und dem Leutnant sozusagen eisgekühlt in seiner Schreibstube zu servieren. Derselbe Bayer erzählte später tagelang, welch blödes Gesicht der schöne Leutnant gemacht hätte, wie er den eisigen „Flocki“ wie ein zerbrechliches Gefäß auf den Boden gestellt und dann — anstatt zu schimpfen, wie alle erwarteten — auf Deutsch gesagt hätte: „Vielen Dank, meine Herren, für die Aufmerksamkeit!“
Fünf oder sechs Monate später erfuhren einige wenige Internierte anläßlich des Besuchs einer Rotkreuzkommission, deren Leiter sich nach dem Leutnant B. erkundigte, einiges über diesen. Es stimmte, daß sein Vater als Diplomat fast sein ganzes Leben im Ausland verbracht hatte. Seine Mutter, eine in Syrien geborene Französin, hätte ihn in einem Stambuler katholischen Internat erziehen lassen, wäre später, während er die berühmte französische Offiziersschule St-Cyr besuchte, in seiner Nähe gewesen, lebe aber seit kurz vor Kriegsbeginn als Witwe bei ihren Eltern in Damaskus. Im Generalstab hätte der Leutnant vornehmlich als Dolmetsch gearbeitet, eine große Karriere dürfte ihm jedoch nicht beschieden sein, weil er sich aus unerklärlichen Gründen freiwillig für das Gefangenenlager gemeldet hatte, anstatt nach Ende des deutsch-rumänischen Bündnisses die Konjunktur auszunutzen.
Nicht lange vor der Heimkehr der Österreicher geschah dann das völlig Unerwartete. Eine russische Kommission begann eines Tages wahllos Zivilinternierte und Kriegsgefangene nach dem Leutnant auszufragen, merkwürdige Fragen, die niemand beantworten konnte, und wenige Tage später konnte ein Schreiber in der Kommandanturbaracke im Monitorul Ofi- cial lesen, daß der königlich-rumänische Leutnant Grigore B. wegen Zusammenarbeit mit dem Feind degradiert und zu zwanzig Jahren Festung verurteilt worden sei.
Auf dem Heimtransport erfuhren die Österreicher dann Näheres: nämlich, daß der Leutnant Grigore B., lange bevor der erste deutsche Gefangenentransport nach Focsani von ihm durchgeführt wurde, an bestimmten Stellen der Bahnlinie mit wenigen Vertrauensleuten Fluchtstationen für die deutschen Kriegsgefangenen geschaffen hatte, und zwar meist in der Nähe kleinerer Orte, wo Zivilkleider, Lebensmittel, kleine Vokabelhefte und rumänische Führer durch Siebenbürgen bis nach Ungarn bereitgestellt waren. Hunderte von deutschen Kriegsgefangenen seien auf diese Weise nie in Focsani angekommen, wo ihre Flucht durch sorgfältig gefälschte Listen erst nach rund einem Jahr aufkam, ja noch mehr: der Leutnant hatte in verschiedenen Dörfern der Moldau, vermutlich bei Verwandten und zuverlässigen Bekannten, Plätze für eine beträchtliche Anzahl von deutschen Soldaten organisiert, wo schwächliche oder ältere Unterschlupf fanden, meist als Landarbeiter, und wo man hoffte, sie wenigstens eine Weile vor Zugriff zu schützen. Sowohl Bojarenfamilien wie kleine moldauische Bauern hatten ihre bereitwillige Hilfe angeboten und ihre Versprechen gegenüber dem Leutnant lückenlos gehalten, obwohl Angst schon damals in Lande herrschte.
Durch einen jener gar nicht seltenen, oft fast wunderbaren Zufälle, die die Verbindung zwischen uns und dem Schweigen der vergessenen verbündeten Länder von einst hier nicht abreißen lassen, wuide einem, kleinen Kreis Weiteres über das Schicksal des ehemaligen königlich-rumänischen Leutnants Grigore B. bekannt. Vielleicht auf Grund der Interventionen, die seine Mutter über die türkische Gesandtschaft in Bukarest anstellte, vielleicht auf Grand irgendeines Erlasses, wurden Grigore B. mehr als vierzehn Jahre seiner Festungshaft erlassen, das heißt in Zwangsarbeit verwandelt, über einen unbekannten Mittelsmann erreichte ein erstaunlicherweise ausführlicher Brief den Rektor seines ehemaligen Internats in Stambul mit der Bitte, seine Mutter zu suchen und zu verständigen, falls sie noch lebte.
Dem Rektor gelahg es. diese Bitte zu erfüllen. Gleichzeitig schien ihm der Brief und das Schicksal Grigore B.s aber geeignet, seinen Zöglingen bekannt zu werden, unter denen sich der kleine Sohn eines deutschen Kaufmanns befand, der 1944/46 in jenem Lager interniert war.
In dem Brief versuchte Grigore B. eingangs, dem Pater RektoV die Erinnerung an ihn zu erleichtern, um so mehr, als zwischen ihm und dem katholischen Internat seit dem Ende der Schulzeit keine Verbindung bestanden hatte. Dieser Einleitung folgte eine kurze Entschuldigung, des Französischen nicht mehr vollkommen mächtig zu sein, da die Jahre innerhalb der nassen Kerkerwände von Jilava viel Schönes und viel Wertvolles seiner Jugend verschüttet hätten. Nicht aber das Wichtigste, das. neben der Bitte, seine Mutter zu verständigen, der Anlaß seines Briefes wäre, den er, weniger einer Notlage als einem echten, inneren Antrieb folgend, an seinen ehemaligen Lehrer richte. Um ihm zu sagen, daß er seine Berufswahl nie bedauert habe, daß er aber, obwohl dies vielleicht nur ein Rumäne, der sein armes Land liebe, verstehen könne, erst sehr spät seinen Offizierseid auf Gott und König verstanden hätte. Das heißt einmal von jenem Tage an, an dem er der großen Tradition von St-Cyr getreu selbst das Kommando über sich zu übernehmen vermeinte, indem er zu den Gefangenen ging, zum andern aber vom Tage seiner Degradierung und Verurteilung an, an dem er in Erinnerung an seine Kindheit das Kommando über sich selbst von neuem und für immer dem Herrn dieser seiner Kindheit übergab. Dies zu melden wäre der eigentliche Grund und Zweck seines Briefes, ehe er getrosten Herzens seinen Zwangsarbeitertransport in die Schwarzmeer-Kanalzone erwarte, als die Einberufung zu einer neuen, großen Armee, deren Ehre er einem andern König anheimstelle, nicht weniger aber dem Gebet und der Liebe der Patres und seiner teuren Mutter.