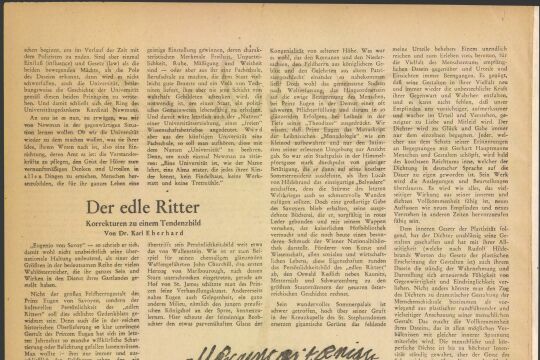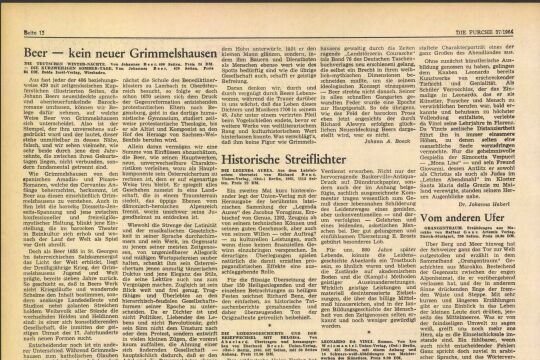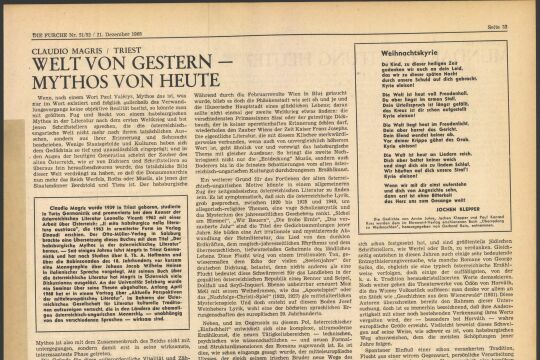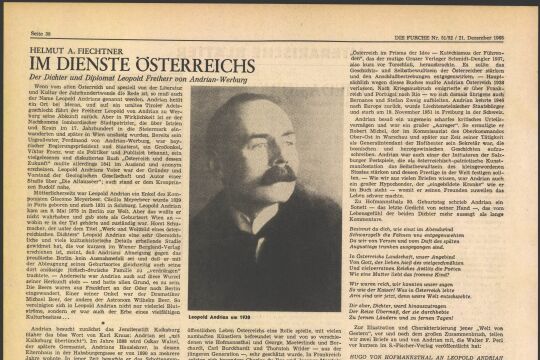In einer Zeit kultureller Selbstbesinnung darf wohl die Erinnerung an einen Dichter des Barock für geboten gehalten werden, den einer seiner Wiederentdecker — Richard Alewyn — schon 1932 „den größten österreichischen Dichter zwischen Walther und Grillparzer“ genannt hat.
Johann Beer stammt aus Oberösterreich, wo er am 28. Febrvar 1655 zu St. Georgen im Attergau als das siebente von 15 Kindern des Ehepaares Wolfgang Bec- und Susanne Beer, geborene Stadlmayr, zur Welt kam. Früher Musikunterricht, Pagendienste auf einem der adeligen Landsitze der Umgebung, seit 1665 vielleicht Erziehung und Ausbildung im Stift Lambach — das alles sind nur Mutmaßungen und Schlüsse, keine Gewißheit über die Entvicklung seiner Jugend in der Heimat.
Die Eltern Beers bekannten sich zum Protestantismus und wanderten gegen 1670 aus diesem Grunde, wie manche Österreicher dieser Landschaft, nach Regensburg aus, der nächsten protestantischen Reichsstadt, wo der Vater bald die angesehene Stellung eines Stadttorschreibers einnahm, Am 20. Oktober 1670 erscheint Johann dort als Zögling des Alumneum und Gymnasium poeticum. Glanz und Anmut seligster Jugend- und Studentenzeit liegen nodi in der Erinnerung über diese Jahre gebreitet, die immer erneut im Rückblick wachzurufen Beer in seinen Erzählungen nicht müde wird. Diese Stadt birgt für ihn eine Erlebnisdichte und Erlebnistiefe, die im gesamten Dasein des Werdenden nur noch vom Erlebnis seiner österreichischen Heimat überboten wird. Was nachher kommt: die Immatrikulation als Theologiestudent an der Universität in Leipzig — um die Mitte 1676 —, Ende 1676 die Berufung als musi-cus vocalis und Altist in die Hofkapelle des Herzogs August von Halle-Weißenfels-Querfurt, Juni 1679 die Vermählung mit der Bärenwirtstochter aus Halle, Rosina Elisabeth Bremer, 1680 die Ubersiedlung mit dem Hof nach Weißenfels, der Aufstieg zu Rang und Würden, 1685 zum Konzertmeister, später noch zum herzoglichen Bibliothekar, das Schaffen und Gelingen im Wirken der reifen Mannesjahre — sosehr dies alles dem Bilde von Beer Fülle, Saft und Farbe verleiht, es reicht in die Wurzeltiefe seines inneren künstlerischen Gestaltungsgesetzes weitaus nidit in dem Maße, wie dies das Urerlebnis der Heimat und das Gemeinschaftserlebnis der Regensburger Studienzeit tun.
Die Dichtung Johann Beets, der Welt bis 1931 verborgen wesentlich hinter den Pseudonymen Jan Rebhu und Wolfgang von Willenhag, fällt in jene eigentümlidie Krise im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts, in welchem das barocke Zeitalter der Bindung an die großen ganzheitlichen Gewalten um den Übergang ringt in das kommende 18. Jahrhundert der individuellen freien Selbstentscheidung der Persönlichkeit (Arnold Hirsch). Was Erfahrung und Wissen beitragen konnten, aus dieser Not des Zeitgeistes herauszuführen, diese Voraussetzungen bradite Beer in reichem Maße mit. Dazu trat aber hoch ein Umstand. Beer war Österreicher, entstammte sonach einer Landschaft, einem Volkstum, in denen jener im Norden des deutschen Geisteslebens bis zur . Unfruchtbarkeit erstarrte Gegensatz zwischen Ganzheit und Vielheit, Idee und realem Dasein lebendige Spannung, beweglicher Anreiz geblieben war. Hier rollte zwischen Vernunft und Sinnen noch das Rad des Grundes, wob der Traum die drückende Unwägbarkeit des realen Daseins zum unwirklichen Gebild. Wo der Vernunft in der Not der Zeit die wirkliche Welt amorph blieb, dies chaotisdie Wirrsal sich nicht mehr zur Ordnung zusammenschloß, die Treue der Empfindungen hat das einzelne von Fall zu Fall immer real erfaßt. Nur so ist es erklärlich, wie hier auch die Kunst der Gebildeten — Festspiel, Ordensdrama, Oper — des Wortes in der Muttersprache meist entratend, dennoch in Musik, Tanz, Pantomime, Ausstattung und Bühnenbild zu allen Sinnen des Volkes verständlich spredien konnte und in einem Strome gemeinsamen Kunsterlebens hoch und nieder, Adel, Gebildete und Volk verband.
Aber nicht allein die blutsmäßige Verwurzelung in diesem Boden und diesem Volkstum macht unseren Diditer zum Mitträger dieser Geistesart. Die Mitteilungen Beers über seine Lektüre während der Studienjahre weisen neben der Nennung der bekanntesten Romanliteratur der Zeit —• von Harsdörffer, Herzog Anton Ulrich bis Grimmelshausen, vom Amadis bis zum Pastor Fido — einmal auf eine tiefgehende
Kenntnis der alten deutschen Volksbücher, dann aber durch Namen und Titel auf eine Reihe österreichischer Landedelleute hin, die, gleich den Eltern Beers, aus religiösen Gründen Österreich verlassen und in Nürnberg oder Regensburg einen geistigen Sammelplatz gefunden hatten. Sie alle, die Stubenberg, Adlersheim, Kufstein, als die bekanntesten unter ihnen, stehen den Sprachgesell-sdiaften des deutschen Südens mehr oder weniger nahe, empfangen von ihnen sprachlich-formale Anregungen und vermitteln dafür in ihrer ausgedehnten Übersetzertätigkeit vorwiegend das italienische und spanisdie Romanschrifttum. Damit geben sie ein seltenes Zeugnis, wie sich österreichische BaTockgeistigkeit, der dann mit Johann Beer ein ragender Verkündet In deutscher Sprache, ersteht, sehr wohl auch im Worte entfalten konnte.
Der Silberblick von Johann Beers Dichter-tum schimmert erstmals auf in jener überaus glanzvollen Fabulierlust, die mühelos die nächtliche Freundesrunde, das „Con-clav“, im Alumntam zu Regeniburg stundenlang in Spannung hält. Allerweltsgut an Fabeln und Schwanken, irgendwo zusammengelesene, bald umgedichtete, bald für den Augenblick erfundene Ritter- und Abenteurergeschichten sprudeln da ohne Kelterung aus einem Menschen, der die Wrelt in ihrer Buntheit und Fülle mit allen Sinnen in sich sog. Die barocke Dichtung gibt auf dem Gipfel der Barockkultur keine durch das künstlerische Individuum subjektiv erlebte Welt, sondern eine durch ein vor allem dichterischen und Diditung genießenden Bewußtsein vorgeprägtes Ethos objektiv gedeutete Welt. An jedem Helden dieser Dichtung wiederholt sich nur immer die gleiche Entscheidung gegen die Welt: die Askese, die Weltflucht. Die heroisdie Eigenschaft ist Standhaftigkeit im Ansturm der Eitelkeit der Welt. Noch bei Grimmelshausen, dem von Beet“ über alles Verehrten und wie ein Evangelium oft Gelesenen, dessen „Simplizius Simplizissimus“ ja die deutsche Gestaltung jenes unbekannten europäischen Helden war, der im Abendland des barocken Jahrhunderts außerhalb oder nur am Zaune jener durch Staat, Kirche, Standesgeburt, Gelehrsamkeit und Philosophie prästabilierten Kulturwelt stand, in dieser seiner eitlen, verachteten, aber realen Welt der nackten Existenz die Not der Zeit und des Daseins einsam tragen mußte, haben Mensch und Welt nur Sinn als Gnadengeschöpfe der Erlösung, ihr Leben — noch durch alle Verstrickung der Schuld und Verworfenheit des Irdischen hindurch — nur als Weg des Heils.
Anders bei Beer. Gewiß schon dem Titel nach stellt sidi der Erstlingsroman „Der Simplizianischa Weltkucker . . .“, 1677 bis 1679, als der Versuch einer Nachfolge Grimmelshausens dar. Naive, noch ungebrochene Freude am ritterlichen Abenteuer waltet vor. Schon die folgenden Romane: „Der Abentheuerliche Ritter Hopffen-Sack...“, 1678, „Printz Adimantus . . .*', 1678, ,.Rit;r Spiridon . . .“, 1679, parodieren diese Lust. „Die vollkommene Komische Geschichte des Corylo . . .“, 1679/80, und „Jucundi Jucundissimi Wunderliche Lebensbeschreibung . . .“, 1680. stellen Gipfel und Absdiluß der frühen pika-resken Richtung dar. Trotz allem noch Konventionellen der Form, welch tiefgreifender Unterschied: kein, wenigstens kein sichtbarer Versudi die Welt auf einen vorgeprägten letzten Wert hin zu ordnen. Kommt es zu einem sittlichen Urteil, so gilt dieses von Fall zii Fäll der jeweiligen einzelnen Situation, die Helden sehen sich in Gegensätze geworfen, deren Lösung im Sittlichen nicht mehr möglich ist. Ein „moderner Pikaro“ ersteht vor unserem Auge, der für sein Sdiicksal nicht mehr die blinde Fortuna verantwortlich machen kann. Schicksal ist nun Mensdiengewirk, das eigene, persönliche, selbstverantwortlidie Leben, in einer Welt, die in sich selber Wert zu tragen beginnt. An Stelle des Feldwertes der Abenteuer im moralischen Bereich tritt der Eigenwert, den sie, fast sdion jenseits von Gut und Böse, in sich tragen. Und wenn man auch noch in ihnen eine zu deutende Bezogenheit sucht, dann muß man sagen, sie stehen da für das Leben, wie es in sdiwelgenden Farben glüht, in wilden • Wogen rauscht . . .
Zu diesem gebannten Verweilen des Dichters Beer vor der vitalen Wirklidikeit des Abenteuers trat aber bald die Demut vor der schlichten Wirklichkeit der einfachen Dinge, die er in naiver Freude am Erzählen, Ding für Ding in seiner schlichten Seins1-weise, ohne Deutung wiedergab und bald selber von dieser beziehungslosen Schönheit des Wirklichen, Wohl der demütigsten Schönheit, überwältigt wurde. So entsteht das, was man Beers Realismus (Richard Alewyn, Arnold Hirsch, Paul Hankamer) genannt hat, ein Realismus des reinen Seins, ein österreichischer Realismus, der in der Biedermeierepik Adalbert Stifters nachmals seine Klassik erlebt. Das, was Johann Beer bis dahin vorgesdiwebt haben mochte in seiner neuen Wirklichkeitskunst, es schenkte sich ihm aber erst dann ganz, als er seine diduerische Aussage in das Gewand jener Schönheit kleidete, die wirklich grundlos, ohne die Notwendigkeit einer Deutung — „sünder warumbe“ — eben mystisch schön ist und es auch in aller ihrer Wirklichkeit, somit auch noch in ihren Fehlern bleibt — die Heimat. Er gab damit, nach einem Zwischenspiel in der zeitgenössischen Satire, schon in dem Roman „Der verliebte Österreicher“ (1704, posthtim erschienen), in voller Reife in den beiden Romanen „Die Teutschen Winternächte“, 1682, und „Die Kurtzweiligen SommertHge“, 1683, sein Bestes.
Da klingt an besonderer Stelle in den „Sommcrtägen“ das Lob der oberösterreidii-schen Heimat auf, da wird das ganze Romanwerk hindurch, am dichtesten und geschlossensten freilich in den drei zuletzt genannten Büchern die Heimatlandschaft immer wieder in ' einzelnen heimischen Ortsnamen angesprochen, die sidi bald um St. Georgen, bald zwisdien Braunau und Schärding verdichten. Auch die größeren Städte und Ortschaften — Linz, Wels. Lambach, Kremsmünster, „Fockelbrück“ (Vöcklabruck) und andere — fehlen nicht. Der wolkenbehaubte Traunstein kündet damals wie heute kommenden Regen, die Salzschiffahrt beim Traunfall ersteht in einem einprägsamen Bilde. Wir können es uns heute kaum vorstellen, welche Leistung es für einen Roman des 17. Jahrhunderts bedeutet, wenn auch die Landschaft in ihm einmalig und charakteristisch wird. Dazu war freilich auch die musikalische Begabung des Dichters eine nicht zu missende Voraussetzung. Sie machte ihn fähig, jenes unsagbare Etwas, das zwischen einem bestimm ten Daseinsräüm und den Wesen in ihm schwebte und was nur in diesem einmaligen Zusammenhang da war, zu erhorchen und darzustellen. Wenn wir an dieser Stelle die heimische Mundart nennen, greifen wir nur den gröbsten, aber sinnfälligsten Ausdruck für das, was gemeint ist, heraus.
Damit hängt eine weitere Wesenheit zusammen, die der neuen Wirklichkeitskunst Beers Substanz und Leben gibt und von dem Erlebnis der heimischen Landschaft nicht wegzudenken ist — das Volk in seiner ganzen breiten Gliederung, als eine soziale ■Wirklichkeit, ohne daß in dieser etwa ein Stand den Vorzug erhielte.
Zum inneren stillen Bild aber ist- dem Dichter Beer das Jugenderlebnis des heimischen oberösterreichischen Landadels, nidit als eines Standes, sondern vielmehr als einer in sich ruhenden Kulturwelt geworden, jenes Erlebnis, das von dem der Heimatlandschaft nicht Zu trennen, ja mit ihm wesenhaft eins war. Inmitten einer zerfallenden Welt des Übergangs, deren Chaotik vorerst undeutbar blieb, stand im ruhigen Glänze das unwandelbare, schlichte, bloße Sein, die beziehungslose Schönheit jener in der Jugend zutiefst erfahrenen, greifbaren und gestaltbaren Wirklichkeit — Realismus im persönlichen Geschick der Individuen, in der satten Irdischheit der Dinge wie in der Vitalität der zwischen-seelisdien Ströme und im einmaligen Charakter der Landschaft — als hintergründiger Halt, vor dem sich die Welt als abenteuerndes Narrenspiel ruhelos und vordergründig bewegt. Vor der Kulturbeständigkeit und Erlcbnisrealitat dieses Hintergrundes erscheint selbst das im Barock so beliebte Gleichnis der Weltflucht — das F.insiedlermotiv —, dessen sich auch Beer, wohl im Anschluß an Grimmelshausen, bedient, nur als ein Durchgang der Unrast des Helden durch ein weiteres irrlichterndes Abenteuer.
Und dennoch kann man nicht sagen, daß dem Werke Beers der Aufblick zu dem es überwölbenden Himmel fehle.. Die Verhaltenheit mit der dieser dort und da, etwa in schlichten Sätzen einer religiösen Spruchweisheit, erscheint, läßt im Bewußtsein des Dichters auf eine schlechthinige Gewißheit von den letzten Dingen schließen.
Und dennoch — dieses Leben endet, fast möchte man sagen im Stile des Jahrhunderts. Der Tod fällt es auf dem Gipfel der Mannesreife inmitten irdischen Behagens höfischer Festlichkeit. Am 28. Juli 1700, gelegentlich eines Vogelschießens, löst sich unversehens ein Schuß und trifft Johann Beer in den Hals. Die letzte Komposition, an der er gearbeitet hatte, war ein „Magnificat“ gewesen, die letzten Worte, die er daran schrieb, sollen ihm in den letzten Tagen seines Schmerzenslagers, auf dem er am 6. August 1700 ausgerungen hatte, ein Trost gewesen sein: „Fecit mihi magna“ — Er hat Großes an mir getan.