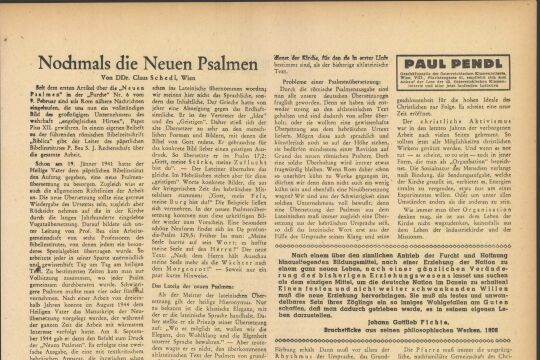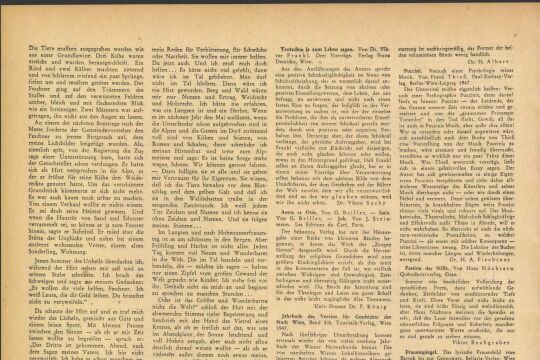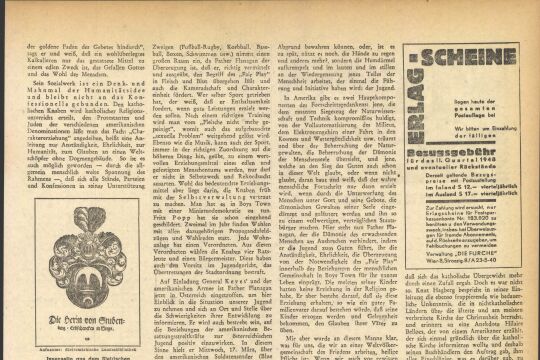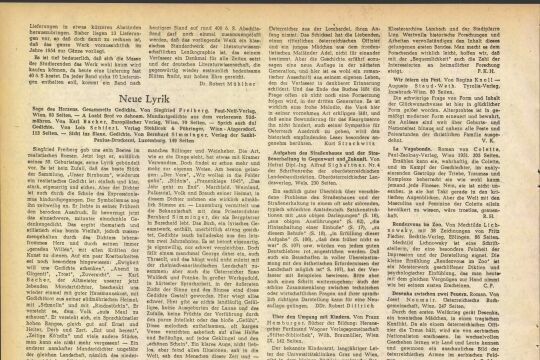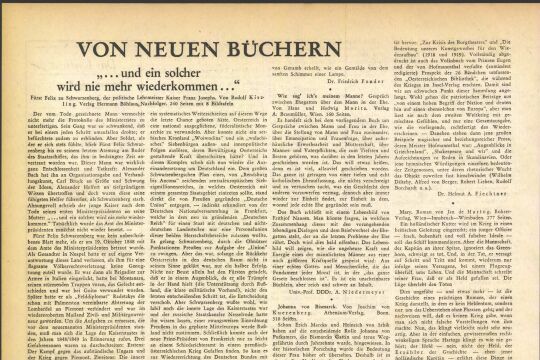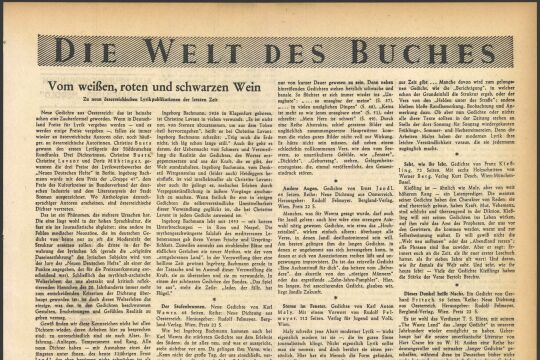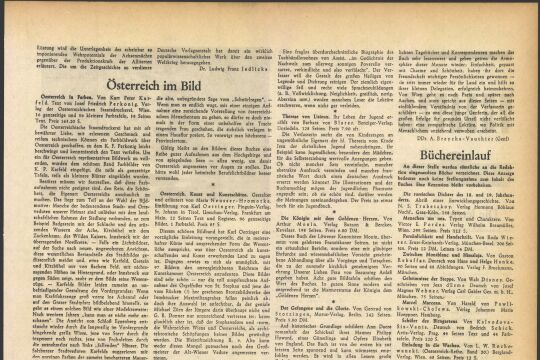Das verdichtete und gedichtete Wort, auch das literarische Erzählen sind Spuren einer Sprache des Zuspruchs und des Trostes. Alltags- wie Dogmensprache reichen dazu nicht aus.
Es war mir nicht bewusst, dass die autobiografische Schrift von Hilde Domin, die mir da wieder in den Sinn kam, vor genau 50 Jahren erschienen ist. Es lag also kein Impetus, ein "rundes Datum“ zu beschwören, dem Bedürfnis zugrunde, mir Domins Notizen zum Titel "Was einem mit seinen Gedichten passieren kann“ zu vergegenwärtigen. Vor allem der letzte dieser zum Untertitel "Lese-Erfahrungen“ zusammengestellten Texte hat es mir angetan: Die Domin beschreibt darin den Wunsch einer hinterbliebenen Familie, dem Verstorbenen vor dessen Einäscherung als Letztes "noch ein Gedicht zu lesen, der Tote habe meine Gedichte geliebt. Falls er noch höre, solle meine die letzte Stimme für ihn sein“: So erinnert sich die Domin an das etwas pikante Ansinnen, jedenfalls nach dem Pfarrer das letzte Wort zu haben. Sie könne nicht davon sprechen, resümiert die Dichterin, "und auch ein Pfarrer würde es nicht verstehen, denn er bekommt ja Routine, leider“.
Was Hilde Domin vor einem halben Jahrhundert erlebt und beschrieben hat, die Kirchen galten damals ja noch längst als die Erstkompetenten, was Trost und Zuspruch an den Wendepunkten des Lebens betrifft - und beim Tod allemal -, klingt überraschend heutig. Anno 1962 klang das erzählte Ansinnen noch etwas exklusiv, 2012 wirkt es hingegen weitgehend normal. Die Anmutung (und für machen Anwesenden wohl auch: Zumutung), der Trauer mittels Poesie und jedenfalls dem Dichterinnenwort zu begegnen, weist in wichtige Richtung: Dort, wo es unsagbar wird, wo des Alltags Sprache nicht mehr reicht, dort haben das verdichtete und das gedichtete Wort, eine Sprache in Bildern, Wörter, verletzlich wie eine vom Frost bedrohte Blüte, Konjunktur.
Wider die prekäre Wortfülle ohne Substanz
Wer nach einer Sprache für die Trauer sucht, wird eher hier fündig als in der Geschwätzigkeit, der die Zeit verfallen ist. Die prekäre Wortfülle ohne Substanz hat ja längst auch die Religion(en) erfasst und der ermüdete Zeitgenosse mag die Wortschwalle professioneller Mitgefühlsheischer nicht mehr hören wollen.
Interessant, dass schon Hilde Domin solche Erfahrungen mitteilen konnte. Die Erinnerung an ihre Schilderung kam mir bei der Lektüre von Walter Müllers "Wenn es einen Himmel gibt“ in den Sinn, wo der Salzburger Literat knapp zwei Dutzend Trauerreden zusammengestellt hat. Müller, der als junger Autor bereits im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs ausgezeichnet wurde, verdingt sich auch als Trauerredner und erhebt, wie sein neues Buch darstellt, die Trauerrede zur literarischen Gattung. Die Sprache der Dichter als eine Sprache für die Trauer. Das gelingt hier in einem Maße, dass auch die Lektüre der Wortkunst, derer sich Müller bedient, zum Vergnügen wird - und das ist ganz und gar nicht pietätlos. Walter Müller ist ein direkter Konkurrent zu den Pfarrern, den professionellen Trauerrednern und Trostspendern seit jeher. Aber auch wieder kein Konkurrent.
Ein Konkurrent, weil eben die religiöse Sprache in den Strudel alltäglicher Wortschwalle geraten ist. Und kein Konkurrent, denn die von ihm rhetorisch Betrauerten haben schon zu Lebzeiten die enge Bindung an die institutionelle Religion verloren, sodass von daher ein der religiösen Institution nicht verpflichteter Wortspender gefragt ist.
Von der Kunst des Literaten
Die Kunst des Literaten als Trauerredner besteht darin, das Leben des Verstorbenen durch seine Sprachkraft zum Leuchten zu bringen. Nicht - wie bei Domin - ist hier das Gedicht verdichtetes Wort, sondern das Erzählen aus dem - oft prallen wie entbehrungsreichen - Leben, das Müller hier einer trauernden Gemeinde und - via Buch - auch der Nachwelt aufbereitet. Dabei hat Walter Müller gar nichts gegen die Religion an sich. Zumindest nutzt er ihre Versatzstücke: Vorstellungen wie den Himmel imaginiert er ebenso wie Figuren aus der Mythologie oder philosophische Gedankengänge.
"Mich interessieren die Menschen, die Abschied nehmen“, schreibt er schon zu Beginn seines Buches: "Noch mehr interessieren mich die Verstorbenen.“ Und denen will er gerecht werden: "Über sie, diese Menschen mit allen Stärken und Schwächen möchte ich erzählen.“
Damit ist eigentlich alles gesagt, außer dass Müller auch offenbart, wie er Trauerredner wurde. Und er beschreibt, wie er jede seiner mittlerweile über 200 Reden an Gräbern anlegt: Er trifft sich einige Tage vor dem Begräbnis mit den Angehörigen und vertieft sich ins Schicksal des Verstorbenen, auf dass er in einer Erzählung, vorgetragen von Walter Müller am Grab, jedenfalls für einen Moment aufersteht, wenn solche Charakteristik hier angemessen ist.
Mag sein, dass es viele Sprachen auch für die Trauer gibt. Aber der originelle Zugang, den Walter Müller in seinem Trauerreden-Buch vorlegt, hat viel für sich. So erfährt man vom "guten Geist der Linie M“: Diese Salzburger O-Bus-Linie gibt es nicht mehr, ebenso einen Schaffner wie Walter Hingsamer darin. Oder die Putzfrau Branka Langhammer und die "gottische Liebe“ (was diese bedeutet, soll hier nicht verraten werden). Oder als drittes Beispiel, der Gastronom des Sternbräu, dem Trauerredner Walter Müller ins Grab nachruft: " Herr Direktor Hauer - bitte in den Himmel!“
Die Menschen bedürfen dringend des Trostes, hat ein Religionskundiger einmal gemeint - und seine Kirche gemahnt, diesen Trost zu vermitteln. Bekanntlich meinen viele Leute, dass ihnen die heutigen Religionsinstitutionen dies nicht in dem Maß bieten, wie sie es sich erhoffen. Witz und Bodenständigkeit, gepaart mit literarischer Kraft, wie sie Walter Müller hier anbietet, kann so auch als Schule des Trostes herhalten. Eine Sprache für die Trauer muss durch solch eine Trost-Schule gehen.
Die alten Religionen wüssten eigentlich längst davon. Wer etwa unvoreingenommen in die Psalmen hineinliest, jene Lieder aus biblischem Dichtermund, wird darin diese Sprache der Trauer und des Trostes finden, die auch der Zeitgenosse so sucht. Das ist etwa den katholischen Kirchenprofis längst bewusst. Dass vor ebenfalls beinahe 50 Jahren das bahnbrechende Konzilsdokument, die Pastoralkonstitution "Gaudium et Spes“ eben mit den Worten beginnt "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute … sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi“, zeigt, dass das Wissen um eine angemessene Sprache für die Trauer auch die Konzilsväter umgetrieben hat.
Eine Trostsprache, keine Dogmen!
Befremdlich scheint es, wenn zurzeit die Uhren ganz anders gehen: Statt sich an den Dichtern zu orientieren, setzen beispielsweise die katholischen Gralshüter liturgischer Texte auf wörtliche Übersetzungen aus dem Latein, die möglichst viele Dogmen wiedergeben, auf dass jeder Funke einer Häresie in den Gebetstexten hintangehalten wird.
Als erstes und abschreckendes Beispiel solcher liturgischer Texte ist vor einiger Zeit eine neues katholisches Begräbnisrituale auf Deutsch erschienen, dem von den Liturgikern wie Praktikern ein vernichtendes Urteil ausgestellt wird: Die in diesem Buch verzeichneten Texte, die beim katholischen Begräbnis gesprochen werden, stellen sicher, dass am Sarg eines Verstorbenen keine Glaubenslehre verletzt wird. Aber für theologisch wenig Kundige und kirchlich nicht Nahestehende sind die Texte unverständlich - und bar der Kriterien des Trostes. Man kann den Autoren solcher sprachlicher Artefakte nur nachdrücklich raten, endlich bei den Dichtern in die Schule zu gehen - bei den Psalmdichtern ebenso wie bei einer Grande Dame wie Hilde Domin. Oder bei dem augenzwinkernden Erzähler Walter Müller. Denn die sind viel näher bei den Menschen als ein kirchlicher Funktionär, der hinter dem Schreibtisch über Texten brütet, die mit dem Leben der Menschen nichts zu tun haben. Eine Sprache für die Trauer müsste aber genau das leisten.
Wenn es einen Himmel gibt …
Trauerreden
Von Walter Müller Otto Müller Verlag, 2012.
253 Seiten, geb., e 19,50
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!