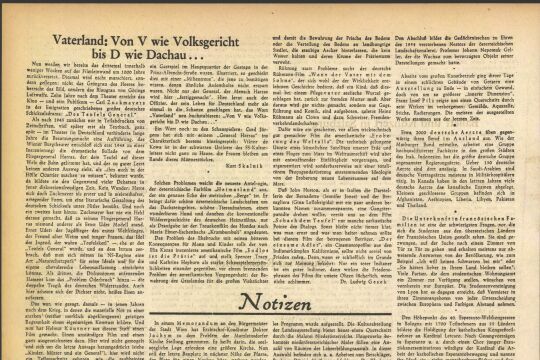Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eisensteins Erbe
Mitten im Krieg, 1943, begann Rußlands, vielleicht der Welt größter Filmregisseur, Sergej M. Eisenstein, in Alma Ata mit der Arbeit an seinem letzten Werk, „Iwan, der Schreckliche“. Geplant waren drei Teile: der erste wurde im Jänner 1945 in Moskau uraufgeführt und fand kühle Aufnahme; der zweite Teil geriet unter die Räder des StaÜnschen Konformismus (siehe auch den ganzseitigen Text- und Bildbericht darüber in der „Furche“ Nr. 13, 1959), der diitte Teil wurde nicht mehr geschnitten,/obwohl 40.000 Meter Negativ Vorlagen (Eisenstein .starb am 10. Februar 1948). Der’zweite Teil, „Die Verschwörung der Bojaren“, wurde schließlich für die Weltausstellung in Brüssel freigegeben und kommt jetzt, sorgsam redigiert, zu uns. Um zehn Jahre zu spät! „Iwan“ gehört einer zweiten, nachrevolutionären, ästhetisierenden Epoche Eisensteins an; wenn nicht alle Anzeichen trügen: auch einer humanisierenden, religiös meditierenden. Ansätze sind noch in der Wiener Fassung zu spüren, obwohl das farbige Schlußstück des „Jüngsten Gerichtes“ gekappt ist. (Diese Züge des Films würden auch seine Kassation'vor zehn Jahren und seine Kastration nach zehn Jahren erklären). In diesem Jahrzehnt hat nun sowohl der Inszėnierungs- als auch der Spielstil des ganzen Weltfilms eine gründliche Wandlung erfahren. Wir empfinden heute diesen zweiten „Iwan“ kaum anders denn als konservative, prächtig inszenierte und großartig photographierte Oper, dessen statischer Stil in Spiel (Nikolai Tscherkassow, M. Sharow), Kamera (Andrej Moskwin und Eduard Tissė) und Musik (Prokofjew) mit einer . Art Verbissenheit von A. bis Z durchgestanden wird. Wir neigen uns in Achtung davor, in die Geschichte des Films aber wird nicht der Svnthetiker Eisenstein des Torsos „Iwan“, sondern der Revolutionär des „Panzerkreuzers" eingehen.
Lourdes-Filme haben in der Geschichte des Films eine ehrenvolle Tradition, die von der frühen Stummfilmzeit bis zur idealen Volkskunst des Werfelsehen „Liedes von Bernadette“ reicht. Der Franzose Georges Rouquier hatte durchaus die Legitimation, den Stoff einmal am anderen Ende anzupacken und nicht biographisch oder freischöpferisch zu verbrämen, sondern in der ganzen heiligen Nüchternheit authentischer Dokumentarität auszufalten. Der oft gerühmten Pariser Dokumentarschule der Garne, Bunuel und Gremillon zugehörig, hat er schon in der Stummfilmepoche in „Vendanges“ ein blühendes Weinlesefest, in „Farrebique“ seine Heimat gemalt. Sein Film „Lourdes et ses Miracles“ („Das Wunder von Lourdes“) erhielt denn auch Zugang zu Vorgängen und Oertlichkeiten, die der Filmkamera bisher verschlossen waren. Er blättert im ersten Teil die ärztlichen Akten dreier Heilungen auf, spart einen wuchtigen Mittelteil für einen besonders reich besuchten Wallfahrtstag auf und widmet einigen wundersamen Vorfällen bei den Dreharbeiten den Epilog. Der Schwerpunkt des Films liegt, unzweifelhaft im Mittelteil des Triptychons, der mit stellenweise brutalem Realismus (der der französischen existentiellen Religiosität näher liegt als unserer heimischen Barockfrommheit) den endlosen Leidenszug der Hilfe- und Trostsuchenden, die schockierende Art des Quellbades und die hingehende Inbrunst einer nächtlichen Lichterprozession in düster und magisch flackernden impressionistischen Bildern und Tönen auf die Leinwand zwingt; von seiner Art einer gewissermaßen unbestechlichen, unerbittlichen Berichterstattung zeugt, daß er die Kamera auch nicht vor dem geschäftigen Kitschbetrieb haltmachen läßt, der sich gemeiniglich — auch in anderen Wallfahrtszonen Europas — förmlich wütend in den Falten heiliger Empfindungen zu verkrallen pflegt. Die nüchterne Skpesis, mit der Rouquier selbst als Textsprecher ™ ld! i.feer 4Fi4fj„ lurcJi4ie vielleicht aber ist gerade sie geeignet, in der weitum verbreiteten Säkularisierung und areligiösen Abgebrühtheit dort ein Ohr zu finden, wo alles mystische Erleben tief verschüttet ist. Würde solcherart aus tausend Saulus ein einziger Paulus, so hätte Gott wieder einmal auf krummen Zeilen grad geschrieben.
Der italienische Neoverismo hat nicht nur das trostlose Grau im Leben, sondern auch den Trost im Grau des Lebens wiederentdeckt. Einer seiner gemütvollsten Sozialhumanisten ist Pietro Germi. Sein siebenter, vorletzter Film seit 1947 (wir sahen davon hier nur „In nome della legge“ und „II cammino della speranza“) ist „II ferrpvie“, 1955, der nunmehr unter dem deutschen Titel „Das rote Signal“ zu uns kommt. Er erzählt vom Leben, Entgleisen und versöhnlichen Tod eines Lokomotivführers, dessen Hang zum Trunk beinahe die Familie ruiniert. Eine unendlich hingebungsvolle Ehefrau Und ein kleiner Bub halten die schützenden Hände über sein schwankendes Leben. Pietro Germi, ein interessanter Grauhaariger mit De-Sicä- und Theodor-Loos-Zügen, spielt diesen Kerl einfach großartig. Die Sterbeszene, eine Oase des natürlichen Todes inmitten der tausend wüsten Gewalttode des Films, ist eine Meisterleistung hintergründig-symbolischer Kamerasprache.
„M enschen im Netz“ der gnadenlosen Ost- West-Spionage hat der gleichnamige deutsche Film mit harten Strichen porträtiert. Franz Peter Wirths straffe, gekonnte Regie hat einen atemlos gespannten Reißer daraus gemacht; es ließe sich auch anderes denken.
Die herbe Kritik, die die Filmkomödie nach Priestley und das am Montag morgen“
auf der diesjährigen Berlinale erfahren hat, scheint uns etwas streng. Gewiß ist die Rechnung: angelsächsischer Stoff — italienischer Komödienparaderegisseur (Luigi Comencini) — deutscher Schwankstil nicht ganz aufgegangen, vor allem der künstlerische Absturz ins Happy-ending läßt die anspruchsvolleren Zuschauer aus den Wolken fallen. Trotzdem kichern hundert bezaubernde Witze und Weisheiten durch die Geschichte des Bankdirektors Kessel, der einmal „übergeht“, aus dem lebensfeindlichen „Betrieb“ ausbricht und Kind, Mann, Mensch sein möchte; zumal 0. W. Fischer wieder einmal alle Register seines reichfacettierten Mienen- und Wortspiels zieht und dabei eine ganze Reihe verständnisvoller Partner findet.
„Alle lieben Peter“ ist nicht ganz ernst zu nehmen, aber symptomatisch: als Ausdruck des heftig grassierenden erotischen Infantilismus unserer Tage, der in Petticoats und kurze Hemdchen, in Peterchen Kraus und Christinchen Kaufmann schlüpft. Alle guten Geister, alle lieben Peter seien uns gnädig!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!