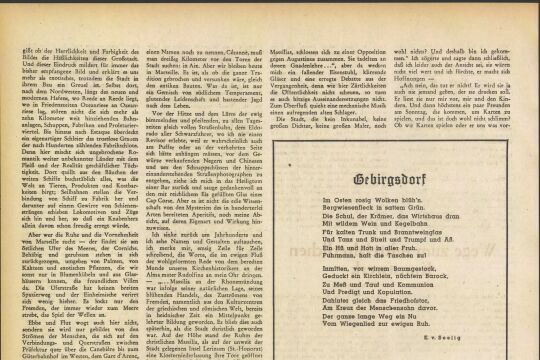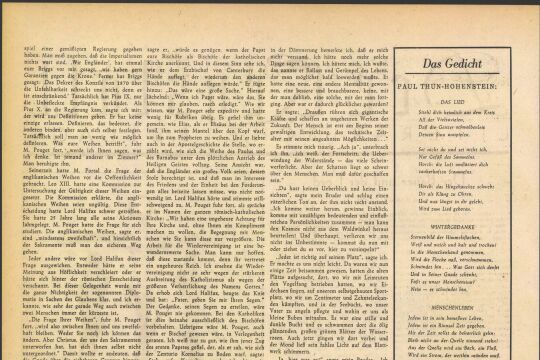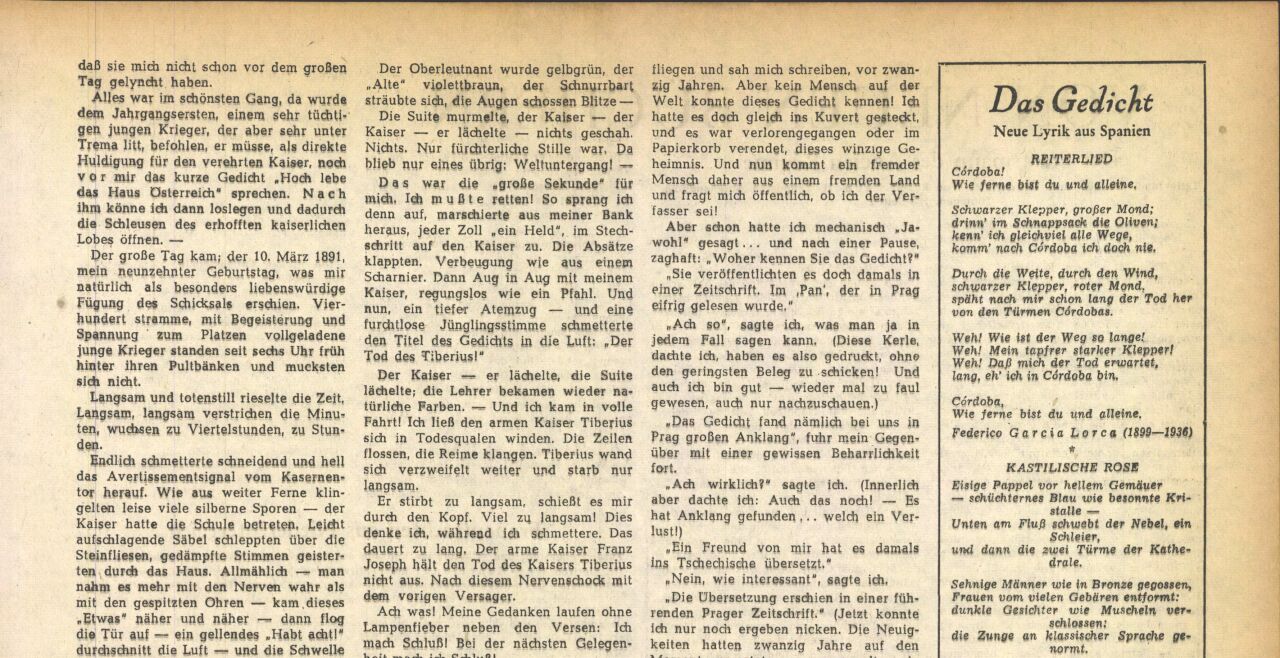
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Entgangene Literatur
Es gibt Lebensalter, da man lieber tanzt als geht, und Gedichte, das sind Worte im Tanz. Als Achtzehnjähriger las ich sie, wie man Wein trinkt, hatte den Hofmannsthal hinter mir, kannte Rilke auswendig und hörte nun, als Student zum erstenmal in Deutschland, einen neuen lyrischen Ton, der mich sonderbar ergriff. Ihn vernehmend, sprach ich wie Adam „das ist wohl Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein“, denn der Jüngling sucht den Freund, die Gleichaltrigen, die Gleichgestimmten — hier aber, in den Gedichten von Georg Heym, drang sie mir ans Ohr: die Stimme meiner Generation. Pathos und Trauer lagen in diesen Versen genug, um ein junges Herz zu bezaubern, und sie waren echt: dunkler Vorklang des furchtbaren Krieges, der vor der Tür stand. Denn es war 1911.
Da setzte auch ich die Feder ans Papier und schrieb:
Verdammt! Der blaue Wind weckt die geduckten
Mammutgestalten schwarzer Häuser, die mit gelben Augen böse vor sieh guckten.
Verdammt! Es dröhnen riesige Kitharen, daß alle Sterne flackern und die Züge vor Trauer brüllend in das Dunkel fahren.
Verdammt! Man kann nicht leben, nicht sich schonen.
Das einzige wäre noch, in einer hellen gutmütigen Petroleumlampe wohnen,
Schön, nicht wahr? Das trug man damals so, Tief zufrieden und ohne das Gedieht jemand zu zeigen, tat ich es in ein Kuvert und schickte es einer damals führenden Zeitschrift. Es war mein einziges Gedicht; nie dachte ich mit einem halben Gedanken daran, Schriftsteller zu werden,
und schickte es mehr aus Neugierde ab, weil man ja in dem Alter alles probieren und also auch einmal gedruckt sein will. Ich bekam keine Antwort, wartete auch nicht so sehr darauf und widmete meine Zeit weiterhin dem Kallegsdiwänzen, dem Skilaufen und dem Tango.
Dann kam ich als Bergingenieur nach Zentralasien, dann kam der erste Weltkrieg, dann die russische Revolution, kurz, es kam allerhand und ich endlich wieder nach Deutschland, wp ich mich, nach Betätigung als Elektroingenieur, Schauspieler und Übersetzer, ziemlich verdutzt als Schriftsteller dasitzen fand. Das sind so die kleinen Umwege įm Lebenslauf. Weil mich alles andeie langweilte, war ich in der Tat Essayist geworden; aus purer Faulheit wurde ich fleißiger Handweber literarischer Fetzen. Man denke, wie angenehm — kein Büro, keine Vorgesetzten, keine Dienststunden, sondern man schreibt gemütlich im Schlafrock, was einem Spaß macht, und kriegt noch Geld dafür, so daß man auf Reisen gehen kann! (Später stellte sich zu meinem Staunen heraus, daß man dafür von einzelnen sogar gewissermaßen verehrt wird — also das }st schon wirklich zuviel.)
Nun geschah es, daß ich 1931 einmal mit Bekannten bei Kempinski in Berlin zu Abend aß und dabei einen Komponisten kennenlernte. Aus Prag. Als er meinen Namen hörte, fragte er: „Sind Sie, Herr von Radecki, vielleicht der Verfasser des Gedichts .Verdammt! Der blaue Wind..
Bei dieser Frage brach der Boden unter mir ein, und ich fiel in einen Schacht, der viele, viele Jahre tief war,.. Endlich sah ich so etwas wie eine Lampe, ich sah die weißen Tüllvorhänge vom Nachtwind fliegen und sah mich schreiben, vor zwanzig Jahren. Aber kein Mensch auf der Welt konnte dieses Gedicht kennen! Ich hatte es doch gleich ins Kuvert gesteckt, und es war verlorengegangen oder im Papierkorb verendet, dieses winzige Geheimnis. Und nun kommt ein fremder Mensch daher aus einem fremden Land und fragt mich öffentlich, ob ich der Verfasser sei!
Aber schon hatte ich mechanisch „Jawohl“ gesagt… und nach einer Pause, zaghaft: „Woher kennen Sie das Gedicht?“
„Sie veröffentlichten es doch damals in einer Zeitschrift. Im ,Pan\ der in Prag eifrig gelesen wurde.“
„Ach so“, sagte ich, was man ja in jedem Fall sagen kann. (Diese Kerle, dachte ich, haben es also gedruckt, ohne den geringsten Beleg zu schicken! Und auch ich bin gut — wieder mal zu faul gewesen, auch nur nachzuschauen.)
„Das Gedicht fand nämlich bei uns in Prag großen Anklang“, fuhr mein Gegenüber mit einer gewissen Beharrlichkeit fort.
„Ach wirklich?“ sagte ich. (Innerlich aber dachte ich: Auch das noch! — Es hat Anklang gefunden … welch ein Verlust!)
„Ein Freund von mir hat es damals Ins Tschechische übersetzt.“
„Nein, wie interessant“, sagte ich,
„Die Übersetzung erschien in einer führenden Prager Zeitschrift.“ (Jetzt konnte ich nur nodi ergeben nicken. Die Neuigkeiten hatten zwanzig Jahre auf den Moment gewartet — nun prasselten sie auf mich ein.)
„Dann wurde das Gedieht von mir in Musik gesetzt“, ließ mein Gegenüber nicht locker. (Es klang beinahe wie „unter Musik gesetzt“, und ich hatte die Vision eines Wasserrohrbruches …) — „Es erschien im Orpheus-Verlag, gewann Popularität und wurde bei uns häufig gesungen.“
„So ist’s recht“, sagte ich. Und setzte dann höflich hinzu; „Das freut mich wirklich sehr.“
Dann aber lehnte ich midi zurück. Dieses Gedicht hatte sich also selbständig gemacht. Ausgebrochen im Schutz meiner Nonchalance, war es allein durch die Welt kutschiert, hatte Druckereien in Bewegung gesetzt, Herzen erobert, Stimmbänder und Klaviere in Vibration ge- . bracht -= und ich, der Landgraf, komm zu so was nicht (wie es in der Tannhäuserparodie heißt)! Ich hatte das Gefühl wie bei einer entgangenen Mahlzeit, die man ja auch nie einholen kann. Ich war jahrelang als gedruckter, übersetzter, ja gesungener Autor herumgegangen Und hatte es nicht gewußt.
Zum Trost stellte ich mir wenigstens vor, wies gewesen wäre, wenn ich es gewußt hätte. Denn wenn man mit achtzehn Jahren als gedruckter und so weiter und so weiter Autor einherwandelt, so kann es geschehen, daß einem das den Kopf verdreht. Es hätte midi eventuell aufgeblasen; ich hätte geglaubt., Dichter zu sein, und mich ernsthaft aufs Flarfen- schlagen verlegt — schrecklich. Womöglich wäre ich mit jener Zeitschriftnummer herumgelaufen und hätte sie allen vorge- zeigt — eine lächerliche Figur, der Mann mit dem Gedicht in der Roditasche! Un- geimpft gegen Eitelkeit, wäre ich Vielleicht allen ihren Fiebern verfallen. — Wie gütig also vom Schicksal, mir das Schicksal meines Gedichts vorzuenthalten! Aber nein, schon stieg mir der Zorn in die Schläfen. Nur ein Schriftsteller weiß, wie einem Jüngling zumute ist, der sich das erstemal gedruckt sieht: das ist der erste Kuß, das ist eine Hochzeit — mit der Kunst, mit dem Ruhm, mit wem alles… Und man hatte mich darum gebracht! Jetzt wurde mir klar, warum mir mein erstes Gedrucktwerden so gleichgültig gewesen: es war ja in Wirklichkeit bloß das zweite. So beschloß ich, dieses Erlebnis nunmehr „zwanzig Jahre später“ doch noch nachzuholen. Ich wollte in die Staatsbibliothek gehen und mir die betreffende Nummer herausgeben lassen, um meinen ersten Bück auf mein erstes Gedrucktes nachholend zu genießen. Natürlich ein bißchen spät.
Abpr, wie das so geht, ich kam nicht recht dazu. Ich war wieder einmal zu fauj. Ich ließ die Sache auf sich beruhen. Und das war ja auch viel romantischer! Dort, irgendwo im Keller, im Bücherstaub, lag mein Gedicht, mein schlafendes Dornröschen, das ich nie gesehen habe und nie, nie gedruckt sehen werde … Außer natürlich, wenn dieser Aufsatz angenommen wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!