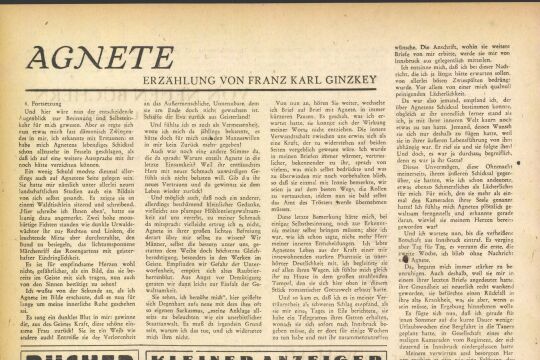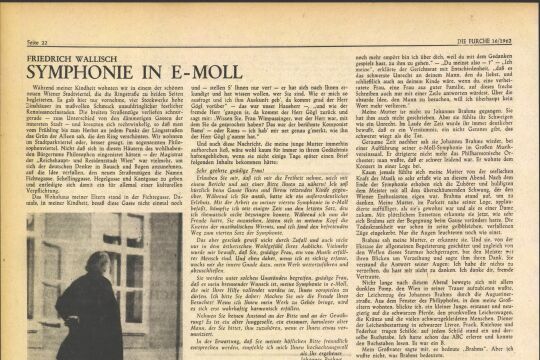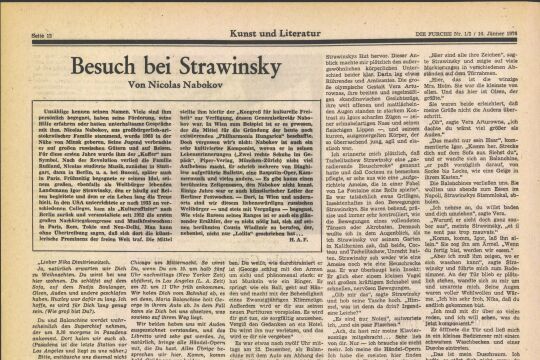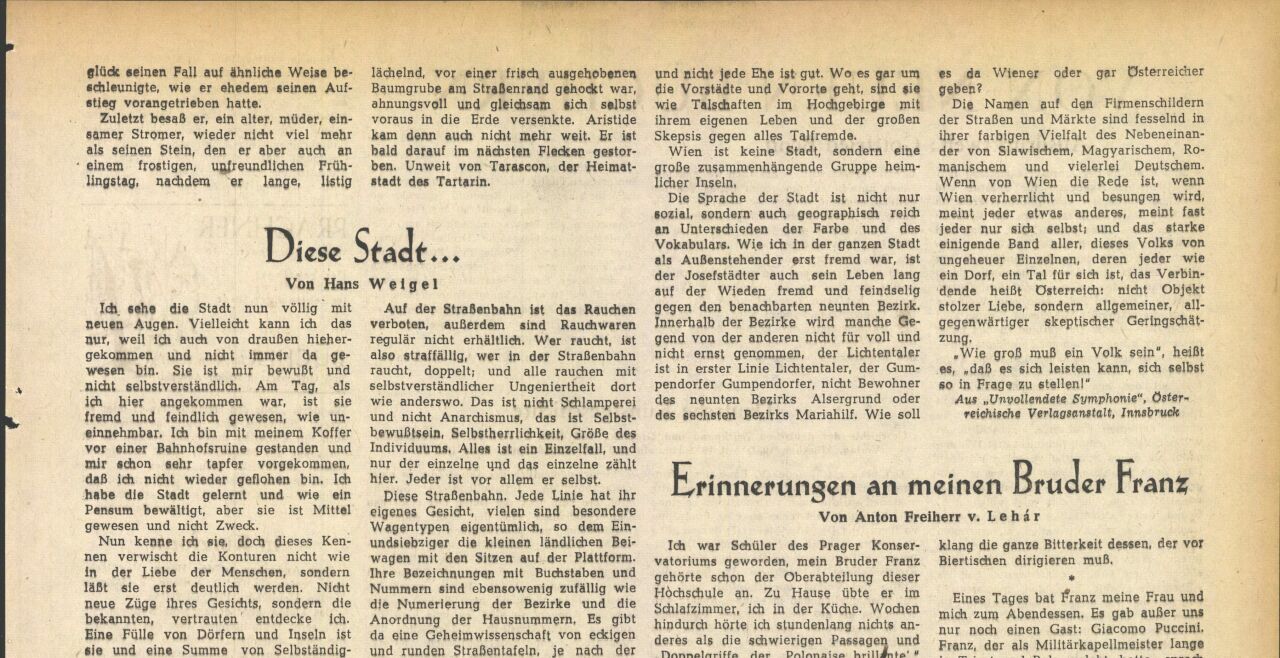
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Erinnerungen an meinen Bruder Frans
Ich war Schüler des Prager Konservatoriums geworden, mein Bruder Franz gehörte schon der Oberabteilung dieser Hochschule an. Zu Hause übte er im Schlafzimmer, ich in der Küche. Wochen hindurch hörte ich stundenlang nichts anderes als die schwierigen Passagen und „Doppelgriffe der ,Polonaise brillffnte' “ von Wieniawski. Je besser Franz mit für mich unfaßbarer Ausdauer die technischen Schwierigkeiten dieses Effektstückes meisterte, desto mehr graute mir vor der Aussicht, sechs Jahre lang täglich sechs bis acht Stunden vor dem Geigenpult zu stehen. Zudem hatte der Nachbarjunge eben ein Flobertgewehr bekommen, mit dem er die Spatzen glücklicherweise meist verfehlte.
Mein erfahrener Vater hatte bald erkannt, daß ich nicht ganz bei der Sache war. Als ich ihn nun auch noch, freilich schüchtern, um ein Flobertgewehr bat, brauste er auf: „Also, was willst du? Die Geige oder ein Flobertgewehr?“ — „Ein Flobertgewehr!“ rief ich heulend. Am nächsten Tag flog ich vom Konservatorium, erhielt das Flobertgewehr und marschierte bajd darauf in die Kadettenschule. Der „Polonaise brillante“ verdanke ich es, daß ich im Leben nicht zu der Rolle verdammt worden bin, die Eduard Strauß neben Johann Strauß hatte spielen müssen; denn zu mehr hätte ich es in der Musik wohl kaum gebracht.
Franz war schon der berühmte Komponist, ich war General, als er mich einmal spät abends ans Telephon rief. „Toni! Rasch, Radio auf!“ Und ich hörte das herrliche g-moll-Violinkonzert von Bruch. Ich hatte es sofort erkannt. Als ich noch ein kleiner Bub war, hatte mich Franz in Prag einmal auf einen Abendspaziergang mitgenommen, ich durfte seinen Geigenkasten tragen. Wir waren zur „Dali-borka“, dem Hungerturm, gekommen, in dem Smetana (in der gleichnamigen Oper) den legendären Ritter Dalibor geigen läßt. Dort, an die Mauer gelehnt, es war bereits dunkel, spielte Franz das Adagio des Max-Bruch-Konzerts so hinreißend, so beseelt, daß es mir unvergeßlich blieb.
Nach beendetem Radiokonzert rief ich Franz an. Auch er hatte an diese Episode gedacht. „Du weißt, wie streng unser guter Vater darauf bestanden hat, daß ich zunächst das Geigespielen gründlich erlernte. Ich muß dir gestehen, mir war damals trostlos zumute. Die Aussicht, ein Leben lang nur durch Geigespielen mein Brot verdienen zu müssen, trieb mich fast zum Selbstmord. Da zeigte mir Max Bruch den Weg: vom Handwerk zur Kunst.“
Franz Lehlr konzertierte mit der Kapelle des k. u. k. Infanterieregiments Nr. 26 im Wiener Volksgarten. Er hielt sich an das normale Programm der Militärkapellen: im ersten Teil eher seriös, im zweiten meist heitere Musik und die seinerzeit so geschätzten „Potpourris“ beliebter Melodien leichten, ja seichten Genres. Da brachte Franz Lehar als letztes Stück „Danse macabre“ von Saint-Saens. Als ich nach dem Konzert Franz verwundert fragte, warum er nach all den leichten Sachen noch das ernste Stück gebracht habe, meinte er seufzend: „Zu meiner Erholung!“ Aus seiner Antwort klang die ganze Bitterkeit dessen, der vor Biertischen dirigieren muß.
Eines Tages bat F*ranz meine Frau und mich zum Abendessen. Es gab außer uns nur noch einen Gast: Giacomo Puccina. Franz, der als Militärkapellmeister lange in Triest und Pola gelebt hatte, sprach ziemlich gut italienisch, Puccina nur wenig deutsch. Schon während des Essens unterhielten sich die beiden Meister fast ausschließlich dadurch, daß sie abwechselnd aus ihren Werken zitierten, leise singend deuteten sie die Melodien an. Dann setzten sich beide an den Flügel. Eng umschlungen spielten sie. Puccini mit der rechten, Franz mit der linken Hand; die wunderbarsten Harmonien erklangen, Puccinismen und Lehärismen, sie überboten einander in Klangwirkungen und originellen Wendungen. Ein unvergeßlicher Abend; noch in den spateren Briefen Puccinis an Franz klang er nacn.
Auf dem Schreibtisch in Puccinis Stei-be-zimmer steht heute noch das Bild Franz Lehars, in der Wiener Lehar-Gedächtnis-stätte das Bild des italienischen Komponisten, der in Franz Lehär mehr sah als den erfolgreichen Operettenkomponisten. Als Puccini starb, ohne seine „Turandot“ vollendet zu haben, schrieb der Musikkritiker Giordano, nur einer sei imstande, sich in die Musik Puccinis so zu versenken, daß das Werk im Geiste des Meisters zu Ende geführt werden könnte: Franz Lehar. Dieser jedoch lehnte ab.
Die Bezeichnung „Unterhaltungsmusik“ war Franz Lehär ein Greuel, vielleicht, weil sie ihn an so viele bittere Stunden als Militärkapellmeister erinnerte. Der Gegensatz zu ernster Musik sei nicht „leichte“ oder „seichte“, sondern heitere Musik, betonte er häufig.
In Halle an der Saale wollte ein Herr Schätzau ein „Archiv für Unterhaltungsmusik“ gründen. Er bat meinen Bruder, das Protektorat zu übernehmen. Franz, dessen Korrespondenz ich sehr häufig übernahm, bat mich, Herrn Schätzau begreiflich zu machen, daß er ablehnen müsse, Am 21. Juli 1941 schrieb er mir dazu: „Heute flattert beiliegender Brief ins Haus! Ich kämpfe seit Jahr und Tag, um von meinen Werken das Odium .Unterhaltungsmusik' abzustreifen. Ahnungslos trete ich'' mit diesem Herrn in schriftlichen Verkehr. Nun steh' ich da und weiß nicht, wo aus und ein! Vielleicht weißt Du einen Rat?! Vielleicht könntest Du ihm schreiben? Ich will ihm ja nicht weh tun. — Hier wird aber mein ganzes Lebenswerk zerstört! Wenn ich Musik geschrieben habe, die ins Volk dringt, so hab' ich doch ganz einen andern Zweck verfolgt, als Unterhaltung zu bieten. Ich wollte sein Herz erobern und in seine Seele dringen, und die vielen hundert Zuschriften, die ich aus allen Teilen der Welt erhalte, beweisen mir, daß es mir gelungen ist und daß ich nicht umsonst gearbeitet, gelebt habe.“
Der letzte Absatz schien mir so charakteristisch für Franz Lehärs Ansicht von seiner Berufung, daß ich ihn in Faksimile auf seine Todesanzeige setzen ließ.
Aus „Neue Zeitung“, München.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!