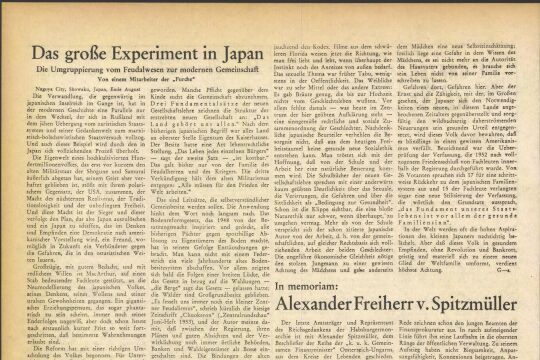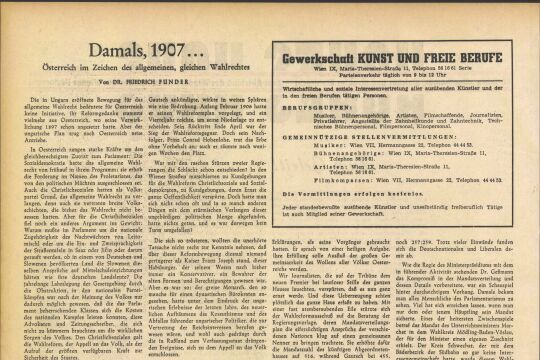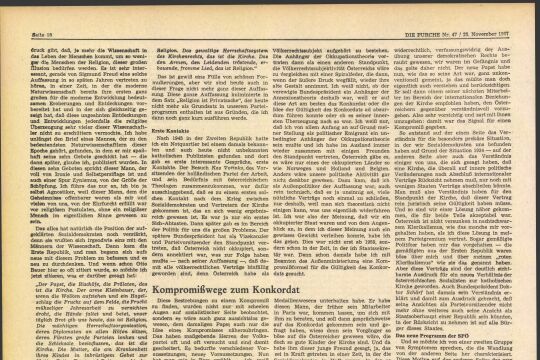Wenn ich midi richtig erinnere, war es im Mai des vierten Kriegsjahres 1917, als ich Seipel das erstemal nähertrat. Gewiß hatte ich ihn schon früher gekannt, da meine berufliche Tätigkeit als Schriftsteller und als Volksbunddirektor mich mehrere Male in Berührung mit dem Salzburger Theologieprofessor bradate. Damals aber kam ich von der Front auf kurzen Urlaub nach Wien. Mein Herz war voll Sehnsucht nach einem guten und gerechten Frieden, der das Vaterland, das um der Selbsterhaltung willen nach dem ungesühnten Morde von Serajewo in den Krieg gegangen war, seiner kiiltu-rellen Mission wiedergeben sollte. Genug des Herzeleides war über Millionen gekommen, in zu vielen Familien war das Glück erloschen und die Trauer eingekehrt; darum träumten wir Soldaten im Felde und unsere Lieben daheim vom Frieden und von einer neuen Weltordnung, die künftighin Verschwörungen gegen die Sicherheit und Rechtsordnung der europäischen Staaten unsdiäd-lidi machen, heimlich schwelende Brände auslöschen solle, ehe die unselige ultima ratio der Waffen zwangsläufig würde. In Wien traf ich Seipel, dessen Haupt nicht nur der begründete Ruf eines priesterlichen Gelehrten von hohem Range, sondern auch schon die Aura des Mannes umglänzte, der eine Hoffnung des Vaterlandes ist. Ich wußte bereits, daß er mit Lammasch einer der mutigsten Wegbereiter des ersehnten Friedens war. Mitten im Dröhnen der Schlachten für den Frieden zu wirken, erfordert eine gehörige Dosis Mut, zumaj, wenn der starke. Bundesgenosse nichts davon hören will. Ignaz Seipel, der Lehrer der Moral, besaß diese Zivilcourage.
Ich freute mich, ihm bei seinen Friedensvorträgen im Saale des Arbeiterinnenvereines behilflich sein zu können. Draußen an der Front hatten wahrlich die Musen geschwiegen. Die Sprache des Krieges ist rauh wie sein Handwerk, das wohl die Errungenschaften in Wissenschaft und Technik nutzt, mit dem Leben des Geistes aber wenig gemein hat. Um so nachhaltiger erlebte ich nun die starken Eindrücke der Persönlidikei Seipels, bewunderte seine überlegene Intelligenz, das profunde Wissen dieses modernen Polyhistors, seine meisterhafte Sprache, die jede feine Nuance des Ausdruckes zu eindringlicher Wirkung verwendete, und genoß die erquickende schlichte Liebenswürdigkeit seines Umganges. An die Front zurückgekehrt, erwog ich oft das Erlebnis dieser Begegnung und nahm dankbar als Geschenk der Vorsehung den Befehl entgegen, der midi im letzten Kriegsjahre wenige Monate vor dem traurigen Ende in Anerkennung der 45 Monate langen Frontverwendung zu friedlicherer Tätigkeit nach Wien versetzte, wohin inzwischen auch Seipel aus Salzburg zurückberufen worden war. Der junge Kaiser, dessen guter Wille ein besseres Schicksal verdient hätte, sah in ihm einen seiner Ratgeber und holte ihn schließlich in die letzte k. k. Regierung. Ob Seipel wußte, daß es schon zu spät war? Jedenfalls tat er unerschrodten, was Erkenntnis und Gewissen ihm geboten, um das alte Donaureidi als Pfeiler friedlicher Ordnung, wechselseitigen Güteraustausches und kultureller Befruditung in den von so vielen Völkern bewohnten Landschaften zwischen den Karpaten und der blauen Adria zu erhalten. Er sah voraus, daß die Sprengung dieses Pfeilers anhaltende Gleichgewiditsstörungen in diesem von der Natur geformten weiten Räume und, von ihm ausstrahlend, in ganz Europa herbeiführen würde. Jedoch war es zu spät. Die letzten kaiserlichen Regierungen konnten den ' Auftrag, die Großmacht in einen Bund freier Völker umzubauen, nicht mehr vollführen, sondern nur den unvermeidlich gewordenen Übergang zu der von den Siegern gewollten Systemlosigkeit der Nachfolge- , Staaten von Blutschuld freihalten. So kam es, daß damals der k. k. Minister und der republikanische Staatssekretär kurze Zeit nebeneinander in Frieden amtierten, beide in der ernsten Stimmung einer historischen Wende, ein Zeugnis verfeinerter politischer Schule vor aller Welt erbringend.
In diesen Herbsttagen des Jahres 1918 wurde meine Zusammenarbeit mit Seipel schon dadurch sehr innig, daß wir beide dem Siebenerausschuß der Wiener katholischen Vereine angehörten, der ins Leben trat, um dem Volke in der um sich greifenden allgemeinen Verwirrung Rückhalt und Vertretung zu geben. Ein großer Teil des Wiener Volkes war damals — bis zu den Wahlen in die verfassunggebende Nationalversammlung — fast ohne Vertretung im Parlamente. Die provisorische Nationalversammlung bestand aus den im Juni 1911 gewählten Abgeordneten, deren Mandat also abgelaufen war. Dazu kam, daß bei den Juniwahlen gerade in Wien eine widernatürliche, man darf wohl sagen, unsittliche Koalition untereinander verfeindeter Parteien, Sozialisten und Kapitalisten, Rassenantisemiten und liberaler Juden, mit geringen Stichwahlmehrheiten die meisten bisher christlichsozialen Mandate sich angeeignet hatte. Mochte man in der Not der Zeit die Herleitung der Vollmacht jener provisorischen Nationalversammlung aus diesen Juniwahlen ohne Widerspruch ge-sdiehen lassen, solange es um Provisorien ging, so durfte doch beim Aufbau eines neuen Staatsgebildes die starke Wiener Minderheit nicht ohne Stimme bleiben. Auch diese Funktion fiel dem Siebeneraussdauß zu, dessen Vertreter wiederholt an' Sitzungen der Vereinigung christlidasozialer Abgeordneter -teilnahmen und das Denken und Wollen ihrer Kreise vertraten, meistens freilich ohne Erfolg. Vergeblich erhoben wir Protest gegen die voreilige Entscheidung in der Frage der Staatsform und der Selbständigkeit. Unsere Einwände und namentlich der Hinweis, daß solche Entsdieidungen die Zuständigkeit und Vollmacht von Abgeordneten, die unter anderen Verhältnissen gewählt wurden und' deren Mandate abgelaufen waren, überschreiten, verhallten im Lärm der Drohung mit der Straße, ebenso wie die Warnung, daß solche arge Geburtsfehler auf die junge Demokratie, auf die man sich mit schallenden Redensarten so viel zugute tat, bedenkliche Schatten werfen, das Vertrauen in die Legitimität der Republik bedrohen und eine gärende Sorge um die Sicherheit der staatsbürgerlichen Freiheiten erzeugen müßten, die Not des Volkes und die Krise des staatlichen Lebens aber eine vertrauensvolle Einigkeit der Bürger verlangten.
Damals war Seipel unermüdlich tätig, um die Gesinnungsfreunde zu beraten, Klarheit über die moralischen Pflichte* m schaffen und dort, wo mit oder ohne Grund Divergenzen in grundsätzlichen Fragen auftraten, die Spaltung zu_ verhindern. Er sah in der von Lueger gegründeten Partei den unentbehrlichen und wichtigsten Träger der österreichischen Tradition und das zuverlässigste Werkzeug des neuen Volksstaates. Seipel gab sich keiner Täuschung darüber hin, daß die eisernen Würfel des Schicksals gegen die Monarchie gefallen waren, er wollte afcer vermeiden, daß die vielen, die ihr aus Anhänglichkeit an das Kaiserhaus oder aus sachlicher Überzeugung die Treue hielten, in eine grundsätzliche Opposition zum Staate gedrängt würden. Und er wehrte sich mit Energie dagegen, daß ein frivoler Snobismus das über das Haus Österreich hereingebrochene schwere Geschick zur Erniedrigung der großen Geschichte des alten Vaterlandes mißbrauchte. So wuchs er in •eine Mission hinein„ nicht nur das geistige Haupt der ihm gesinnungsmäßig verwandten weiten Kreise, sondern, bestritten oder umrubelt, der “Wortführer des Volkes zu sein, mehr noch, das Gewissen des Landes. Mit unbeugsamem Mute erhob er seine mächtige Stimme, um die Verantwortung der Welt für Österreich und österreidis vor der Welt hervorzuheben, in der inneren Politik die vitalen Notwendigkeiten der staatlichen Gemeinschaft gegen den sacro egoismo politischer Faktoren zu schützen und dem Volke in-mioten des Alltagslärmes fundamentale Wahrheiten ins Gedächtnis zu rufen.
Alles war einig, daß dieser bedeutendste Mann Österreichs in das Parlament entsendet werden müsse und mir fiel die Aufgabe zu, dafür zu sorgen, daß die christlichsozialen Vertrauensleute des ersten, dritten und vierten Bezirkes seine Kandidatur an zweiter Stelle nach dem Listenführer, Bürgermeister Dr. Weiskirchner, beschlössen. Im dritten Bezirk gab es eine ergötzliche Sdiwierigkeit: Ein durchaus wackerer Mann, der als Vertreter des katholischen politischen Kasinos Landstraße seit langer Zeit dem Gemeinderat angehörte, hatte Bedenken, weil Seipel damals nicht im Bezirke wohnte . . . Nun, es kostete midi wenig Mühe, den einstimmigen Beschluß der Vertrauensleute herbeizuführen; denn auch dieser brave Bezirkspolitiker verbeugte sich achtungsvoll, als ich die Persönlichkeit Seipcls hervorhob. Im „Klub“, wie die Vereinigung der christlichsozialen Abgeordneten des Nationalrates kurz genannt wurde, übernahm Seipel zunächst die Leitung eines Arbeitsausschusses, in den alle zum erstenmal gewählten Abgeordneten entsendet wurden, um dort nicht nur in die Arbeitsmethoden des Parlamentes und der Regierung, sondern auch in die sachlichen Probleme der einzelnen Gesetzesvorlagen eingeführt zu werden. Als ich im folgenden Jahre, Oktober 1920, aus dem gleichen Wahlkreise in den Nationalrat entsandt wurde, schlug mich Seipel selbst als seinen Nachfolger in der Leitung dieses Arbeitsausschusses vor, damit die Methodik, in der wir übereinstimmten, beibehalten werde.
Seipel schenkte mir die Ehre und Freude einer vertrauensvollen Freundschaft. Und doch hinderte die herzliche persönliche Beziehung uns nicht, sachliche Meinungsver-sdiiedenheiten öffentlich auszutragen. So geschah es, als ich, seit dem Ende des Jahres 1918 Gemeinderat der Stadt Wien und.im dortigen Verfassungsausschuß tätig, in der sehr schwierigen Frage, wie die Stellung Wiens im Rahmen des Bundesstaates zu regeln sei, in der „Reidispost“ meinen Standpunkt vertrat, gegen den Seipel, der parlamentarische Referent der werdenden Bundes-. Verfassung, Einwendungen erhob. Ich gestehe gerne, daß seine Dialektik mir überlegen war. Nach den für die christlichsoziale Partei siegreichen Wahlen des Oktober 1920 wurde Seipel zum Obmann des Klubs gewählt. Er , hatte sich nicht leicht entschlossen, nochmals zu kandidieren. Ich erinnere mich an eine Reihe von langen Unterredungen, in denen er mir die Beobachtungen und Erfahrungen rüddialtlos erzählte, die ihm die Politik verleideten. Meistens führten wir diese Gespräche auf Spaziergängen und einmal, es war am Vorabend des Tages, an dem er sidi für oder gegen sene Kandidatur entscheiden mußte, legten wir beide den Weg von der Landstraße bis in die Gentzgasse so oft, hin-und herwandelnd, zurück, daß Seipel eine Ausnahme von seiner ehernen Tagesordnungm machte und wir erst nach Mitternacht uns trennten. Die Stunde ist noch nicht gekommen, in der persönliche Einzelheiten in das grelle Licht der Öffentlichkeit gerückt werden können. Seipel war immer bemüht, den Willen der Vorsehung zu erkennen und dann diese Mission zu übernehmen und durchzuführen, kostete es ihn noch so viel. Er fragte sich damals, ob nach der Erledigung der Bundesverfassung, sohin der Sicherung eines geordneten politischen Lebens im Staate, er selber noch eine echte Sendung in der Politik zu erfüllen habe. Dagegen schien ihm der Widerstand zu sprechen, auf den er gerade bei einzelnen einflußreichen geistlichen Kollegen zu stoßen glaubte. Er hat als logischer und willenskräftiger Denker immer die klare Geradlinigkeit auch in der Politik verlangt. Daher trat er für eine ehrliche Scheidung der Parteien untereinander, der Mehrheit und der Opposition, der Parteien und der echten Staatsinteressen, der privaten Bereiche und der öffentlichen Funktionen ein. Wenn der Ausdruck gestattet ist, hatte Seipel die Uberzeugung, daß jedes Gemeinschaftsleben sein Wohlfahrtsziel nur dann erreidien kann, wenn die einzelnen Organe ihre besondere Aufgabe, nach der ihnen eigenen sachlichen Gesetzlichkeit und Zuständigkeit selbsttätig erfüllen, jedoch dem höheren Gesamtwohl sich unterordnen. Im Zusammenklange dieser Autonomie und Harmonie sah Seipel die Garantie für die gedeihliche politische Entwicklung eines demokratisch geordneten Staates, ja, gerade für diesen schien ihm die Voraussetzung der Harmonie besonders wichtig, weil die demokratische Selbstbestimmung, die an der Grenze des Gemeinwohls haltzumachen hat, damals zur bewußten Überschreitung dieser Grenze zu neigen schien. Wenn auch die kurze Zeit, die seit der Neuordnung Österreichs verstrichen war„ eine gesunde Entwicklungstendenz erhoffen ließ, hielt Seipel daran fest, daß gerade die Christlichsoziale Partei die Aufgabe habe, für die Durchsetzung klarer und gesunder Grundsätze im politischen Leben zu sorgen. Ich mußte Seipel recht geben, wenn er sagte, daß das Kräftespiel der Parteien in der Bildung von Mehrheit und Minderheit zun-, Ausdruck kommen müsse und daher für die eine wie für die andere klar abgegrenzte Funktionen, Wirkungskreise und Verantwortungen gegeben seien, die nicht verwischt und vermischt werden dürften. Seipel fühlte gewiß nicht in sich den Beruf zum kleinlichen Splitterrichter, er war nachsichtig und großmütig in der Beurteilung menschlicher Schwächen, doch sah er mit begreiflichem Bedauern, daß da und dort keimhafte Versuche auftraten, aus denen die der Politik nicht selten drohende Gefahr der Vermengung materieller Einzelinteressen mit der Ausübung öffentlicher Macht sidi entwickeln konnte. Die Schärfe seines Denkens hieß ihn ferner, dagegen aufzutreten, wenn an sich wichtige, jedoch nicht zu den verfassungsmäßigen Organen der politischen Willensbildung zählende Faktoren ihren Bereich verlassen und in die Politik sich einmischen wollten.
Ich gehörte zwei Regierungen an, deren Bundeskanzler Seipel war. In diesen mehr als fünf Jahren bewunderte ich immer wieder die Gewandtheit, mit der er die Beratungen de'r Minister leitete. Mit profes-soraler Genauigkeit sah er darauf, daß die Tagesordnung gut vorbereitet und ordnungs-' gemäß erledigt wurde. Als Chef der Regierung aditete er sorgfältig die Zuständigkeit des einzelnen Ministers. Seine organische Auffassung des Lebens trat auch hier zutage: Er hielt grundsätzlich dar.an fest, daß in Ressortfragen der Ressortminister das maßgebende Wort habe, daher verlangte er von diesem Fleiß, Initiative und Verantwortungsfreudigkeit. Ein Bundesminister, der diese Eigenschaften besaß, konnte immer sicher sein, von Seipel im Ministerrat, im Parlament ond, wenn es notwendig war, vor der Öffentlichkeit unterstützt zu werden. Die politische Führung der Regierungsgeschäfte hielt selbstverständlich er in seinen ruhigen und festen Händen; eine politische Extratour eines Ministers überließ er freilich dessen persönlicher Geschicklichkeit. In der Debatte verlangte er eine schlüssige sachliche oder politische Argumentation. Diese Haltung verband er mit so liebenswürdigen Formen, daß er auch kritischen Augenblicken die Schärfe nahm. Den Außenstehenden und auch den Gegnern gegenüber loyal, war er seinen Mitarbeitern und erst recht seinen Freunden der treueste und zuverlässigste Freund. Auf sein Wort konnte man bauen, er löste es immer ein, soweit es an seiner Person lag, auch dann, wenn diese Treue ihm Unannehmlichkeiten eintrug. So hätte er die eigene Stellung als Kanzler gegenüber den Kritikern sich erleichtern können, wenn er in den Fragen der Währung und der Staatsfinanzen zu Konzessionen bereit gewesen wäre; er aber stand zu seinem Finanzminister, weil er zu ihm, seiner Person und seiner sachlichen Kompetenz volles Vertrauen hatte.
Am Abend des 1. Juni 1924 nahm ich an einer Zusammenkunft des Glockenkomitees der Pfarre St. Rochus und Sebastian teil, als mir plötzlich ins Ohr geflüstert wurde, Seipel sei von einem Attentäter tötlich verletzt. Ich eilte in das Wiedner Krankenhaus und stand mit Dr. Kienböck am Bette des Schwerverwundeten. „Nun müßt ihr euch um einen anderen Kanzler umschauen“, sagte er zu uns und als wir ihm antworteten, er möge jetzt nur an seine Genesung denken, vir würden schon das Unsere tun, da nickte er mit einer müden Handbewegung, denn der Blutverlust hatte ihn sehr geschwächt. Trotz Diabetes und Lungenkavernen überstand er den ersten starken Schock und erholte sich langsam. Mir unterstanden damals auch die Wiener Fonds-Krankenanstalten; daher war ich täglich dort, sah zum Rechten und wohnte der Besprechung des Ärztekollegiums bei. Ich erinnere mich an die Trauer, die mich plötzlich streifte, als ich in der Dunkelkammer das Röntgenbild sah, der Arzt mir die Lage des Geschosses zeigte und mit ernstem Tone auf die • Kavernen in der Lunge hindeutete. Von dort sollte die endgültige Gefahr kommen. Auch diese Zeit trüber Sorge um ein teures Leben blieb nicht ohne fröhliche Lichter des Humors, den Seipel so sehr liebte. Wenn die weißbemäntelten Ärzte, geführt von Eiseisberg, am Morgen das Krankenzimmer betraten, dann mußten sie gefaßt sein, mit einem Scherze begrüßt zu werden, der auf ihre Kosten ging. Einmal aber war er unfreiwillig selbst das Objekt. Das Konsilium hatte ihm ein Glas leichten Weines als Schlafmittel angeraten und die Pflegerin füllte das Gläschen, bis Seipel einschlief. Als er aus dem tiefen Schlaf erwachte, verriet ihm die gute Schwester, daß er, der so abgetötet lebte, diesmal ungewöhnlich viel getrunken habe. Er aber wollte es erst glauben, als sie ihm die zwei leeren Flaschen vorwies. Da lachte er selbst.
Das bitterste Erlebnis, schmerzlicher als das Attentat des Sozialisten Jaburek, den er selbst gegen die erregte Menge geschützt hatte, wurde für Seipel der 15. Juli 1927. Die Regierung hatte keinen Vorwand geboten, daß es zu den gewalttätigen Ausschreitungen kam, als deren Fanal die Flammen des in Brand gesteckten Justizpalastes aufloderten, der gar nicht der Schauplatz des unglückseligen Schattendorfer Prozesses gewesen war. Nach allem, was vorausgegangen war, konnte man die leidenschaftliche Erregung der sozialistischen Kreise, die den Freispruch des Schwurgerichtes als einen bösen Justizirrtum betrachteten, verstehen, überraschen mußte es, daß sie nicht gegen das allein dafür verantwortliche unabhängige Schwurgericht gewendet wurde, sondern gegen Seipel, den eine seinen Ausspruch aus dem sinngebenden Zusammenhang lösende Propaganda als „Prälaten ohne Milde“ hinstellte, um Austritte aus der katholischen Kirche zu inszenieren. Der harte Stoß traf nicht den Bundeskanzler, er traf den Priester Ignaz Seipel. Diesmal saß die Wunde tiefer als am 1. Juni 1924 und nicht die kranke Lunge blutete, sondern ein edles Herz war schwer getroffen, ein kostbares Leben von Tragik verdüstert.
Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, daß Seipel sich von diesem Schlage rucht mehr erholen konnte. Er ließ es mich erkennen, als er mir zu Ostern 1929 die Gründe seiner . unerwarteten Demission darlegte, und bei anderen Gelegenheiten, wenn er die strenge Kontrolle über sein inneres Leben in vertrauter Stunde lockerte. Denn Seipel war vor allem der Priester, der Diener Gottes. Er ertrug sehr viel, wenn bloß seine Person darunter litt, es ging ihm an die Lebensfreude, als unter Berufung auf ihn unsterbliche Seelen in schwere Gefahren gedrängt wurden. Und doch hat es die Seelengröße dieses Mannes vermocht, auch diese bittere' Heimsuchung, ohne sie dem Gegner nj.chzu- ' tragen, in demütiger Ergebung zu überwinden.
Immer wieder blättere ich in den Tagebüchern des verewigten großen Freundes und jedesmal steigt aus meinem Herzen, aus meiner lebendigen Liebe zu ihm ein Wunsch wie ein Gebet empor: Möge das frühe Opfer dieses reichen und schönen Lebens unserem Volke und Lande ein strahlendes Licht sein auf dem Wege redlicher Selbsterkenntnis, auf dem Wege zum dauernden inneren Frieden!