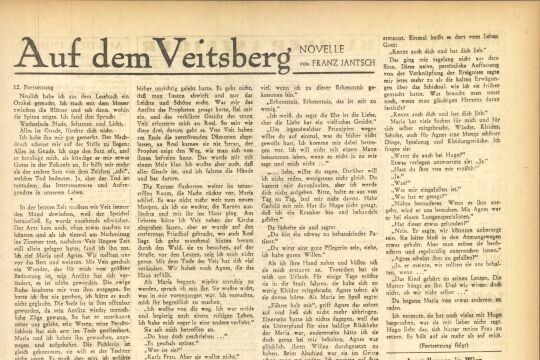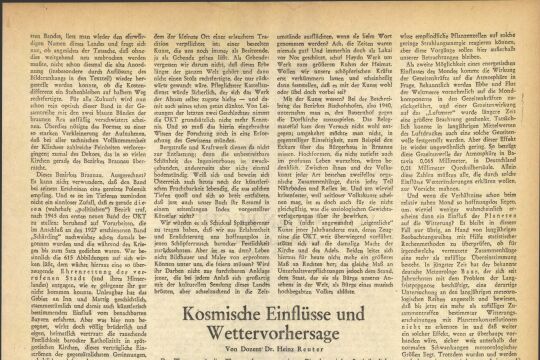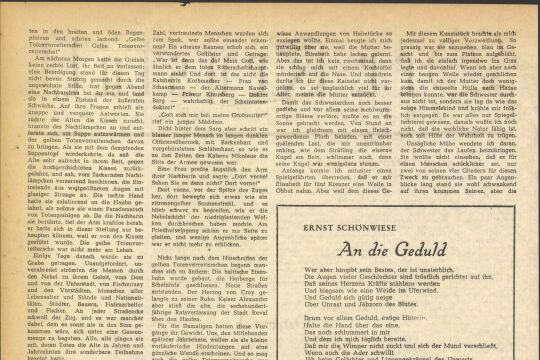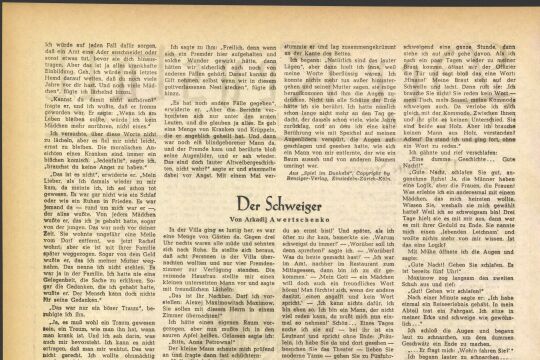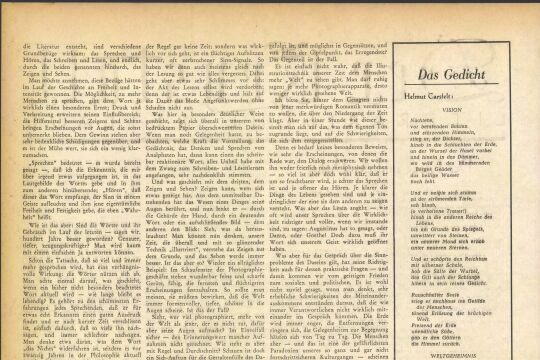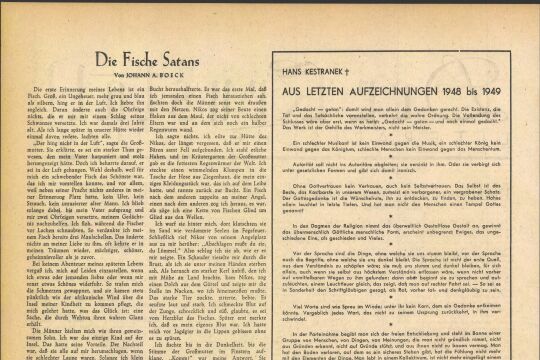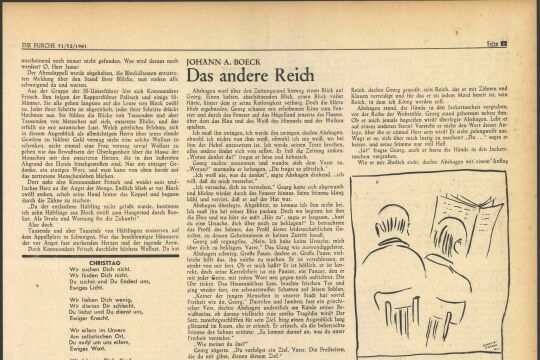Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Erste Begegnung mit einem Dichter
Ich war ehn Jahre, vielleicht schon elf, als ich mit meinen Eltern einen Teil der Sommerferien in dem am Hange des Wechsels lieblich gelegenen Mönich-kirchen verbrachte. Als ich einige Tage nach unserer Ankunft an der Hand eines Bekannten des Vaters durch das Dorf ging, denn Mönichkirchen war damals noch ein Dorf, begegnete uns ein stattlicher Mann, vor dem mein Begleiter in tiefer Verehrung den Hut zog. „Wer ist denn das?“ frug ich neugierig zu meinem Begleiter aufsehend. „Anton Wildgans, ein Dichter“, wurde mir geantwortet. Ein Dichter? — ich drehte mich schnell um, konnte jedoch nur einen breiten Rücken erspähen, da die kräftige, rasch ausschreitende Gestalt eben in eine enge Gasse abbog. Ich ärgerte mich, von einem Dichter nicht mehr als einen Rock und einen Hut gesehen zu haben, Dinge, die doch alle Männer trugen. Mein Begleiter meinte, während ich rückwärts hüpfend neben ihm hersprang, daß ich, wenn ich erst größer sei, die Dichtungen dieses Mannes mit Freude und Begeisterung lesen würde, da viel Schönes und Wahres, viel Einsicht und Güte in den “Büchern stünde, die des Dichters Hand niederschrieb.
Ich hörte nach dem einen Worte Dichter die Worte, die folgten, nur ungenau. Dieses eine aber beflügelte meine Phantasie. Ein Dichter grenzte in meinen Gedanken sehr an ein himmlisches Wesen. Er weiß, was viele nicht wissen, er kann das, was er fühlt, sagen und schreiben und eine wunderbare Welt vor Augen führen; eine Welt, die mich in Märchenbüchern bezauberte und mir die Umwelt so versinken ließ, daß ich oft, im seligen Bereiche eines erdachten Himmels dahinschwebend, nur schwer den irdischen Hügel wiederfand, auf dem ich fußfassend das werden mußte, was ich auf Erden vorzustellen hatte: keine Prinzessin und keine weissagende Fee, sondern ein Kind und, wie ich oft seufzte, nur ein Kind.
So einen Dichterzauberer gesehen zu haben, wenn auch nur von hinten, war viel. Ich lief, von Gefühl und Aufregung überwältigt, so schnell mich meine Füße tragen konnten, nach Hause. Ein dürftiges Mansardenzimmerchen war mein eigenes, kleines Reich. Hier setzte ich mich an das Fensterbrett und sah zu dem grünen Baum auf, der mit breitem Geäst in unserem Garten stand. So, als spräche ich zu ihm, sagte ich laut und jubelnd: „Ich kenne einen Dichter, einen Dichter!“
Schon am nächsten Tage begegnete mir der breitschultrige Mann wieder, dessen Anwesenheit in meinen Augen nun das Dorf wundersam verwandelte. Es war ein einmaliges Erlebnis, mit einem lebenden Dichter in einem gemeinsamen Orte zu wohnen, zu gehen und umherzuschauen. Ich folgte dem Angestaunten, Bewunderten in angemessener Ferne. Einmal sah ich ihm, als er stehenblieb und sich eine Zigarre anzündete, ins Gesicht. Es war ein volles, gutmütiges Gesicht, fast zu irdisch für den Dichter meiner Phantasie. Linkisch versuchte ich im Vorüberlaufen einen Knicks zu machen und küß die Hand zu sagen, doch bevor ich dazukam, den Mund zu öffnen, hatte sich das Antlitz bereits wieder abgewandt und ich stolperte wie ein scheu gewordenes junges Füllen über die Straße.
Eines Abends, als ich bereits im Bette lag und wieder' an meinen, denn heimlich nannte ich den Dichter meinen Dichter, dachte und was er jetzt wohl dichten würde, faßte ich den Plan; ihm von mir ein ewiges Andenken zu schenken. Bis mir vor Schlaf und Müdigkeit die Augen zufielen, überlegte ich, was es sein sollte. Endlich entschloß ich mich für eine Schlummerrolle und es fiel mir, schon halb im Traume, auch der Vers ein, den ich darauf sticken wollte. Am nächsten Morgen machte ich mich zeitig an die Arbeit. Ich strickte unter dem frühen blaßblauen Himmel mit wahrem Feuereifer, bis mich die Wirtin zum Frühstück rief. Da ich aber in der Kunst dieser Handfertigkeit sehr ungeübt war, fiel die Arbeit schlecht aus. Als meine Mutter sie ansah, trennte sie mein so selig begonnenes Werk vollständig auf. Sie meinte, es würde ein Topflappen zu Großmutters Namenstag, denn ich konnte auch zu ihr nicht über das sprechen, was meine Brust bewegte. Am nächsten Tag erging es mir mit meinen Strickversuchen nicht besser. Ich weinte, als mir die Mutter die Nadeln aus der Hand nahm und mich die Wolle wieder aufwickeln hieß. Nun beschloß ich, die Strickerei nicht mehr anzusehen, dafür aber aus bunten Stoffresten einen Tintenabstreifer zu nähen. Ich bastelte ihn heimlich und zeigte mein Werk, das bald vollendet war, keinem Menschen Ich fand es wunderschön. Obenauf saß ein rosa Seidenstückchen aus Mutters Bluse, darauf hatte ich mit roter Tinte, die leider ein wenig auseinandergeflossen war, geschrieben: „Unter deinen Kopf schiebe ich dieses Zeichen meiner Liebe“, denn der Vers war mir ja bei der Schlummerrolle eingefallen und ein anderer, neuer, wollte mir nimmer gelingen. Das einzige Gedicht, das nach langer Mühe noch aus der Feder floß, war dieses: „Wenn der Hund Haare hat, hat die Katz eine Schnute, ich wünsche dem Herrn Dichter alles Gute“, aber es gefiel mir doch nicht so gut als jenes mit dem Worte Liebe und so prangte das Blusenstück, wie ich es bereits fertiggestellt hatte, weiterhin als Zier und Krönung meines Werkes.
Die schwierigste Frage war und blieb, wo und wann ich das Geschenk überreichen sollte. Ich malte mir in meinen Träumen, denn mit offenen Augen träumen konnte ich jederzeit, die Begegnung ungefähr so aus: Im Abendschein lustwandelnd, trete ich frei und frank dem Dichter entgegen, der, von der Sonne umglüht, das edle Haupt in die Hand gestützt, unter einem mächtigen Baume ruht und in die Ferne sinnend dichtet. Er dichtet das Dorf an, in dem auch ich wohne. Mich erblickend, hält er im Dichten inne, „wohin eilst du, liebes Kind“, fragt, er. Ich mache einen tiefen Knicks und überreiche mit den Worten „zum ewigen Angedenken“ mein Geschenk. Der Dichter wickelt es aus dem grünen Seidenpapier und ist ergriffen. Stumm schüttelt er mir die Hände, vielleicht mit Tränen in den Augen. Dann sagt er: „Ich werde das schönste Geschenk, das ich je in meinem Leben erhielt, in Ehren und ewigem Angedenken erhalten.“ Nun erst liest er das
Gedicht. Uberwältigt von meinem Können nimmt er mich an der Hand und führt mich durch das ganze Dorf. Wer uns begegnet, muß mein Werk bewundern. Alle Leute zeigen auf uns und sagen: „Eine Dichterin spaziert mit einem Dichter...“
Allein die nächsten zwei Wochen vergingen ereignislos. Die schattigsten Plätze, Viie sonnigsten Wegleins, die ich autsuchte, blieben von dem einen, den ich so herbeisehnte, unbewandelt. Dreimal hatte ich schon das Seidenpapier des Geschenkes gewechselt und doch war diese dritte Garnitur abermals schmutzig geworden. Ich trug meine Gabe ständig bei mir, entweder im Schürzentäschchen oder im Ärmel der Dirndelbluse. Die Abreise in die Stadt und das Ende der Ferien rückte ständig näher, die Gelegenheit, meinen Dichter zu erfreuen, schwand täglich ein wenig mehr.
Eines Abends mußte ich meinen Eltern aus dem Wirtshause einen Krug Bier holen. Als ich mich in der Schank, den vollen Krug in der Hand, zum Gehen wandte, sah ich den Dichter an einem Tisch, nahe dem offenen Fenster, sitzen. Er hielt ein volles Glas in der Hand und trank. Ich trat in den Hausflur, nestelte das ' Geschenk aus dem Ärmel, nahm allen Mut zusammen, kehrte wieder um und warf — bei jedem Schritt, der mich näher an mein Idol heranbrachte, sank mein Mut tiefer und tiefer — meine Gabe, meine Botschaft der Verehrung auf den Tisch. Sie fiel, o wunderbares Geschick, genau auf die Untertasse des Bierglases und war nicht zu übersehen. Hochroten Gesichts und klopfenden Herzens stürzte ich aus der Gaststube.
Vor dem Fenster, hinter dem der Glückliche nun meine Zeilen lesen mußte, kauerte ich mich hin. Ich wollte Zeuge seiner Begeisterung werden und mich selbst so in einen Himmel heben, den schönsten Himmel, den ich mir bis zu diesem Tage ausgedacht hatte. Aber statt des verzückten „Ah!“ oder „Oh!“, das aus des Dichters Kehle auffliegen sollte, flog mein Geschenk, zuerst das zerrissene Papier, dann dessen Inhalt über meinen Kopf auf die Straße. Ich ließ den Bierkrug stehen und während ich die Scherben meines Glückes einsammelte, begann ich so innig zu weinen, so herzbrechend, daß ich irgend jemandem, der eben an mir vorüberging, erbarmte und mir eine Hand die nassen Wangen streichelte und mir liebevoll über das Haar fuhr. Ich konnte nicht aufsehen, ich war vor Tränen blind. Nachdem ich auf die Fragen, warum ich so weine, nicht antwortete, sagte eine freundliche Stimme: „Wein' dich nur aus, Mäderl, wein' nur.“ So nahm ich schluchzend meinen Bierkrug wieder auf und ging, von dem Unbekannten geleitet, über die Straße.
Da ich so lange ausgeblieben war, eilte mir hier mein besorgter Vater entgegen. Nun stand er vor mir. Ich fühlte, wie eine Hand mich verließ und sich gleich darauf die Hand meines Vaters um meine Finger schloß. Nach der ersten Frage, warum ich weine, wieder konnte ich sie nicht beantworten, stellte mein Vater die zweite: „Weißt du, wer eben neben dir gegangen ist?“ Ich schüttelte den Kopf. „Das war Anton Wildgans, der Dichter“, sagte der Vater. Meine Tränen stockten. Noch schluchzend wollte ich meinen Vater belehren, daß dies eine Unmöglichkeit sei. Als der Vater bei seiner Meinung blieb, bat ich ihn, mit mir zum Wirtshaus zurückzukehren und mein Vater, der mir nie einen erfüllbaren Wunsch ausschlug, ging mit mir das kurze Stück des Weges zurück. An dem offenen Fenster des Gasthauses vorüberschlendernd, flüsterte ich, einen Blick in die Stube werfend, dem Vater zu: „Vater, hier sitzt doch der Dichter.“ Meines Vaters Blick folgte meinen Augen. Lächelnd, ja behutsam klärte er meinen Irrtum auf. Nicht Anton Wildgans, sondern ein Selchermeister saß hier vor seinem Bierglas.
Der Dichter aber, mein Dichter, von dem dieser ganze Sommer erfüllt gewesen war, den ich tränenblind nicht einmal angesehen hatte und von dem ich nichts anderes kannte als seine Stimme und seine Hand, war längst in der einbrechenden Dämmerung verschwunden. Sosehr ich mir nun auch die Augen nach ihm aussah, konnte ich ihn doch nicht mehr erspähen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!