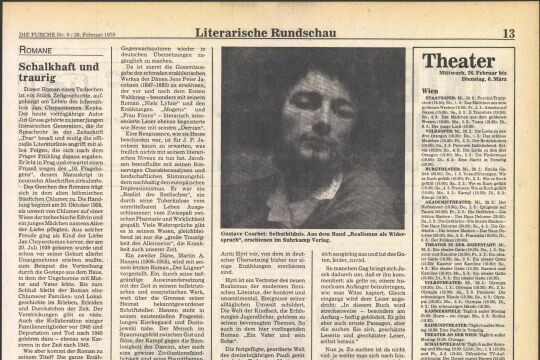bernhard Strobel Erzählt von Figuren in Einsamkeit und Sprachlosigkeit und mit bescheidener Aussicht auf Glücksmomente.
Das vielleicht bedeutendste Thema der jüngeren Literatur unserer Zeit ist Einsamkeit verbunden mit Orientierungslosigkeit in einer Welt, in der stabile Beziehungen zwischen Familienmitgliedern, Freunden und Partnern selten geworden sind.
In Texten von Alexa Hennig von Lange und Judith Hermann über Benjamin Lebert und Steffen Popp bis Thomas Stangl und Juli Zeh haben wir es mit Figuren zu tun, die nicht wissen, was sie wollen. Bei manchen jungen Autoren wird dies neuerdings mit einer sozialkritischen Perspektive verbunden – es ist nicht mehr das konsumgesättigte Ennui der Warenwelt, das die Leere erzeugt, sondern es gibt selbst im Negativen so rein gar nichts mehr, was dem Leser noch als tieferer Sinn der Geschichte angeboten würde. Der junge österreichische Autor Bernhard Strobel hat jetzt einen Band mit Erzählungen vorgelegt, der genau dies schon im Titel sagt, sogar doppelt: „Nichts, nichts“.
Viel geschieht nicht
Die neun Erzählungen beginnen mit einem älteren Ich-Erzähler, der seine Frau verloren hat und sich die Tage damit vertreibt, im Krankenhauscafé Passanten nachzusehen. Eine Beziehung mit einer früheren Freundin bahnt sich an, ob etwas daraus wird, bleibt offen. Der merkwürdige, mit religiösen Zeitschriften hausierende Bruder kommt vorbei und wird aus der Wohnung geworfen – viel mehr geschieht nicht.
Einsam und sprachlos
In der zweiten Erzählung scheitert ein einsamer alter Mann damit, einen Weihnachtsbaum zu kaufen und sich den Weihnachtsabend allein zu vertreiben. Auch dieser Text endet mit einem ambivalenten Schluss – die Tochter, die entdeckt hat, dass ihr Mann sie betrügt, quartiert sich bei dem Vater ein, dem sie damit wieder, wenn auch wohl nicht auf Dauer, einen Lebenssinn gibt.
Wohin man schaut, Einsamkeit und Sprachlosigkeit mit bescheidener Aussicht auf Glücksmomente – bei dem Ehepaar, das die alte, verwirrte Mutter betreut, bei dem Geschwisterpaar, deren Mutter sich ein Zubrot als Prostituierte verdient, bei dem schwarzen Schaf der Familie, das sich mit seiner Nichte anfreundet. Die titelgebende Erzählung, die sich an sechster Stelle findet, bringt das den Band durchströmende Lebensgefühl auf den Punkt: Markus und Lara haben sich, obwohl nach außen hin ihre Beziehung intakt ist, nichts mehr zu sagen. Auf Laras Frage, was er denn habe, antwortet Markus abschließend: „Nichts, nichts.“ Am besten gelungen ist vielleicht „Das Vogelhaus“, da es das kühle Entsetzen, das man bei der Lektüre verspürt, auch auf der Handlungsebene gestaltet: Der Ich-Erzähler und seine Frau sind zum Essen bei den Schwiegereltern eingeladen, er zögert die Abfahrt hinaus, sie fällt die Kellertreppe hinab und „sitzt heute im Rollstuhl“. Sie trennt sich von ihrem Mann, „es gab nichts mehr zu sagen“. Alle Figuren sind Betrogene und Betrüger in einer Person, so wie der Sandler, der den Flüchtlingen nur Unterschlupf gibt, weil sie ihm nutzen, und die er nur deshalb nicht verrät, weil er dadurch keinen Vorteil hat.
Fingerübung
Das Besondere an Strobels Prosa sind nicht die Geschichten, die, vom Alter und sozialen Umfeld der Figuren abgesehen, stark an Judith Hermann erinnern. Es ist die stark stilisierte Sprache, die dazu dient, die Entfremdung der Figuren von sich selbst und damit auch von anderen zu inszenieren, etwa wenn es über den Schwager des schwarzen Schafes heißt: „Er fand sichtlich Gefallen daran, Herr allen Fleisches zu sein.“ Man ahnt – Strobel kann erzählen; aber dieser Band kann höchstens als Fingerübung gelten.
Nichts, nichts
Erzählungen von Bernhard Strobel
Droschl 2010
120 S., geb., e 18,50
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!