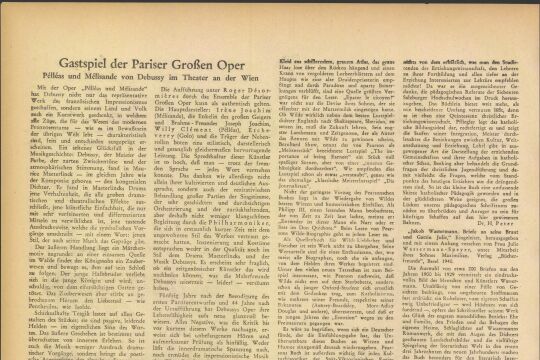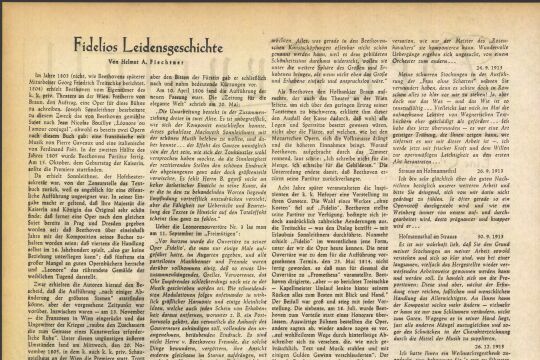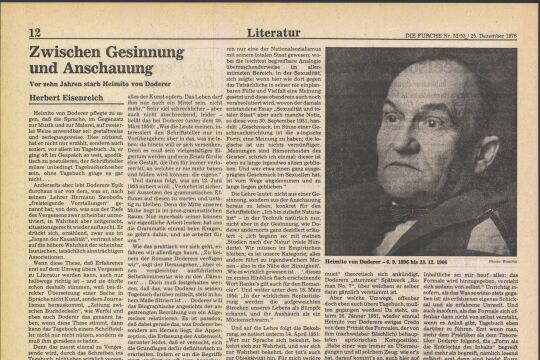Clemens Bergers Roman "Paul Beers Beweis" bleibt hinter den Möglichkeiten seines Plots immer wieder zurück.
Höflichkeit ist Klugheit", bemerkt Schopenhauer: "Höflichkeit ist [...] eine offenkundig falsche Münze: mit einer solchen sparsam zu seyn, beweist Unverstand, hingegen Freigebigkeit mit ihr Verstand." Unter diesem Aspekt muss man Clemens Bergers Buch loben, schon den Beo am Cover, einen sprachbegabten Rabenvogel, alles sehr rund und sehr sympathisch. Auch die Grundidee ist interessant und so freundlich wie der besagte Vogel am Titelblatt: Kann man - dem Vogel im Käfig ähnelnd - aus dessen Enge, gibt es die Möglichkeit, seine eigene Biografie neu zu schreiben, und zwar so, dass sich mit der Grafie das Leben ändert?
Die Frage stellt sich hier Josef Kelemen, und zwar mithilfe des im Titel schon genannten Paul Beer; Kelemen will sich, indem er sich vergisst, eben neu erfinden: als Franz Schwarz, der nicht Witwer von Marianne Kelemen ("1967-1998. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.") ist. Er erfindet sich, wird darin heil, un-bedingt. Gegenbild und in einer Gegenbewegung befindlich: Beer. Die wachsende Intimität Beers mit einer Bibliothekarin etwa zeitigt Distanz, Realität wird also am Schmerz erfahren, "Existieren kränkt", hat Franz Schuh einmal geschrieben.
Unbehagen an Heimat
Und hier liegt das Problem des so sympathischen Texts: Dieser Satz, dass Existieren kränke, fasst große Teile des von Berger Fabulierten bestürzend vollständig zusammen. "Ich muß das so ausführlich erzählen", betont eine Figur. Wirklich? Schon die Art, in der das Unbehagen an der Heimat - die das nur als vollendetes Nicht-Bedürfen einer solchen Korrektur und Neuerfindung der Vita wäre - das Thema eröffnet, ist platt: "Heimat war ihm ein unbekannter, verdächtiger, gleichzeitig ersehnter Begriff, der ihm den Mund pappig machte, aus dem er doch nie kam." Das wurde bei Bloch, Benjamin und anderen prägnanter und eleganter auf den Punkt gebracht, wie auch der Ausweg, das Lesen, das "ins Anderswo" fortträgt. "Paul Beer, ein Leben in Zitaten"; das wäre passabel, wenn nicht der Satz "Ich empöre mich, also bin ich" als 68er-Variation von Descartes vorangegangen wäre und der Satz folgte: "Eigentlich müßte man alles, was man sagt, unter Anführungszeichen setzen. Das Problem ist nur, die meisten kennen die Fußnoten dahinter nicht."
Nicht unsympathisch - aber man hört in Beschreibungen wie Dialogen das Papier rascheln, und zwar ohne dass dies eine stringente Folge des Erase & Rewind-Prinzips wäre, das da angeträumt wird. Ausnahme: einige Wortspiele, die Lebensformen skizzieren, so die des Esoterikers - "abwarten und grünen Tee trinken." Das ist dann nicht mehr so sympathisch, hat aber Witz; und eigentlich ist das wichtiger, sympathisch zu wirken ist ja keine genuine Qualität von Literatur.
Doch es folgen absehbar: Kruzifixe, "genetisch zum Nazi prädestiniert(e)" Kleinbürger, Liebesbeziehungen und Fußballgespräche. Diese Größen in der österreichischen Literatur kennt man, wobei letztere ein Rätsel bleibt - wenn heute in Österreich über Fußball geschrieben wird, dann ist das, als würden brasilianische Autoren über Skirennen schreiben.
Nicht unsympathisch
Inmitten dessen (er)findet sich Josef Kelemen jedenfalls mithilfe Paul Beers wieder, am Ende schließt sich ein weiter, aber nicht allzu gespannter Bogen. Das ist nun Heimat: "In diesem Moment [...] schlagen sein Herz und die Uhr im Gleichklang." Auch dies ist fragwürdig - man denke an die Polemiken wider solches Funktionieren, etwa bei Nietzsche: "Es schweigt mir jegliche Natur / beim Ticktack von Gesetz und Uhr." Kurzum: Das nicht unsympathische Buch, das aber hinter den Möglichkeiten seines Plots und vor allem der Sprache doch immer wieder zurückbleibt, endet so blass, wie es beginnt.
Paul Beers Beweis
Roman von Clemens Berger
Skarabaeus Verlag, Innsbruck 2005 168 Seiten, kart., e 18,90
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!