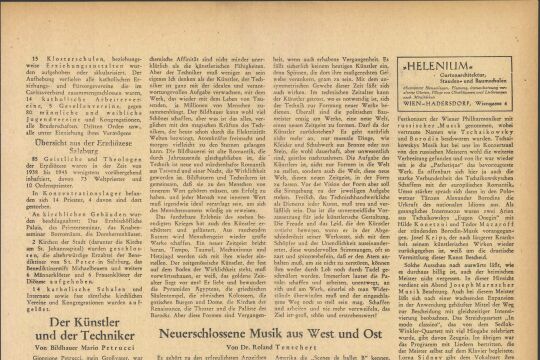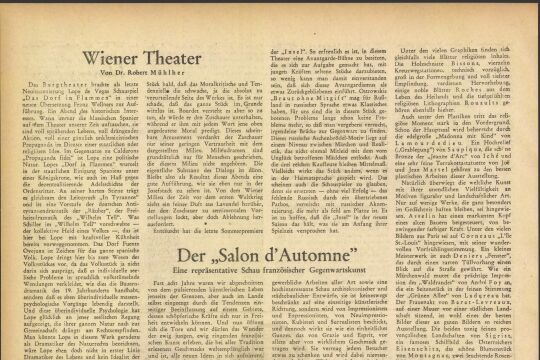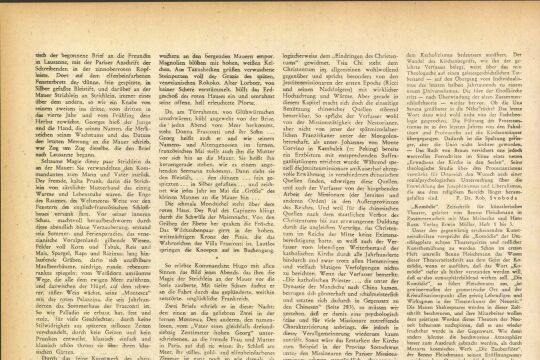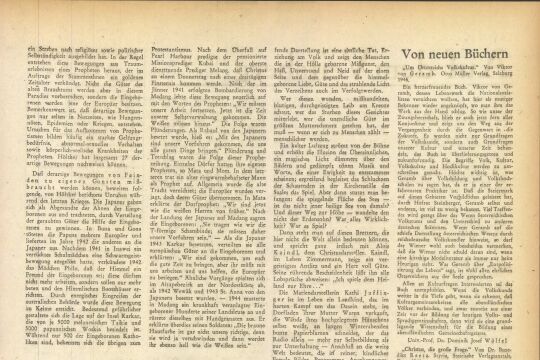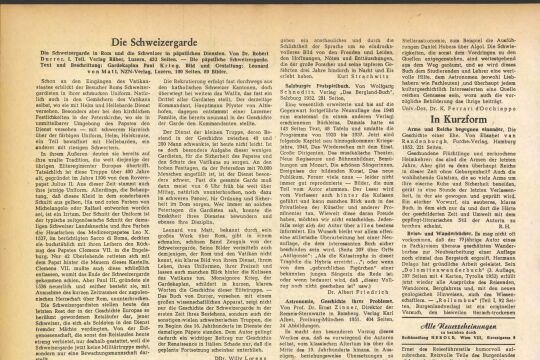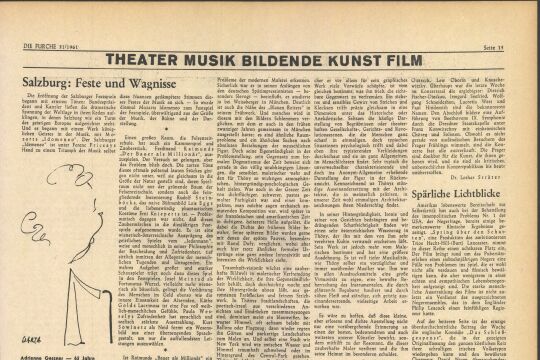Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Festspiele mit unbekanntem Haydn
Bei der Programmwahl der Bregenzer Festspiele 1963 hatte Direktor Ernst Bär eine besonders glückliche Hand. Die Premiere einer Oper von Josef H a y d n, die fast zweihundert Jahre alt ist, war ein Schuß ins Schwarze. Der Schöpfer der österreichischen Volkshymne hatte zwischen 1776 und 1778 für seinen Gönner, den Fürsten Nikolaus Esterhäzy in Eisenstadt, eine Marionettenoper geschrieben, deren Partitur im Jahre 1935 von der amerikanischen Yale-Universität ersteigert wurde. Dort wurde „Das brennende Hau s“, eine wahre Perle österreichischer Opernkunst, neu entdeckt und nun in Bre-genz zum erstenmal der Hörerschaft des Ursprungslandes vorgesetzt.
Die Handlung gestalten Hanswurst und Columbine, dazu der arme Bursche und der Vertreter des Dolce vita; aber was wird aus diesen traditionellen Gestalten des österreichischen Volksspiels gemacht! Die Verwandlungen des Hanswurstes, den das Naturtalent Oskar Czerwenka verkörpert, scheinen unerschöpflich, und Kurt E q u i 1 u z als der arme Bursche ist gleichfalls eine jener Volkstypen, die sich den Weg in die klassische Literatur gebahnt haben. Rosl Schweiger als melodienreiche Columbine, Heinz Hoppe und Claudio Nicolai in den anderen männlichen Hauptrollen runden das Bild, während Karl T e r k a 1 diesmal auf eine Episodenrolle gesetzt ist. Dazu kommt ein Bühnenbild von Ottowerner Meyer, das manchmal Gruppen schafft, von denen man kaum glaubt, daß sie sich bewegen können, sie sehen aus wie Augartner Porzellan.
So steigert sich die Wirkung eines alten Spiels auf die moderne Zuhörerschaft innerhalb von zweieinhalb Stunden von Bild zu Bild. Alles in allem eine der besten Leistungen der Bregenzer Festspiele in ihrer nun achtzehnjährigen Geschichte.
Die umfangreiche Seebühne führt diesmal nach Neapel. Im Hintergrund speit der Vesuv — keine lebensgefährliche Lava, da er sich, dem Bodensee entsprechend, mit Wasserkünsten begnügt. Auch hier ist dankenswerterweise die Wahl auf einen Altösterreicher gefallen, in dem Wiener, französische, italienische und durch seine Geburt in Dalmatien auch slawische Elemente einander kreuzen, den Cavaliere Francesco Ezechiele Ermenegildo S u p p i -D e m e 11 i. Mit der Handlung vom reichen und vom armen Bewerber, wobei letzterer die Hilfe des edelmütigen Banditen empfängt, zu rechten, wäre eiö vefgetltehes; Bemöien,“ mit der Musik' solcher ,iBtm-ditenstreiche aber könnte man sich noch einige Stunden länger befreunden. Willy Brokmeier und Claudio Nicolai konkurrieren miteinander als reicher und als armer Freier, ihre Gegenspielerinnen sind Helga Dernesch und Clementine Mayer. Ferry G r u b e r sorgt als Schulmeisterlein für die komische Note, alle werden von Jean Cox als dem großmütigen Räuberhauptmann überstrahlt. Das Wiener Staatsopernballett brilliert in unnachahmlicher Weise. Fast kommt das Auge noch stärker auf seine Rechnung als das Ohr, denn das Bühnenbild von Walter H o e s s 1 i n und die Inszenierung von Adolf Rott, der auch das „Brennende Haus“ inszeniert hat, beherrschen die wundervoll kostümierten Massen von Neapolitanern und Räubern besser als mancher Hauptmann seine Kompanie.
Und nun zum großen Wurf der Bregenzer Festspiele 1963, „Franziskus“ von Max Zweig. Es geht um eines jener Pro-blemstücke, über die man tagelang nachdenken kann, ohne sie bis zum letzten Tropfen auszuschöpfen.
Daß der Heilige von Assisi eine freie Gemeinschaft gottbegeisterter Männer und Frauen, keinen Orden mit fester Regel gewollt hat, ist bekannt. Es ist aber ebenso Tatsache, daß ihm die kirchliche Autorität außerhalb jedes Zweifels stand. Und jeder Mensch, der einmal versucht hat, in die Weltgeschichte zu blicken, weiß, daß auch die idealste Bewegung eines Tages vor der Tatsache steht, sich den irdischen Gegebenheiten anzupassen oder zu scheitern. Wer hieran Anstoß nimmt, stößte sich an der Fügung, die das Christentum unter Menschen gestellt hat.
Auch der feingeschliffene Dialog des Dichters kommt nicht daran vorbei, daß der Gegensatz zwischen dem gotterfüllten Menschen und dem Vertreter der kirchlichen Macht vergröbert wird. Den Satz „Ich beuge mich nicht“ hätte der geschichtliche Franziskus nie gesprochen. Kardinal Ugone hatte für Heiligkeit und Franz hatte für die Autorität Verständnis; sie waren Menschen des 13., nicht des 20. Jahrhunderts. Wer nicht tief genug mitdenkt, geht mit dem Eindruck heim, daß eben doch pfäffische Herrschsucht das Aufflammen wahren Christentums erstickt hat. Daß letzteres erst 600 Jahre später durch Papst Johannes XXIII. wiederentdeckt wurde, wie der .Prolog behauptet, geht etwas zu weit.
Vielleicht gelingt dem Dichter die Gestalt des Generalvikars Bruder Elia am besten, der die Form opfert, um das Wesen zu retten. Sancta Clara erwirbt Gutshof und Weingarten, errichtet aber ein Hospital für Aussätzige — liegt in dieser nur angedeuteten Episode nicht doch die Wahrheit, daß die zweite Generation einer überirdischen Bewegung ihre Aufgabe im sehr Irdischen findet, daß, auf Zweigs „Franziskus“ zurückzukommen, Kardinal Ugone letzten Endes das Ziel der franziskanischen Bewegung klarer erkannt hat als die ersten Gefährten des Heiligen?
Die Inszenierung von Josef G i e 1 e n und das Bühnenbild von Leni Bauer-•Evy •verrichten auf dankbare Szenen, sondern konzentrieren sich auf das Abstrakte. So kommt der Dialog stärker heraus, und dem ist gut so.
Josef M e i n x a d hat in der Titelrolle eine Aufgabe gefunden, die ihm eine riesige Spannweite von der Verzweiflung bis zur Entrückung bietet. Heinz Woester verkörpert die weniger dankbare Rolle des Elia, der gegen sein Gewissen handelt, weil er der Kirche lieber einen Heiligen geben will als einen Ketzer. Gerhard G e i s 1 e r spielt den Kardinal in nobler Würde und bemüht sich, seine Funktion nicht in klerikales Machtgefühl ausarten zu lassen. Von den Episodenrollen sei der Aussätzige erwähnt, dessen Aufschrei Andreas Wolf erschütternd ausstößt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!