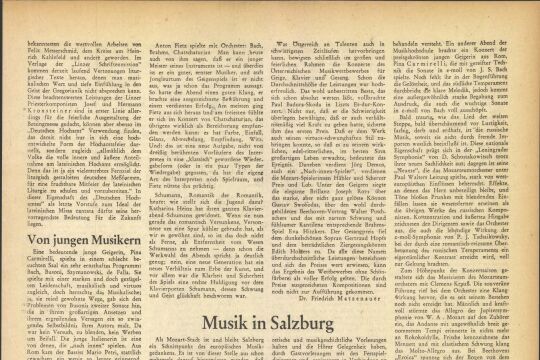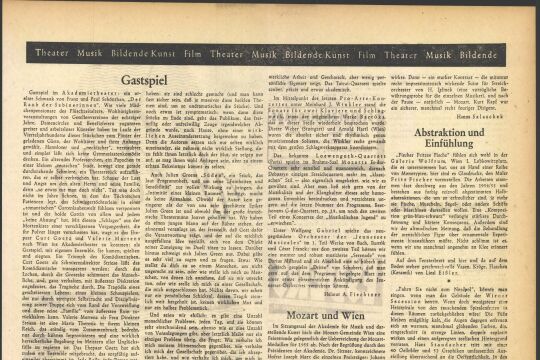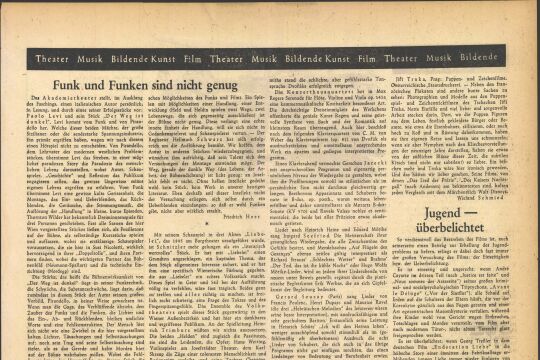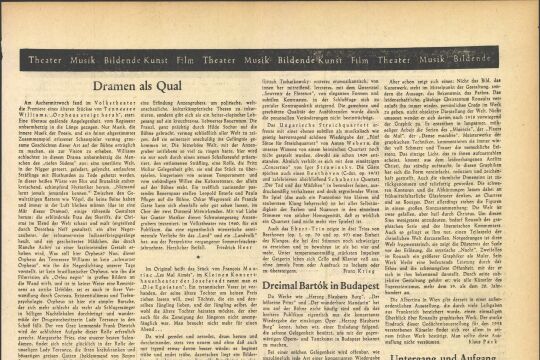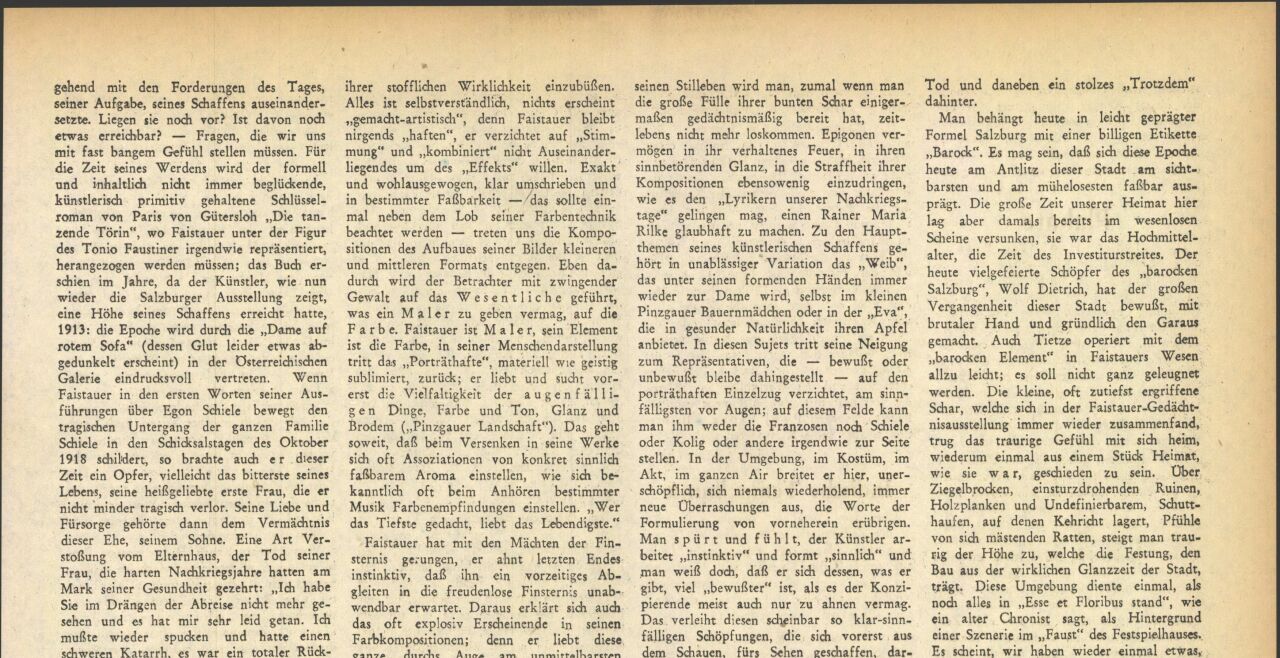
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Festspielkonzerte
Das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms ist eine Fortsetzung der gewaltigen geistlichen Chorwerke aus der barocken und klassischen Epoche. Dieses Werk gleicht jedoch, im Gegensatz zu dem katholischen Totenamt, das eine Fürbitte für die Ruhe der Entschlafenen ist, einer aufrüttelnden Predigt, die in eine Verherrlichung der göttlichen Majestät ausklingt. Die Worte, die Brahms frei aus der Hl. Schrift gewählt hat, sind voll Weisheit und Güte und sollen uns aus dem Dasein voll Mühsal hinlcnken zu himmlischen Freuden. Der Komponist hat die musikalische Ausdeutung der Bibelworte unter Aufbietung aller künstlerischen Kraft vollzogen. Das bedeutende Werk kam in der Festspielaufführung mit hinreißender Gewalt zum Ausdruck. Herbert Karajan, der Dirigent der verstandesmäßigen Deutung-, gab dem Werk eine fast klassische Größe. Er strebte von der Romantik weg und pflegte in der Führung der Chöre, auf die er sein Hauptaugenmerk legte, eine fein differenzierte Ausdrucksform.
In starkem Gegensatz zu dieser Aufführung stand das 6. Orchesterkonzert, das Artur Rodzinsky leitete. Er ist in Salzburg kein Unbekannter, denn schon 1936 erschien er am Pult vor den Wiener Philharmonikern und hatte mehrere Erfolge zu verzeichnen. Es scheint fast unfaßlich, daß zehn Jahre eine Wandlung bewirkt haben, wie wir sie jetzt erleben mußten. Schon die Oberon- Ouvertüre ließ befremdend aufhorchen, als die zarte, beschwingte Rhythmen belebte Musik vorbeiraste. In Beethovens I. Symphonie bilden nur Empfindungen freundlicher Natur den Kreis, den der Meister durchschreitet: Kraft, Lust, leichter Scherz, sprühende Heiterkeit und auch ein wenig Schwärmerei. Karl M. Weber nannte sie die „feurig-strömende“. Über Rodzinskys Auffassung zu diskutieren ist zwecklos, denn er durcheilte die Sätze in einer solchen Geschwindigkeit, daß die Einfachheit und die feierliche Wirkung der ruhigen Harmonien bis zur Unkenntlichkeit zerstört wurden. Die vierte Symphonie von Peter J. Tschaikowsky brachte er schon in den drohenden Fanfaren der Andante-Einleitung auf einen solchen Höhepunkt, daß jede dramatische Spannung verlorenging und die •leidenschaftliche Erregung des schmerzlich-unruhigen Motivs wirkungslos in eine Art Zirkusmusik ausartete. Das Publikum spendete den Philharmonikern Beifall, die den artistischen Rausch des Dirigenten ohne Zwischenfall bis zum Ende durchhielten.
Die Kammerkonzerte sind heute im Programm der Festspiele nicht mehr eine Ergänzung der großen Konzertveranstaltungen; durch die systematische und beständige Pflege im Laufe der Entwicklung gehören sie zu den wertvollsten Bestandteilen des Musikfestes. An die Spitze muß man in diesem
Jahr den Abend setzen, an dem sich Edwin Fischer, Georg Kulenkampff und Enrico Mainardi zusammenfanden, um Beethoven, Schubert und Brahms in, man kann sagen, vollendeter Improvisation zu Gehör zu bringen. Das fast improvisierte Auftreten der drei großen Musizierenden, ohne langes, zusammenschweißendes Üben, hatte jenen Reiz, der gut gepflegter Hausmusik anhaftet. Hier wurde edle Kunst in freudvollem Musizieren und technischer Meisterschaft dargeboten. Zum erstenmal leistete das ungarische Vegh- Quartett einen Beitrag zur Kammerkonzertreihe. Das von unbeschwerter Heiterkeit erfüllte Es-dur-Quartett von Mozart (KV 428) sowie das auf Beethovens letzte Schaffensperiode hinweisende Quartett Op. 59 wurden intonationsrein interpretiert, doch erkannte man in der geistigen Färbung der beiden Werke zu deutlich die Herkunft der Musizierenden. Völlig unpassend zwischen den beiden Großen der Musik stand die dekadente lyrische Suite von Alban Berg, die aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg stammt. Das Trio Pasquier machte uns mit einem Streichtrio des französischen Komponisten Florent Schmitt bekannt, das erst jüngst entstanden ist. Obwohl Schmitt noch zu den Impressionisten zählt, weist sein vier- sätziges Werk schon ein Streben nach festeren Formen auf. In rhythmisch-dynamischen Effekten und einer zerrissenen Melodik entspricht es wenig unserer Mentalität. Das Trio Pasquier, das zudem Beethovens Trio in D-dur op. 8 in ungewohnt herbem Ton spielte, sowie Mozarts Trio in Es-dur (KV 563) in gutem Kammermusikstil vortrug, zeichnete sich bei der Wiedergabe des Werkes ihres Landsmannes durch ausgezeichnete Bogenführung und überraschende Pizzi- catotechnik aus. Echt wienerisches Musizieren erlebt man immer wieder, wenn das Schneiderhan-Quartett mit Haydn, Mozart und Brahms die Reihe der Kammermusikabende abschließt. Lockere Beschwingtheit, bis ins letzte Piano klingende Kantilenen zeichnen diese feinsinnigen Musiker aus, die auch diesmal vom Festspielpublikum mit überaus herzlichem Beifall bedankt wurden. Einen Mißklang in die Reihe der Kammermusikabende brachten Schönbergs „Pierrot-lunaire- Melodram“ mit einem Ensemble, dessen Namen mit Ausnahme von Friedrich Wildgans’ gänzlich unbekannt sind. Es wäre an der Zeit, dieser „Kunst"-Richtung den Eingang zu den Festspielen zu versperren.
Eine liebgewordene Tradition sind die Serenadenabende mit Bernhard Paumgartner in der Felsenreitschule. Wieder erklangen Serenaden, Divertimenti und Cassationen Mozarts, die sonst nirgends mehr oder nur selten zu hören sind, an der stimmungsvollen Stätte. Immer aufs neue ist der Mozart-Kenner Paumgartner auf Entdeckungen aus, und manches kleine Orchesterstück zog er mit stilkundiger Hand zu Mozart-Suiten zusammen. Das Mozarteumorchester musizierte unter seiner Leitung vorzüglich.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!