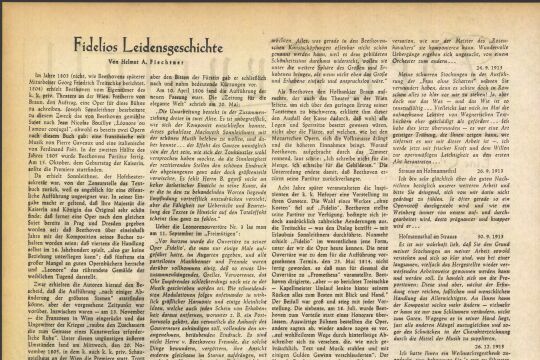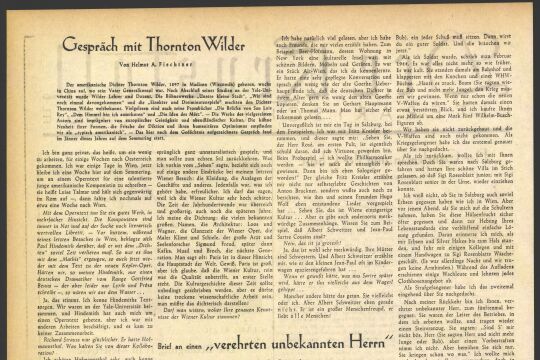Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Feuersnot und Frau ohne Schatten
Die B7iener Volksoper hat zur Feier des Richard-Strauss-Gedenkjahres sich eines Jugendwerkes angenommen, das ein Autor durchaus als „Vorspiel“ der folgenden Opernwerke aufgefaßt wissen wollte. Die Idee, darauf zurückzugreifen, war also gut. Das Werk ist es weniger. Und die Regie sowie die Ausstattung muß man wohl als nicht ganz geglückt bezeichnen. Den Text schrieb Ernst von Wolzogen, der Gründer des Berliner Kabaretts „Uberbrettl“, ein in Breslau geborener Wahlmünchner. Mit dem Titel hat es folgende Bewandtnis: Zur Strafe für einen ihr coram publico durch den Herrn Kunrad geraubten Kuß läßt die schöne Diemut, die Bürgermeisterstochter, ihren Verehrer in einem Aufzugskorb zwischen Himmel und Erde schweben. Da erlischt durch einen Zauber alles Feuer in der Stadt, und erst als Diemut dafür sorgt, daß Kunrad seine Liebesglut stillt, flammt das Feuer wieder auf. (Die zeithistorischen Parallelen mit München und Richard Wagner, um deret-willen die knapp anderthalbstündige Oper geschrieben wurde, interessieren kaum mehr.)
Während der ersten halben Stunde erweist sich Strauss in einer Musik als schon damals versierter Orchestertechniker und als Wagner-Epigone. Dann kommt ein Lied der Diemut, ein Duett und Orchestrales: da schillert es harmonisch und in den Instrumenten bereits in Salome-Farben. — Richard Strauss hat von 1898 bis 1900 an dieser Partitur gearbeitet, bereits 1901 war die Uraufführung in Dresden, Wien folgte 1902 mit der Erstaufführung unter Gustav Mahlers Leitung, 1912 war die Erstaufführung von „Feuersnot“ in der Volksoper mit Mizzi Jeritza (wie sie damals noch hieß) als Diemut.
In der Neuinszenierung der Volksoper waren die junge Helga Dernesch und Marcel Cordes die Protagonisten. Sie eine für diese Rolle bestens passende Erscheinung mit schöner, kräftiger, jugendfrischer Stimme, er ein durchaus beachtenswerter Partner. Peter Maag leitete das temperamentvoll und klangschön spielende Orchester mit Elan und sicherer Hand. Bühnenbilder und Kostüme von Ottowerner Meyer waren wie für die „Meistersinger“ en miniature. Natürlich kann man das so machen. Aber eine zeitlos-parodierende Ausstattung wäre mehr nach unserem Geschmack und nicht gegen die Intentionen der Autoren gewesen, die die. Handlung „zu fabelhafter Unzeit“ angesiedelt haben ... Die Regie von Adolf Rott war erstaunlich statisch. Der inmitten des Bühnenraums schwebende Förderkorb,eine riesige halbrunde Schale, die vo Geisterhänden hinaufgezogen und herabgelassen wurde, war keine gute Idee. Sehr merkwürdig auch, daß sich der Regisseur die Pointe, auf die die ganze Geschichte hinausläuft, hat entgehen lassen. Freilich ist auch die Musik nicht immer ehr animierend. Aus dem Sujet hätte beispielsweise Carl Orff etwa Lustigeres gemacht...
Von 1911 bis 1917 haben Hofmannsthal und Strauss gemeinsam an ihrem Opus magnum, der „Frau ohne Schatten“, gearbeitet. Den Sinn des an die „Zauberflöte“ anknüpfenden Märchen- und Zauberspiels umschreiben die Verse Goethes: „Von dem Gesetz, da alle Wesen bindet, befreit der Mensch ich, der sich überwindet.“ Wer dies erkannt hat, dem wird die als „schwer verständliche“ und „symbolbefrachtete“ Dichtung Hofmannsthals keinerlei Schwierigkeiten bereiten. Die Fabel ist denkbar einfach, die Ausführung allerdings dichterisch und, im besten Sinn, anspruchsvoll. „Sie ist einfc Festoper, wie die alten Barockopern“, schrieb einmal Egon Wellesz, „geeignet, den Zuhörer über seinen Menschenalltag hinauszuheben, für Stunden wenigstens die Verwandlung zu schaffen, welche die Brücke zwischen Traum und Wirklichkeit aufhebt.“
Jede Aufführung des Werkes bedeutet eine Kraftprobe für alle Ausführenden, die Herbert von Karajan als Dirigent und Regisseur, sein Bühnenbildner Günther Schneider-Siemssen, sämtliche Solisten und, natürlich, das Orchester der Wiener Philharmoniker gut bestanden haben. Es war, von häßlichen Nebengeräuschen abgesehen, über die wir an anderer Stelle berichten, ein festlicher Opernabend, dem Anlaß — zum 100. Geburtstag von Richard Strauss — wohl angemessen. Für die Gartenterasse über den kaiserlichen Gärten, das Haus Baraks, des Färbers, den Wald, in dem der Kaiser jagt und das unterirdische Gewölbe fand der Bühnenbildner schöne, poetische Lösungen. Die letzten, im Geisterreich spielenden Szenen, gerieten dem Regisseur und dem Bühnenbildner zu „kosmisch“ und waren dem Bereich des Märchens völlig entrückt, das symbolische „Wasser des Lebens“ (Regieanweisung: „Ein Springquell goldenen Wassers steigt leuchtend aus dem Boden auf“) hatte sich in einen bescheidenen Hausbrunnen verwandelt, die Phantasmagorie (Erscheinung des schönen Jünglings) war ein echter Bühnenzauber, aber wie man die übrigen Personen kurzerhand in der Versenkung verschwinden ließ, wirkte ein wenig dilettantisch. Bedenklich, wenn auch dramaturgisch begründet, sind die Freiheiten, die man sich bei der Umstellung und Zusammenziehung mehrerer Szenen des zweiten Aktes genommen hat sowie die Abweichung von den Regieanweisungen Hofmannsthals in der Gestaltung des Schlusses.
Die Darsteller der Hauptpartien (Leonie Rysanek und Jess Thomas — Kaiserpaar, Christa Ludwig und Walter Berry — Färber und Färberin, Grace Hoffmann , als dämonische Amme und Walter Kreppet — Geisterbote) befriedigten vor allem stimmlich. Der Kaiser sah eher wie ein Forstadjunkt aus, die Kaiserin eben wie Leonie Rysanek, der die Kostümzeichnerin Ronny Reiter (die im Ganzen Vorzügliches geleistet hat) nicht sehr zu Hilfe kam, und Barak, der Färber, war viel zu jung und gewandt („So ein Vierschrötiger, nicht mehr ganz Junger!“). Eitel Wohllaut, Gianz und prächtige Farben schlugen aus dem Orchesterraum: ein großer Abend des Orchesters und des Künstlers Karajan.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!