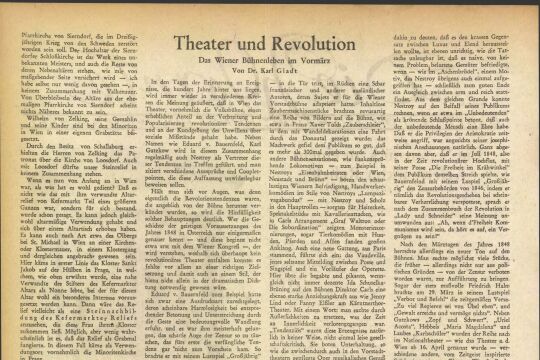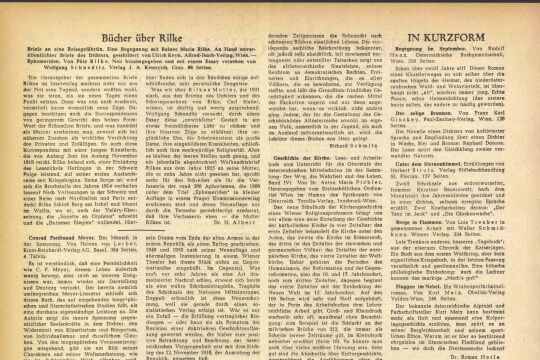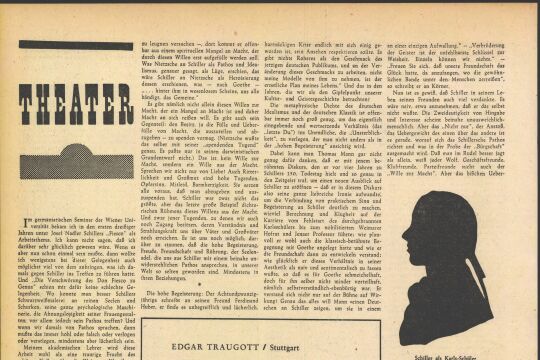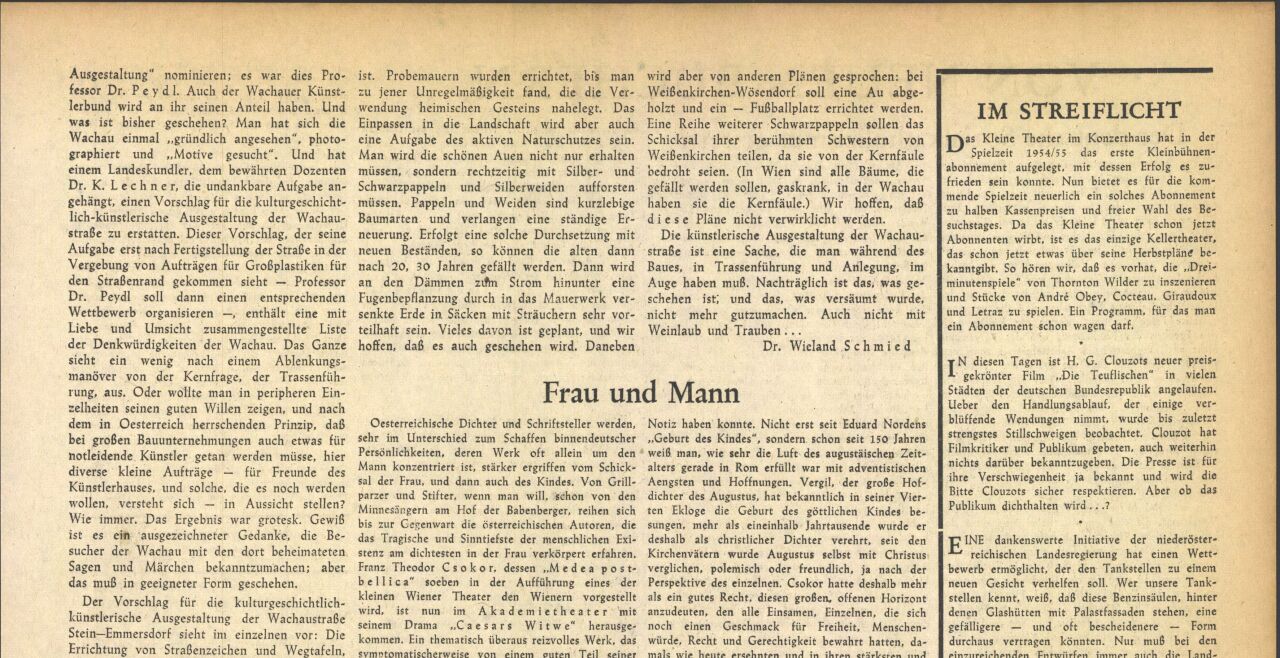
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Frau und Mann
Oesterreichische Dichter und Schriftsteller werden, sehr im Unterschied zum Schaffen binnendeutscher Persönlichkeiten, deren Werk oft aHein um den Mann konzentriert ist, stärker ergriffen vom Schicksal der Frau, und dann auch des Kindes. Von Grill-parzer und Stifter, wenn man will, schon von den Minnesängern am Hof der Babenberger, reihen sich bis zur Gegenwart die österreichischen Autoren, die das Tragische und Sinntiefste der menschlichen Existenz am dichtesten in der Frau verkörpert erfahren. Franz Theodor C s o k o r, dessen „M edea postbell i c a“ soeben in der Aufführung eines der kleinen Wiener Theater den Wienern vorgestellt wird, ist nun im Akademietheater mit seinem Drama „Caesars Witwe“ herausgekommen. Ein thematisch überaus reizvolles Werk, das symptomatischerweise von einem guten Teil seiner Beurteiler mit einem Spott bedacht wurde, der zu gleichen Teilen aus persönlichem Ressentiment und aus Unkenntnis der hier behandelten Sphäre und Atmosphäre stammt. Csokor stellt in diesem sehr österreichischen Stück in Calpurnia, der Witwe Caesars, den Menschen einer Zwischenzeit und Zwischenwelt vor, verdämmernd zwischen Tag und Traum. Nach dem Tode Caesars und der anschließenden Bürgerkriegsära ist eine merkwürdige „neue Zeit“ angebrochen, mit der Alleinherrschaft des Augustus, der von einer Masse schwacher, süchtiger Menschen fast gezwungen wird, den starken Mann zu spielen, obwohl er, klug, tüchtig, vorsichtig und hinterhältig (nicht aber hintergründig), in Wirklichkeit das Chaos in seiner eigenen Familie wie im spätrömischen Reich nur umstellen kann mit glänzenden Fassaden. Die Tragödie also einer Restauration und einer Restaurationspolitik, deren Träger selbst nicht an die Götter glauben, die sie öffentlich feiem und als deren Repräsentanten sie sich dem schauhungrigen Volk vorstellen. Das aber ist das Klima totaler Korruption; in ihm stirbt die Freiheit, die Herrschaft geht über an kleine Cliquen, an Polizeiherren; die Intellektuellen prostituieren sich, indem sie bezahlte Propagandisten des Diktators werden. Das aber ist auch die Stunde der Einzelnen und der Einsamen; diese ziehen sich notgedrungenerweise zurück aus dem verdorbenen öffentlichen Leben und suchen das innere Reich. Calpurnia vergilbt, verzehrt sich in einer kultischen und sehr persönlichen Verehrung ihres in ihren Träumen zum Halbgott überhöhten Gatten Caesar, findet deshalb auch nicht das rechte Wort, das sie sucht, um Augustus zu entlarven, der es sich anmaßt, den „Frieden“, die „neue Ordnung“ zu schaffen auf den Leichen seiner Gegner. Erst im Sterben findet die Frau dieses Wort; in einer Art Vision erscheint ihr der Eine, dessen Namen sie nicht kennt und nicht erkennt, als beseligende, erlösende Gestalt. — Csokor deutet diese Vision mit sparsamsten Mitteln sehr delikat an. — Spott darüber ist ganz unangebracht, ebensowenig wie der dilettantische Vermerk, daß Calpurnia von dem erst Jahrzehnte später sterbenden Christus keine Notiz haben konnte. Nicht erst seit Eduard Nordens „Geburt des Kindes“, sondern schon seit 150 Jahren weiß man, wie sehr die Luft des augustäischen Zeitalters gerade in Rom erfüllt war mit adventistischen Aengsten und Hoffnungen. Vergil, der große Hofdichter des Augustus, hat bekanntlich in seiner Vierten Ekloge die Geburt des göttlichen Kindes besungen, mehr als eineinhalb Jahrtausende wurde er deshalb als christlicher Dichter verehrt, seit den Kirchenvätern wurde Augustus selbst mit Christus verglichen, polemisch oder freundlich, ja nach der Perspektive des einzelnen. Csokor hatte deshalb mehr als ein gutes Recht, diesen großen, offenen Horizont anzudeuten, den alle Einsamen, Einzelnen, die sich noch einen Geschmack für Freiheit, Menschenwürde, Recht und Gerechtigkeit bewahrt hatten, damals wie heute ersehnten und in ihren stärksten und besten Vertretern auch ersahen. Alma Seidler gestaltet die Calpurnia sehr eindrucksvoll, mit Recht als eine österreichische Frau, in der Nachfolge Gtill-parzerscher Frauen.
Dem Manne Schiller gewidmet war die Feier der Bundesregierung im Burgtheater. 150 Jahre sind vergangen seit dem Tode dieses deutschen Dichters. Wir werden anläßlich der Besprechung der Festaufführung der „Kabale und Liebe“ dieses Phänomen, Friedrich Schiller, noch näherhin zu würdigen haben. Die Staatsfeier, die leider durch einige falsche Akzente getrübt war, hatte gleich am Anfang ihre Höhepunkte, in der Aufführung der dritten Leonoren-Ouvertüre Beethovens (die Wiener Symphoniker unter Rudolf Moralt) und in der Festrede des Unterrichtsministers Dr. Drimmel, die als ein Meisterwerk des bewußten Verzichts auf jede Rhetorik, in sachbezogener, problemgesättigter Darstellung ein politisch und kulturell wichtiges Dokument darstellt, als ein Bekenntnis zu Schillers Werk und Werten. Dann geriet die Feier leider in die Breite und eine verschwommene Weite; das ist nicht die Schuld des Vortrages von Albin Skoda, Raoul Aslan, Liselotte Schreiner; weniger wäre mehr gewesen. Schillers Pathos und Rhetorik verpflichtet heute zu sparsamsten Gebrauch, soll es sich nicht selbst um echte Wirkung bringen. Die von Ewald Baiser vornehm gelesene Schiller-Rede Max Mells, eine sprachschöne, gekonnte Gestaltung, die leider sehr viel Wichtiges umschweigt, gerade auch Schillers politische Gesinnung und seinen Charakter — man muß sie mit den Schiller-Reden von Theodor Heuß und Thomas Mann vergleichen —, führte hinüber zum zweiten Teil der Feier, zur Aufführung der gekürzten Reichstagsszene aus dem Demetrius-Fragment. Diese Aufführung brachte den Schauspielern und der Regie (Rott) ebensoviel Ehre wie einem Teil des Publikums Unehre ein, das sich dazu hinreißen ließ, beim Ruf, Krieg mit Moskau, wir wollen Krieg mit Moskau, demonstrativ zu applaudieren. Es wird zu erwägen sein, wie Staatsfeiern von Lausbübereien freizuhalten sind.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!