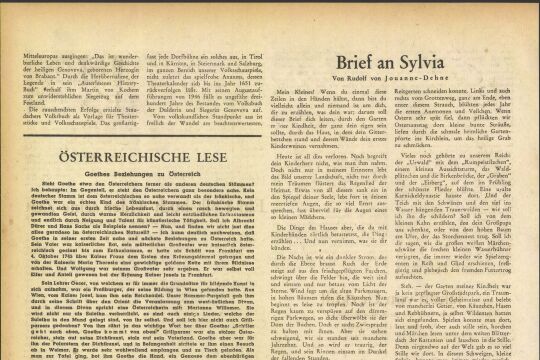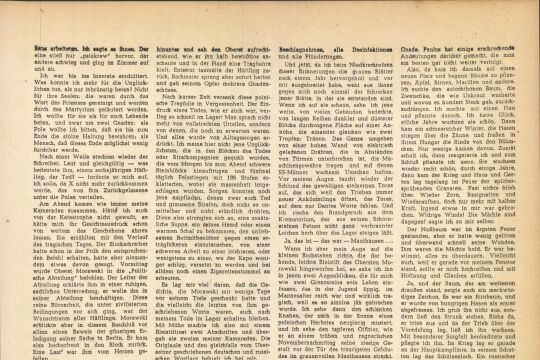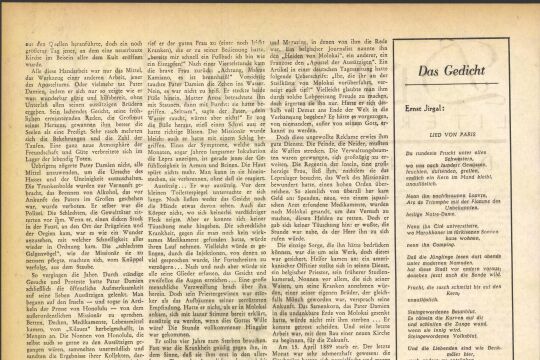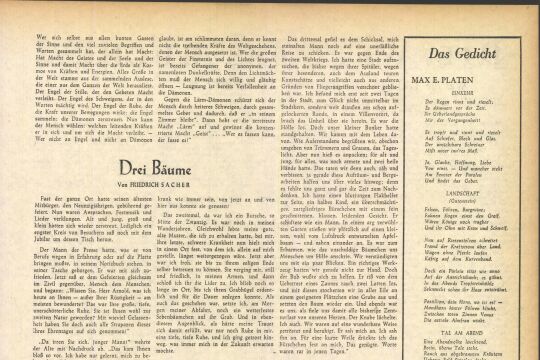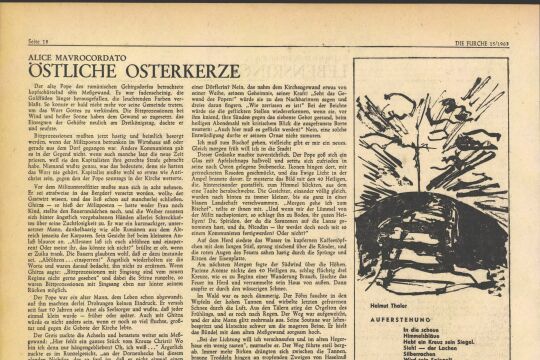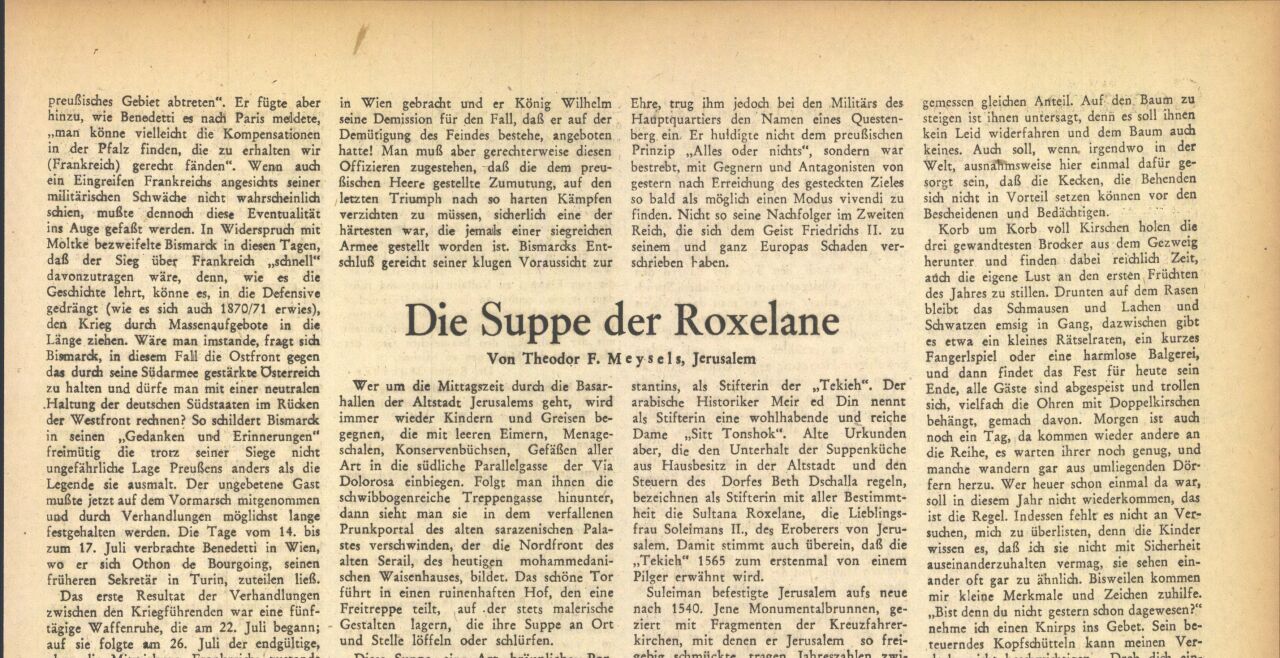
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Freundschaft mit einem Kirsdienbaum
Wenn sich einstens große Herren mit Leuten geringeren Standes beim Kirschenessen zusammenfanden, sollen sie den unterhaltsamen Spaß in der Übung gehabt haben, ihnen die Kerne ins Gesicht zu schnellen. Solche Demütigung war für den, der sichs mit ein wenig Ehrgefühl im Leib still-sdiweigend gefallen lassen mußte, sicher nicht leicht zu ertragen. Daher leitet sich denn auch die Herkunft des Sprichwortes ab, mit großen Herren sei nicht gut Kirschenessen, dessen Sinn sich in übertragener Bedeutung leider auch heute bisweilen noch bewahrheitet.
Da lobe ich mir das Kirschenessen mit kleinen Herren, mit bloßfüssigen, sommersprossigen, stupsnäsigen Dorfbuben und ihren steifbezopften Schwestern und Schulkameradinnen, denn das ist in der Tat ein unterhaltsamer und köstlicher Spaß. Noch vor den genäschigen Staren haben sie es ausgespäht, daß sich meine Kirschen, alljährlich die frühesten weitum im Lande, schon zu röten beginnen, begehrlich streifen sie die Weißdornhecke entlang, die den Garten hoch und wehrhaft umfriedet. Ich aber scheine sie nicht zu bemerken, bis es eines Tages endlich so weit ist, daß sich ihnen das Tor der Hecke auftut: Hereinspaziert! Erwartungsvoll lassen sie sich, Buben und Mädeln meist gesondert, zu kleinen Gesellschaften nieder, und dann bekommen sie ihre Kirschen tn die Schürze oder auf den kurzgemähten Rasen geschüttet, schön der Reihe nach, jedes seinen wohlgemessen gjeidien Anteil. Auf den Baum zu steigen ist ihnen untersagt, denn es soll ihnen kein Leid widerfahren und dem Baum auch keines. Auch soll, wenn irgendwo in der Welt, ausnaTlmsweise hier einmal dafür gesorgt sein, daß die Kecken, die Behenden sich nicht in Vorteil setzen können vor den Bescheidenen und Bedächtigen.
Korb um Korb voll Kirschen holen die drei gewandtesten Brocker aus dem Gezweig herunter und finden dabei reichlich Zeit, auch die eigene Lust an den ersten Früchten des Jahres zu stillen. Drunten auf dem Rasen bleibt das Schmausen und Lachen und Schwatzen emsig in Gang, dazwischen gibt es etwa ein kleines Rätselraten, ein kurzes Fangerlspiel oder eine harmlose Balgerei, und dann findet das Fest für heute sein Ende, alle Gäste sind abgespeist und trollen sich, vielfach die Ohren mit Doppelkirschen behängt, gemach davon. Morgen ist auch noch ein Tag, da kommen wieder andere an die Reihe, es warten ihrer noch genug, und manche wandern gar aus umliegenden Dörfern herzu. Wer heuer schon einmal da war, soll in diesem Jahr nicht wiederkommen, das ist die Regel. Indessen fehlt es nicht an Versuchen, mich zu überlisten, denn die Kinder wissen es, daß ich sie nicht mit Sicherheit auseinanderzuhalten vermag, sie sehen einander oft gar zu ähnlich. Bisweilen kommen mir kleine Merkmale und Zeichen zuhilfe. „Bist denn du nicht gestern schon dagewesen?“ nehme ich einen Knirps ins Gebet. Sein beteuerndes Kopfschütteln kann meinen Verdacht nicht beschwichtigen. „Dreh dich einmal um!“ Richtig! Idi erkenne den Hosenboden wieder, dessen Anblick mich gestern belustigte, als er aus dem Garten entschwand. Genau in die Mitte der hellgebleichten Hose hat nämlich eine liebevolle Mutterhand einen dunkelbraunen Fleck eingesetzt, der nach Farbe und Form unverkennbar einem großen Lebzeltherzen gleicht. Mir kommt — ich kann nichts dafür — das unselige Kreuzlein in den Sinn, das einstens Kriemhilde ihrem hürnenen Siegfried hinten auf das Wams stickte, aber ein gutes Stück weiter oben. Ganz ähnlich hat hier die Ahnungslosigkeit einer Mutter dem Sprößling einen schlimmen Dienst erwiesen, er ist entlarvt und muß den Garten unbeschenkt verlassen, denn ein warnender Beweis meiner Wachsamkeit ist dringend fällig. Der Zwischenfall stimmt denn auch meine kleine Gesellschaft nachdenklich, und hernach, beim Abschied, entgeht es mir keineswegs, daß etliche Buben ängstlich bemüht sind, mir den Anblick ihrer Rückseite zu entziehen.
Nun aber ist es an der Zeit, endlich auch“ von meinem großen Freunde zu reden, dem ich so viele kleine Freundschaften verdanke. Es war Liebe auf den ersten Blick, damals vor Jahren, als im Gelände der Wiener Frühjahrsmesse ein schmächtiger Kirschbaum meine Aufmerksamkeit fesselte, aber sie schien zunächst halt wieder einmal eine unglückliche, eine ganz und gar hoffnungslose Liebe zu sein, denn der Sieveringer Gärtner, der den Baum mit etlichen anderen zur Schau gestellt hatte, erklärte ihn glattweg für unverkäuflich. Dieser Baum, ja freilich, der könne mir so passen! Der sei musterhaft gezogen und müsse einmal ein besonders schöner, großer Buschbaum werden, ich möge nur beachten, wie ebenmäßig sich der Stamm schon in Kniehöhe in Äste zerteile und in die Breite strebe, dergleichen finde man nicht alle Tage. Zudem verbürge die Sorte eine frühe, reiche, saftigsüße Frucht. Nein, gerade von diesem Bäumchen könne er sich um viel Geld nicht trennen. Trostbedürftigen Herzens lenkte ich daraufhin meine Schritte der Weinkost zu. Und dort nötigte eine kleine Weile später eine glückliche Schicksalsfügung den harten Mann an meinen Tisch, an dem er den einzigen noch freien Sessel in der ganzen Halle erspäht hatte. Da ließen wir denn, selber schweigsam, unsere Gläser mannigfache Lob? lieder auf die gesegnetesten Weinrieden der lieben Heimat singen, und seit dieser Stunde gehört der Kirschbaum eben mir, es wurden nur ganz wenige Worte darüber verloren. Der gute Mann lebt schon lange nicht mehr, und sicher ist ihm in der gesunden, weingartennahen Sievringer Friedhofserde ein friedlicher Schlaf beschieden. Immerhin meine ich, wenn er seinen Kirschbaum heute sehen könnte, so trüge auch dieser Anblick ein wenig dazu bei, daß sich seine „Seel' noch fortfreut in der Ewigkeit“, wie Stelzhamer sagt, die Schönheit des irdischen Lebens preisend.
Denn geradezu herrlich hat sich das Stämmchen von damals in seiner nsucn Heimat schier schon zum mächtigen Baum entfaltet. Ein Dutzend Schritte von der -Holzwand des kleinen Hauses entfernt, steht er als einziger Baum frei im Räume da und diese Einsamkeit behagt ihm besser, als wenn er sich in eine Reihe fügen müßte oder gar rundum ins Gedränge geriete. Was verschlägt es, daß er mir schon ein gut Teil,der früheren Aussicht verstellt? Mag nun er statt meiner weit ins liebe Land schauen, über Kuppel und Türme des Stiftes hinweg auf die waldblauen Berge der Wachau. Hoch über das Hausdach zusamt seinen Rauchfängen ist er schon hinausgewachsen, er will das Gezweig einiger Aste wie dargereichte Hände schon bis in die Stube hereinstrecken, er füllt den ganzen Himmel vor den Fenstern mit bienen-durchbraustem Blütenschnee, mit üppig prangendem Laubgrün, mit dunkelrot lockenden Fruchtbüscheln, mit herbstlich loderndem Farbenbrand. Vielfältiges Leben bringt er mir in den Garten, das drollige Geschwätz und Geschnatter der Stare, die Kinderfreude des ganzen Dorfes, er beschenkt mich mit dem Glück, schenken zu können nach Herzenslust. Ruht er sich in manchem Jahre vor allzu reichem Früchtetragen ein wenig aus, so ist ihm die kleine Rast, solches Atemholen und Kräfteschöpfen ohne Vorwurf gegönnt. Und würde er durch bösen Zauber zu völliger Unfruchtbarkeit verdammt, so geschähe meiner Liebe auch dadurch kein Abbruch, dazu sind wir längst viel zu gute Freunde geworden, und mir bliebe ja noch immer die Freude an seinem schönen Wuchs.
Wie denn aber? Freundschaft mit einem Baum? Freundschaften mit Tieren, mit treugehorsamen Hunden, mit seidenweich schmeichelnden Katzen und gelehrigen Zimmervögeln, die mag man gelten lassen, und was ist über sie nicht schon alles geschrieben worden. Den Baum indessen, der des Menschen Dasein nicht zur Kenntnis nimmt und ihm keinen Beweis seiner Anhänglichkeit gewährt, der sich in dunkle Rätsel hüllt und .nur geschaffen scheint, in stumpfer, willenloser Dienstbarkeit Holz oder Frucht oder etwa noch ein wenig kühlen Schatten zu liefern, wie denn sollten wir ihn als Freund anreden? Unsere Väter, die bäuerlichen vor allem, wußten gute Antwort auf die zweifelnde Frage. Aber freilich, sie sind ja vergessen, die schönen alten Bräuche, für jedes neugeborene Kind einen Obstbaum zu setzen, seinen Lebensbaum, der mit ihm aufwachsen und es begleiten sollte wie ein treuer Freund, oder der Brauch, den Tod des Bauern den Bäumen im Obstgarten mit feierlichem Spruch anzusagen, eiliger noch, als man das Ereignis der nächsten Freundschaft meldete.
Von dem Perserkönig Xerxes weiß uns Herodot zu erzählen, er sei auf seinem gewaltigen Heereszug gegen Griechenland an einem Baum vorübergekommen, dessen große Schönheit ihn so sehr zu liebevoller Bewunderung hinriß, daß er zunächst nicht übel Lust trug, ihm alle seine goldenen Armbänder und Halsketten in die Zweige zu hängen, als ließe sich durch derlei eitlen Menschentand die edle Schönheit eines Baumes noch erhöhen. Dann aber fiel ihm etwas weit Klügeres und Hübscheres ein: er ließ einen „unsterblichen Mann“ zurück. Der sollte den Baum behüten und pflegen sein Leben lang, und ehe er starb, sollte er sein Amt einem anderen Manne mit der gleichen Verpflichtung übergeben. Es ist uns nicht überliefert, ob schließlich der schöne Baum alle die „unsterblichen Männer“ überdauerte, oder ob diese den Baum überlebten, und es bekümmert uns auch nicht sonderlich, wie denn diese seltsame Geschichte ausgegangen sein mag. Aber wer dereinstens allen den Menschen und Dingen, die uns im Leben an das Herz gewachsen sind, und wär's auch nur ein Kirschenbaum, unsere Freundschaft ersetzen wird, diese Sorge kann uns inmitten vieler anderer bisweilen schon zu denken geben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!