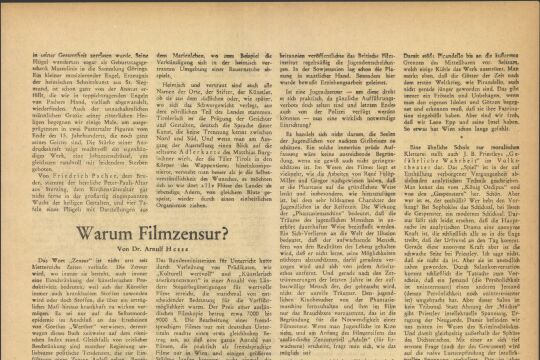Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gabriel Marcel und das wahre Leben
Das Theater ist für Gabriel Marcel eine besondere Form der Aussprache. Seine Stücke sind die Diskussion der inneren Anschauungen seiner Figuren. „Ich war immer der Meinung“, sagte er, „daß die Figuren meiner Stücke die Stellen von Schwestern und Brüdern vertraten, die ich im Leben schmerzlich vermißte.“ Die Menschen Gabriel Marcels sind Menschen, die sich ins „Gestrüpp der Welt“ verstrickt haben, die im Leben gefangen sind wie in einer Falle; oft hassen sie es deswegen. Immer aber haben sie die Freiheit der Entscheidung. Freiheit setzt jedoch Verantwortung voraus. Und diese ist so schwer. Das Stück „Das wahre Leben ist nicht gegenwärtig“ (das jetzt in einer Inszenierung von Heinz Röttinger im Theater am Parkring gespielt wird), behandelt die Problematik von Menschen, die nicht reif wurden, weil sie nicht lernten, für ihr Leben verantwortlich zu sein. Die Mystik, die der Titel andeutet — daß das wahre Leben nicht das gegenwärtige, sondern uns heute und hier noch verborgen ist — ist für sie nur Flucht aus diesem Leben, das sie nicht meistern können, ist Selbsttäuschung und Illusion. Es sind Menschen, die mit ihrem Alltag nicht fertig werden, die vielleicht etwas leisten könnten, es aber auf dem Platz, auf den das Schicksal sie gestellt hat, nicht zu leisten bereit sind. Denn wer ist schon bereit, Heroismus zu haben für den Alltag? Chantal, die Ausnahme, ist dazu bereit; sie allein ist auch imstande, sich aus den sexuellen Verstrickungen, denen die anderen in dieser oder jener Form erliegen, zu lösen. Für sie allein ist das wahre Leben gegenwärtig. Die anderen um Chantal, insbesondere aber Agnes, ihre Kusine, klammern sich an Worte; das jetzige Leben bleibt ihnen ein „nach innen gekehrter Schrei“.- In endlos langen, stellenweise peinlich wirkenden Bettgesprächen (peinlich nicht durch ihre Offenheit, sondern durch ihre Ver-bogenheit) versuchen sie sich Luft zu machen. Doch haben diese Gespräche nichts Befreiendes an sich, wenn wir durch sie auch tief in die Seele von Menschen blicken, die krank oder schwach oder unwissend sind und für die sich das Heil erst fern, sehr fern abzeichnet. Es wäre hier grundverkehrt von „katholischer Pornographie“ (wie es leider immer wieder geschieht) zu sprechen. Ein Aufzeigen von Wunden ist kein Schwelgen im Eiter. Das ist die Methode Marcels: er konfrontiert uns mit seinen Figuren; er hat uns nicht mehr zu sagen als sie. Es scheint, als ob er mit uns in ihnen, seinen Geschwistern, nach der Wahrheit forsche, als ob er genau auf jedes Wort horche, das sie sagen, ob es nicht einen Weg andeuten könnte, den Weg, die Wahrheit und das Leben... So sind seine Stücke zwar;, nicht überaus dramatisch (dazu sind sie zuwenig raffiniert gebaut), aber sie sind' erregend, weil sie uns ringende Menschen zeigen, sie sind aufregend, aufspürend: die Stücke eines Wahrheitssuchers.
Auch das zweite Stück von Gabriel Marcel, das jetzt in Wien (im Theater irri Palais Ester-h ä z y) gespielt wird, das Schauspiel „Rom nicht mehrin Ro m“, handelt von der Wirklichkeit und der Verantwortung, die wir haben. War der eine Titel ein Zitat von Rimbaud, so ist er hier einem Drama von Corneille entnommen. Hier ist es das Problem der Emigration, an der Marcel die Frage nach unserer wahren Aufgabe stellt. Frankreich, Europa, das ist die Wirklichkeit, das Leben, das uns gegeben ist, unsere Aufgabe. Brasilien, die „neue Welt“, das ist hier Flucht, Selbstbetrug, Täuschung. Wo ist Frankreich? Auf dem Boden des alten Frankreich, oder dort, wo Franzosen sind? In den Menschen oder in der Erde? Oder können Franzosen nur dort sie selbst sein, wo sie in ihrem Boden wurzeln? Professor Pascal Laumiere,, ein zweifelnder Intellektueller, der immer alle Seiten einer Sache erwägt, der aus einem Frankreich der nahen Zukunft, das vor der kommunistischen Gefahr zittert, auswandert, um in Brasilien eine Professur anzutreten, faßt sein Leben in den Worten zusammen: „Wir haben unrecht gehabt, fortzugehen ... Ihr, die ihr vielleicht vor der drohenden Zukunft zaudert, bleibt, ich beschwöre euch, bleibt.“ Denn nur, wenn sie bei ihrer Aufgabe bleiben, werden sie auch sie selbst bleiben. Vielleicht bedarf es sogar der Bedrohung und der Gefahr, damit sie sie selbst bleiben. Denn die Sicherheit, die die Frau Pascals sucht, ist nirgends. Sie ist ein Selbstbetrug wie die falsche Mystik der Agnes, ein Augenverschließen vor der Einsicht: Rom ist in Rom, und das wahre Leben ist immer gegenwärtig.
Das Burgtheater spielt die „Dame Kobold“ von C a I d e r o n, in der Uebersetzung von Hugo von Hofm,annsthal. „Dame Kobold“ ist ein Mantel- und Degenstück von altspanischer Grandezza und koboldhafter Leichtigkeit, durchsichtig wie der Glasschrank vor der Tapetentür, der das ganze Spiel um Dame, Ritter und Diener möglich macht, ein Glasschrank, den jedermann durchschauen kann und dessen Geheimnis doch denen, die es nicht kennen sollen, bis zum Schluß verschlossen bleibt, indes die Geister heimlich ein- und ausgehen. „Dame Kobold“ ist ein zartes, weltvergessenes Gedicht, das doch mit beiden (Vers-)Füßen auf dem Boden steht, das Schalkhaftigkeit und Don Quichotterie, Traum und Derbheit zu Gast geladen hat, und mit allem Spaß treibt. Hofmannsthal, dem Kulturerbe der Austria Hispanica und Hispania Austriaca tief verpflichtet, war dem Spiel ein treuer Walter und Mehrer, Ulrich Bettac gab der flüssigen Folge der Szenen den rechten Schwung, Stefan Hlawa schuf die leichten, duftigen Bühnenbilder dazu und Ernie Knie-perts Kostüme brachten beinahe ebensoviel Pointen auf die Bühne wie ihre Träger: Judith Holzmeister als Donna Angela, Albin Skoda als Don Manuel, der sich um sie bewirbt, Hermann Thimig als Diener Cosme und Inge Konradi als Zofe Isabel, geschmeidig und frech bis in die Fußspitzen, verdienen besondere Erwähnung.
Das Landestheater Salzburg gastierte mit zwei Stücken lebender österreichischer Autoren, die historische Themen. behandeln, im Wiener Akademietheater: mit Felix Brauns menschlich warmen „Rudolf der Stifter“ (in dem man etwas das Lyrische vermißt, das Brauns Stärke ist) und mit Georg Ren dl s „Bleiben Sie bei uns, Vianney“ (das die Geschichte des kindlichen Pfarrers von Ars erzählt und billig vertut). Solche Gastspiele (im Austausch mit den Landesbühnen, die in Wien spielen, wird das Burgtheater in den Landeshauptstädten gastieren), sind in jeder Hinsicht zu begrüßen. Machen sie uns doch mit Stücken bekannt, die man sonst vielleicht nicht zu sehen bekäme, weil eine eigene Inszenierung in jeder Stadt zu kostspielig wäre oder aus anderen Gründen nicht ins Auge gefaßt werden kann.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!