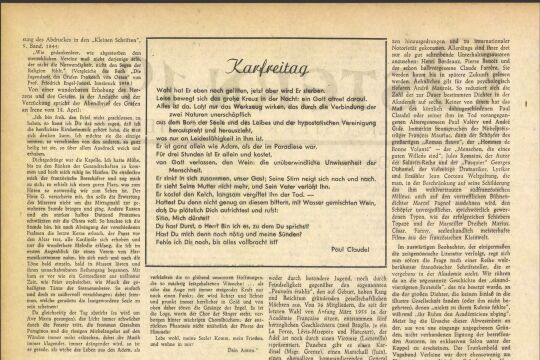Unter den Dramatikern der zeitgenössischen Bühne zählt Jean Anouilh zu den fruchtbarsten und erfolgreichsten. Mit einer bewundernswerten Regelmäßigkeit hat er seit 1932 fast jedes Jahr ein beziehungsweise zwei Stücke geschrieben: sein Gesamtopus umfaßt nun, wenn man ein paar Filmszenarios dazuzählt, 35 Nummern, die nicht nur in Frankreich, sondern in der ganzen Welt, insbesondere aber im deutschsprachigen Raum einen anhaltenden Erfolg geerntet haben.
Es ist nicht unsere Absicht, über ein so umfangreiches Theaterschaffen, das übrigens, und hoffentlich, gar nicht abgeschlossen ist, im einzelnen zu referieren. Der grundlegende Sinn und die humanistische Bedeutung dieses Theaters interessieren uns aber um so mehr: denn Anouilh, dessen stupende Bühnentechnik immer wieder die Fachleute erstaunt, ist ein Mann unserer Zeit, der seit 30 Jahren sämtliche soziologischen und kulturellen Umwälzungen be-
ziehungsweise Entwicklungsstationen unserer Kulturwelt miterlebt hat. Es ist also nicht verwunderlich, daß sein Theaterschaffen, das zwar niemals — ä la Sartre — schulmeistern will, um philosophische Thesen in anima vili zu illustrieren, immerhin den Zeitgeist unserer Epoche und vor allem die französische Kollektivpsyche der letzten 30 Jahre widerspiegelt. Nolens volens ist Anouilh ein Zeuge unserer Zeit.
Er hat bekanntlich seine Stücke in verschiedene Kategorien aufgeteilt, denen er bezeichnende Namen gegeben hat: schwarze, rosa, glänzende, knirschende, kostümierte Stücke. Diese Etiketten sollten eigentlich weder ihn selbst noch seine Zuhörer irreführen: denn Anouilhs Theater ist, wie das Leben selbst, komplex, vielseitig, reich an Gegensätzen und ungereimten Dingen, so daß jedes Stück von ihm, auch wenn ein gutmütiger oder augenzwinkernder Deus ex machina die Handlung zu einem Happy-End führt, immer glänzend gekonnt, zwar nicht immer kostümiert, jedoch schwarz-rosa zugleich ist und einem zwischen den Zähnen knirscht.
Nicht daß Anouilh ein ausgesprochener Charakterschriftsteller ist: er versucht nicht, wie Moliėre oder Montherlant, die Nuancen, offen eingestandene oder tief verschleierte Eigenschaften einer Figur auszuforschen. Er hat nicht, wie Mauriac in seinem „Asmodėe“, einen Bühnentyp neu geschaffen. Auch soziale oder sozialbedingte Figuren betreten, mit soziologischem Koeffizienten versehen, nicht die Bretter seines Theaters; unter den bekannten Figuren seiner Stücke gibt es wohl Lumpen, gestrandete Existenzen, bitterarme Komödianten: einen echten Proleten gibt es nicht.
Das psychologische Drama oder das Ideenstück sind also nicht sein Fach: wohl aber, und selbst in seinen rosa Stücken, die Tragödie. „Die Könige haben anderes zu tun“, sagt Kreon zu Antigone, „als individualistische Pathetik zu erleben.“ Und der Chor erklärt noch eindeutiger —, was im Grunde genommen die ganze anouilhsche Dramaturgie darstellt:
„Bei der Tragödie geht es ruhig zu. Man ist unter sich und jeder ist schließlich unschuldig. Es ist bloß eine Sache der Besetzung. Und übrigens, die Tragödie ist so erholend: man weiß, daß es keine Hoffnung mehr gibt, jene schmutzige Hoffnung; man steht gefangen, der ganze Himmel lastet einem auf dem Rücken, und es bleibt dem Menschen nur eines übrig: schreien, aus vollem Halse das herauszuschreien, was man zu sagen hat, was man nie gesagt hatte Und alles das umsonst, für nichts Im Drama ringt man immer noch, denn man hofft auf Rettung. Es ist gemein, eigensüchtig. In der Tragödie aber ist alles unnütz, endgültig, ,gratuit'. Man kann sich nicht aus der Affäre ziehen.“
Anstatt, so psychologische Analysen mit allem Raffinements vorzunehmen, spielt Anouilh alle seine Figuren unmittelbar und unbarmherzig dem allmächtigen Schicksal in die Hände. Er läßt sie mehr oder weniger lang „im Netz zappeln“, sie sind aber alle schon von Anfang an gefangen, eingefangen und schuldlos verurteilt. Sie mögen wohl tanzen: jedes Ballfest ist aber bei Anouilh — „Der Ball der Diebe“, „Die Einladung aufs Schloß“, „Der Walzer der Toreros“, „Der arme Bitos“ — zu guter Letzt ein Totentanz, und der Ballettmeister jener modernen „Fėtes Galantes“, die dieselbe Irrealität, aber auch dieselbe Grausamkeit besitzen wie bei Verlaine, ist, als Kaffeehausober, Spielleiter oder sogar als christlicher Gott kostümiert, das Fatum der Antike, das lächelnd, grausam oder gleichgültig den ahnungslos kurzweiligen und kraftlosen Zuckungen der menschlichen Ameisen verstohlen zusieht.
Scherz, Ironie sind dabei immer anwesend: Anouilh weiß, wie kein anderer, Lachsalven bei seinem Publikum auszulösen, und die meisterhafte Behandlung der Sprache fortsetzend, die seinen Lehrmeistern Marivaux und Giraudoux eigen war, die ungemein reiche Brillanz der besten Bühnenkonversation vor unseren Augen schillern, in unseren Ohren erklingen zu lassen. Es fehlt aber nicht an tieferer Bedeutung, und obwohl Anouilhs Schaffen schon vor der Flutwelle des Existentialismus und vor der Erfindung des „absurden“ Theaters seine Thematik, seinen Stil und seinen Schwung angenommen hatte, ist es heute — mit' dem Abstand der Jahre und, wenn man Anouilhs Theater als Ganzes betrachtet — nicht sehr schwer, in ihm bezeichnende Berührungspunkte und tiefe Affinitäten mit Sartres oder Camus' Gedankenwelt oder schon mit der Auffassung des Menschen bei den zeitgenössischen Absurdisten (Adamov, Beckett, Ionesco oder Genet) zu finden.
Anouilh war über sich selbst und seinen geistigen Standort immer sehr diskret und wortkarg: seinen Lesern oder Zuschauern überließ er die Aufgabe, in seinem Schaffen nach einer Weltanschauung zu suchen oder auch eine solche zu vermissen. Seit zwei Jahren ist seine Produktion etwas spärlicher geworden: dafür aber befleißigt sich Anouilh des öfteren, Theaterstücke von Autoren zu inszenieren, zu denen er eine gewisse Affinität empfindet. Am aufschlußreichsten ist diesbezüglich die Inszenierung eines Stückes von Roger Vitrac, „Victor ou les enfants au pouvoir“, das in der anouilhschen Interpretation eine überaus tiefe und klare Aussage erhält und über den Sinn von Anouilhs Schaffen selbst Auskunft geben kann.
Victor ist neun Jahre alt, körperlich aber ist er ein Erwachsener und mißt 1,90 Meter. Sein Scharfsinn entspricht mehr seiner Höhe, denn seinem Alter, und am Tage seines neunten Geburtstages entpuppt er sich, der bisher das ahnungslose Kind war oder spielte, als unbarmherziger und luzider Kritiker und Richter seiner Eltern und deren Freunde. Er weiß alles, sieht alles: auch die Immoralität und das zynische Doppelleben der Erwachsenen. Mit der Erkenntnis des Daseins erfährt Victor aber auch den Ekel und die Verzweiflung am Leben. Er mag sich wohl zuerst an seinen Eltern rächen, ihre Heuchelei anprangern: der Sadismus des Pseudokindes kann über seinen geistigen und moralischen Zusammenbruch nicht hinwegtäuschen. Unter den Bekannten seiner Mutter hat er nämlich eine geheimnisvolle schöne Dame getroffen, in der er bald den Boten und die Verkörperung der einzig wirklichen und unwiderruflichen Realität erahnt, den Tod. Er stirbt bald darauf in einem Anfall von Fieber und konfusem Wahnsinn, dem Leben fluchend, das nur eine gräßliche Komödie ist, und voll makabrer Sehnsucht nach dem Tod, der der Maskerade des menschlichen Lebens ein Ende bereitet.
In diesem prophetisch absurdistischen und betont surrealistischen Stück, das Vitrac 1927 schrieb, hat Anouilh erkannt, was der Leser des anouilhschen Theaters selbst schon zwischen den Zeilen feststellen konnte: die grundsätzliche Thematik seines eigenen Schaffens. Die Welt wimmelt nur so von Heuchlern und tierischen Wesen, die sein „Reisender ohne Gepäck“ in seiner eigenen Vergangenheit entdeckt. Die Kindheit ist ein Wahn, eine Lüge. Die Erkenntnis kommt in verhängnisvoller Weise, früher oder später: die reinen Toren mögen sich wohl eine Zeitlang dagegen wehren, die Erwachsenen wohl rosa oder glänzende Episoden
Jean Anouilh über sich selbst:
Ich habe keine Biographie, darüber bin ich sehr froh. Ich bin am 23. Juni 1910 in Bordeaux geboren, kam sehr jung nach Paris, besuchte die Mittelschule Colbert, dann das Collėge Chaptal. Ein und ein halbes Jahr studierte ich in Paris Rechtswissenschaft, zwei Jahre verbrachte ich in einem Verlagshaus, wo ich Unterricht in Präzision und Scharfsinnigkeit nahm, wodurch ich dem Studium der Dichtkunst verfiel. Nach „L'Hermine" habe ich beschlossen, mich ausschließlich dem Theater und nebenher dem Film zu widmen. Das war eine Torheit, aber ich habe trotzdem gut daran getan, sie auszuführen. Mit dem Journalismus habe ich nichts mehr zu tun, was den Film anbe- langf, so habe ich nur ein oder zwei Possen und einige Singspiele auf dem Gewissen, die in Vergessenheit geraten und nicht signiert sind. Uber den restlichen Teil meines Lebens — soweit der Himmel mir die Entscheidung läßt — behalte ich mir alle Einzelheiten vor.
erfinden und spielen. Es knirscht von allem Anfang an im gesamten Räderwerk, und erst im Tode, erst im blinden Sturz in das Nichts, findet der Mensch, dieses ewig verpfuschte Menschenkind, zur Wahrheit seines Schicksals, zur Absurdität seiner conditio humana zurück.
Hätte sich Anouilh selbst nicht über diese eher pessimistische Menschenauffassung und Weltanschauung geäußert, so könnte der Zuschauer, dem selbstverständlich vor allem die verführerische Brillanz, die bezaubernde Ironie und das stu-
Zeitgenössische französische Karikatur von J. A.
pende Metier des Autors auffallen, an einer so hintergründigen Auffassung zweifeln. Anouilh hat aber Vitracs Stück nicht nur glänzend inszeniert; zum Stück und zum Gesamtschaffen Vitracs hat er ein Vorwort geschrieben, das „dem Bruchstück einer großen Konfession“ gleichkommt und das uns über den tiefen Sinn seines Schaffens eindeutig informiert. Anouilh schreibt:
„Das freche, ungeniert zynische Ballett, das Vitracs Figuren tanzen, gehorcht tiefgründigen Gesetzen, die, der Phantasie nur scheinbar entsprungen (ich verwende das Wort .Phantasie' mit Absicht, anstatt .Surrealismus'), die Gesetze des Lebens sind. Zu den Bemühungen der Menschen, die versuchten, ihre Existenz und die Welt erhaben und vernünftig zu gestalten und deren restlose Absurdität durch eine Maske erträglich zu machen, gesellt sich der Versuch der Dramatiker, ein womöglich noch verflachteres, faderes, platteres Bild der schon furchtbar konformistischen Vorstellungen wiederzugeben, die sich, die Menschen von ihrer Situation machen.
Der Naturalismus war nicht, wie man glaubte, eine photographische Abbildung, ein Abklatsch der Realität, sondern eher eine geschmeichelte, .geschleckte' (wie die Maler sagen) Wiedergabe jener schablonenartigen Vorstellungen des Lebens, das für uns das Leben schlechthin geworden ist.
Vitrac, ein Riese in kurzen Hosen, betritt den Porzellanladen des Spießbürgertums bewußt und fröhlich mit den Tritten eines Elefanten, und mit Figuren, die keine Geisteskonstruktionen, sondern dem konkreten Leben selbst direkt nachgebildet sind; mit Dialogen, die unmittelbar der Straße ab gelauscht sein könnten, schafft er einen Stil und bietet uns das unheimliche und groteske Spiel des Lebens, wie wir es tatsächlich spielen. Sämtliche Figuren Vitracs sind wahr: unzählig sind die Riesenkinder, die fürchterliche Wahrheiten herausschreien und am Morgen ihres neunten Geburtstages sowohl die Erkenntnis als auch den Tod entdecken. Die armseligen, ehebrecherischen Paare, die zwischen Lächerlichkeit und jener einsamen Exaltiertheit des Ichs schwanken, die die Liebenden, sogar in Paris, immer noch romantisch-naiv die Liebe nennen, sind gleichfalls überall anzutreffen. Der Tod endlich betritt, in der Maske einer wunderschönen Grande Dame, öfters die Schwelle zahlreicher spießbürgerlicher Häuser. Man gibt aber vor, wir alle geben vor, ihn nicht zu erkennen und auf das, was das Kind sagt, nicht zu hören.
Vitrac gibt uns diese wirklichen Menschen in ihrer totalen Absurdität: dadurch hat er wahrscheinlich die neue Komik geschaffen, die die unsere ist. .Victor' hat Vitrac nicht mühselig erfunden: er wurde ihm glatt .geschenkt'. Er tritt aus seiner Kindheit ganz gewappnet hervor, und die Sprache, die er spricht, erinnert so deutlich an die Hamlets, daß sogar ein Tauber sie vernehmen müßte. Vitrac glaubte vielleicht, nur Skandal zu erregen oder den Bourgeois seiner Zeit zum Lachen zu bringen. Sein Stück könnte vom besten Feydeau sein, einem Feydeau allerdings, der seine Feder ins Tintenfaß eines Strindberg getaucht hätte. Man sucht nach den Vätern des zeitgenössischen Theaters. Ich wäre für all meine Mühe belohnt, könnte man endlich erkennen, daß Vitrac eben einer von ihnen ist.“ („Figaro“, 1. Oktober 1962.)
In dieser Ahnentafel der modernen Dramatiker hat Anouilh selbst schon längst seinen festen, klar umrissenen Platz eingenommen: jenseits des Naturalismus, demaskiert er mit unnachahmlichem, ab und zu sadistischem, schwarzem Humor die tragische Posse des Lebens, die Heuchelei der Erwachsenen, die Lüge der „Liebe“, und indem er gleich Vitrac die Menschen „in ihrer totalen Absurdität wieder- gibt“, ist er Mitschöpfer „jener Komik, die die unsere ist“. Somit schafft er ein neues „Welttheater“, das faszinierende Schauspiel von Wesen, die dank ihrer luziden Selbstironie um ihre Substanzlosigkeit und um den fatalen Verlauf des Schicksals wissen, weiterhin jedoch, auf verlorenem Posten, wie große groteske Kinder lieben, tanzen, „im Netz zappeln“, auch gegen das Schicksal revoltieren, schließlich aber alle, bewußt oder ahnungslos, in den Armen des Todes zur Erkenntnis gelangen.