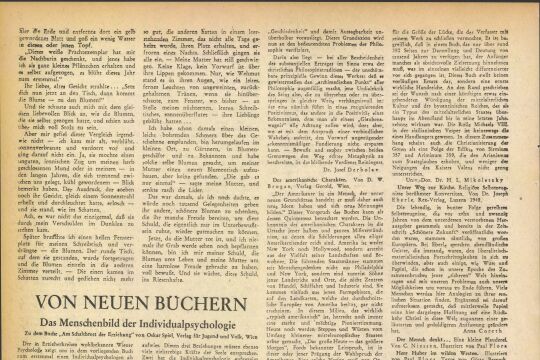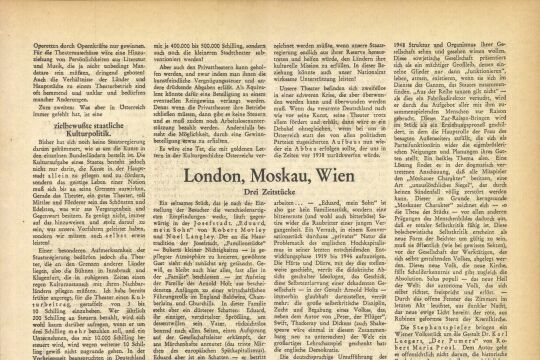Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ganze, halbe und keine Menschen
Bei Gustav Mankers Inszenierungen kann man eines sicher wissen: Daß dieser Regisseur sich wirklich etwas gedacht, daß er das Stück nicht nur gelesen, sondern auch studiert hat und daß er die Fähigkeit besitzt, seine Erkenntnis nicht nur in den Dialog, sondern auch in die Raumvision umzusetzen. An sich Selbstverständlichkeiten des Berufes, heutzutage aber durchaus erwähnenswert. Bei all dem kann ihm frei-lisri eines passieren: daß er zuviel gedacht hat und daß das von ihm geschaffene Stück neben dem vorliegenden Text ein zwar interessantes, aber nicht ganz zur Deckung gekommenes Eigenleben führt Grillparzers „Jüdin von Toledo“ ist eines jener drei Spätwerke des Dichters, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt an Bedeutung gewinnen, weil fast jede Generation neue Schichtungen, neue Dimensionen entdeckt, die man zuvor noch gar nicht wahrzunehmen vermochte. Für Mankcrs Auffassungen steht die erotische Elementarbegegnung im Mittelpunkt, nicht das Rassen- oder Religionsproblem. (Es ist übrigens grotesk, daß eben jene Leute, die ihm vor Jahr und Tag bei Hermann Bahrs zeitechten „Wienerinnen“ Antisemitismus vorwarfen, nun das Fehlen einer bei Grillparzer wirklich etwas plump geratenen Szene zwischen Isaak und den Bittstellern bemängeln. Manker hat recht, wenn er sich weder um den einen noch um den anderen Galerieeinwand kümmert.) Für ihn ist die Jüdin Rahel weder eine sentimen-talisierte Idealgestalt noch ein unschuldiges Triebwesen. In ihr gewinnt eben dies Fleisch und Gestalt, was im König selbst als geheimer Wunsch, als verdrängte Sehnsucht in einer puritanisch-britischen Ehe angelegt war. Der König ist gerufen, in diesem Prozeß zu reifen. (Die Zentralszene ist das ungemein modern gesehene Ehegespräch mit Eleonore im vierten Akt.) Er versagt sich selbst dieser neuen Reifestufe, die er klarsichtig erkennt. Und also wird er der wahrhaft Schuldige, der im pubertären Soldatenspiel steckenbleibende, unreif brutale Halbmann. Der Fluch Esthers ist die nachhallende Antwort auf dieses Versagen, keine „Kampferklärung des Judentums“ an die christliche Ritterschaft. Ein Stück österreichischer „edu-cation sentimentale“, ein wichtiges und packendes Stück. Bühnenbild und Kostüm
(Maxi Tschunko) verlieren in dieser Konzeption illustrativen Realitätscharakter, sie werde Symbol, eindringliches Element eines innerseelischen Vorgangs. Das einzige, was dem allen entgegensteht, ist die zuweilen Mg zeitgebundene Gedrechseltheit des Verses. Aber den muß man eben in Kauf nehmen, vor allem dann, wenn ihn Aladar K u n r a d (König) in eine so glühend-dynamische Melodie verwandelt. Paola L o e w spielt die Titelrolle. Sie hat sich diesen Text mit einer Hingabe erarbeitet, die man anerkennen kann. Aber noch ist nicht alles zur persönlichen Einheit verschmolzen, noch steht Nuance neben Nuance. Traute Wassler sei neben der ausgezeichnet sprechenden Erna Kor hei (Esther) als Königin genannt. Es gelang ihr, der als blaß geltenden Rolle so viele Schattierungen abzugewinnen, daß auch sie gebändigte Ahgründe, ertötete Glut ahnen ließ. Ganze Menschen, nicht historische Schemen standen gegeneinander. Ein guter, gediegener Abend des Volkstheaters.
Cesare Z a v a 11 i n i, der vom Film „aus Überzeugung“ zum Theater zurückgekehrte Dichter, glaubt nicht mehr an das Ganze des Menschen. Besser gesagt: weil er hoffnungslos daran glaubt, verzweifelt er und läßt seinen Helden, den Dichter und Drehbuchautor Antonio, an einem Leben verzweifeln, da nur noch vom Klischee, von der marionettenhaft vorberechneten Reaktion bewältigt werden kann. Wo Zavattini dieses in Alpträumen und grotesken Zerrbildern einer Traumfabrik vorüberhuschende Leben skizziert, ist er ein an Pirandello geschulter Meister, wo er in der Friedhofsszene metaphysische Bilanz zu ziehen versucht, verliert er sich im Nebulosen. Andreas Rozgony ist mit seiner Inszenierung, tur die ihm nur die kleine Bühne des Theaters im Zentrum“ zur Verfügung stand, eine prächtige Leistung gelungen. In Hans Henning Heers hatte er einen jugendlich-formbaren Träger der
Hauptrolle. Ein riesengroßes Ensemble tat sein Bestes. Fehlbesetzung war keine zu verzeichnen. Peter Stögers Bühnenbild verdient ein Sonderlob.
Arthur Adamov glaubt sich in seiner Meinung, daß wir alle „Tote Seelen“ sind, Automaten, die nur noch reagieren und sich in einer überdrehten Funktionslogik hin und her bewegen, auf die Gleichgestimmtheit des großen Nicolai Gogol berufen zu können. Er hat nicht ganz unrecht, und seine umstrittene Dramatisierung, um die sich das Theater in der Josefstadt bemühte, hat von da her eine geistesgeschichtliche Legitimation. Nur bleibt eines völlig ungesagt: Für Gogol gibt es ein Gegenbild, für ihn ist der Totentanz der Russen um den Seelenhändler Tschitschikow eine Entartung, aus der heraus ein Weg der Sühne und Selbstüberwindung in eine neu zu entdeckende Wirklichkeit führt, die für ihn „Mütterchen Rußland“, hieß. Den davoneilenden Tschitschikoff begleiten im Roman die mitreißenden Troika-Verse zum Preis des ewigen Rußlands, der sobornostj, die den eigentlichen Kontrapunkt bildet. Adamov glaubt daran vielleicht nicht. Und
wenn er daran glaubte, kann er es mit den Mitteln seines Theaters nicht mitteilen. Der Regisseur Dietrich H a u g k glaubt daran ganz sicher nicht. Und so flüchtet er sich in eine aufdringliche Äußerlichkeit, die ganz im Leeren bleibt. Die eine oder andere Figur lebt; allerdings allein von Schauspielers Gnaden. Erik Frey mühte sich, besonders im Schlußbild etwas von dem leibhaftig zu machen, was Gogol in seinem Fortsetzungsprojekt „Tschitschi-koffs Bestrafung“ nannte. Diese Figur ist nicht die eines harmlos hineinstolpernden Luftikus (wie die des „Revisors“), sie ist schon in ihrer merkwürdigen Bezüglichkeit zu Napoleon eher dem Raskolnikoff verwandt, dem sündigen, sich sondernden Menschen des atomistischen, westlichen Individualismus. Manchen der Darsteller gelang es, im Sinne C. G. Jungs den eigenen „Schatten“ mitzuspielen. Wir heben hier bewußt nur Luzi Neudecker (Magd) und Guido W i e 1 a n d (Staatsanwalt) hervor. Das Bühnenbild von Leni Bauer-Eczy machte die von der Regie nicht wahrgenommene Mehrschichtigkeit des Stoffes deutlich, weniger verursachte dies die unentschlossen zwischen Stilisierung und Naturalismus schwankende Kostümierung der gleichen Bildnerin.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!