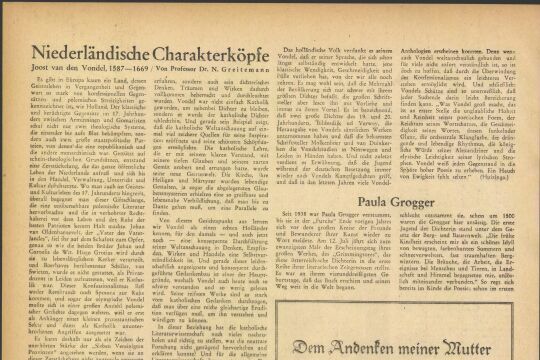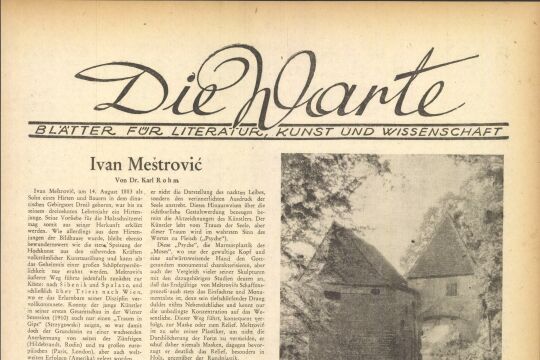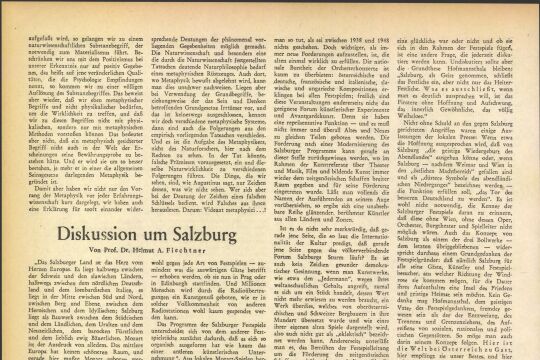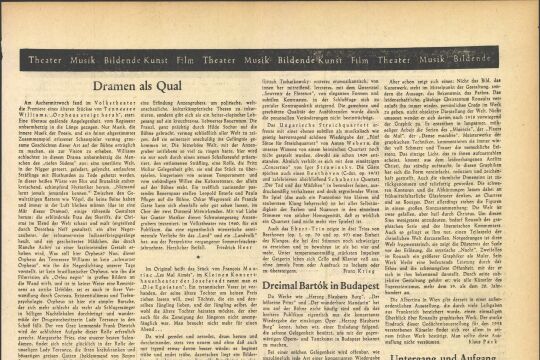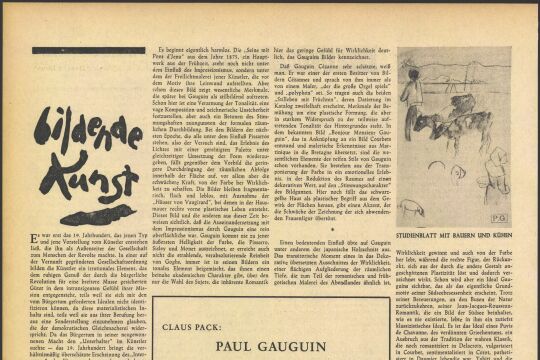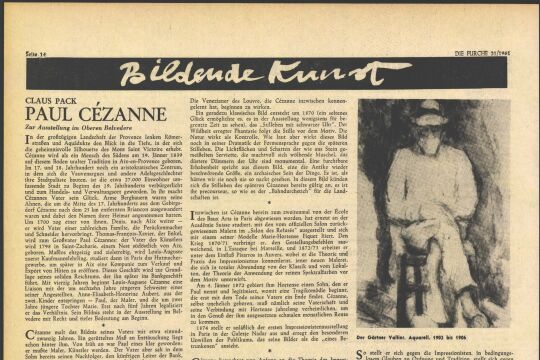Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
GEORGES ROUAULT
Jeder große Künstler ist als Erscheinung zu komplex, als daß man seine Wesenheit erklären könnte. Es gibt Geheimnisse der Seele, die nicht entschlüsselbar sind und ohne Schaden an der Wahrheit nicht für entschlüsselbar gehalten werden dürfen. Vor dem Künstler zumal, sobald er eine bestimmte Höhe und Tiefe erreicht, verstummen die Erläuterungen der Weisen, sobald es um die Letzten Dinge geht, und das Staunen beginnt.
Mit diesen Vorbehalten ausgerüstet, wollen wir uns Rouault, dem Patriarchen, geboren am 27. Mai 1871, gestorben 1958, nähern. Es gibt in seinem Dasein etliche Punkte, die uns vor anderen aufschlußreich erscheinen. Unter eine Photographie, die ihn als siebenjährigen aufgeweckten Buben mit festem Blick zeigt, schrieb er in seinem Alter: „Er wird in seinem Werk kühner sein als in seinem Leben.“ — Nach dem Tode seines Lehrers Gustave Moreau, der ihn akademisch-illustrativ malen gelehrt hatte, erlitt er als Zweiund-dreißigjähriger eineti Nervenzusammenbruch: er erkannte, daß sein ganzes Schaffen bis dahin gegen sein eigenes inneres Wesen gerichtet war. Später notierte er über diese Situation: „Mich traf ein Blitzschlag — vielleicht war es ein Strahl der Gnade I“
Mit der Heiterkeit und Fassung des Rekonvaleszenten, den der Abgrund, die Nähe des geistigen Todes nicht zerbrochen, sondern reifer und offener gemacht hat, geht er wieder an die Arbeit — und wird der größte religiöse, katholische Maler eines Jahrhunderts. Seine Stärke ist die Macht, die er über sich selbst hat. Vor etlichen Jahren verbrannte er, rücksichtslos gegen sich selbst, 315 seiner Werke. Er achtete ihres objektiven Wertes nicht. (Es gibt Gemälde, von. ihm, für die bis.zu 30.000 Dollar bezahlt wurden.)
Sein Vater stammte aus der Bretagne (der „irrationalsten Provinz Frankreichs“), religiöse Themen bildeten die Luft von Georges Rou-aults Kindheit. Eigenständiger Geschmack lebte im Hause, die Tanten bemalten Porzellan, der Vater war Kunsttischler (nicht zu verwechseln mit den Industriesklaven von heute), der Großvater gar verehrte, im Gegensatz zur öffentlichen Meinung, Manet. Als Vierzehnjähriger kam Rouault zu einem Glasmaler in die Lehre.
Bei George Moreau, dem Bürger-Künstler einer Zeit, die Bourgereau für einen großen Maler hielt, blieb er viele Jahre im Atelier, mit anderen jungen Malern, darunter Matisse. Er fügte sich in Moreaus Unterweisungen, er schätzte dessen lauteren Charakter, er sah ihn in aller Harmlosigkeit als Autorität an. Das fiel ihm nicht schwer, denn er hatte nie das Bedürfnis, ä tout prix originell zu sein. „Moreau lehrte uns, unsere Wünsche zu zügeln“, vermerkt er in einem Brief.
Der „Blitzschlag“ kam nach dem Tode Moreaus, „am Ende eines schönen • Tages, als der erste Stern, der am Himmel erglänzte — ich weiß nicht, warum —, das Herz erschütterte...“ Plötzlich stürzt ihm die Tragik des irdischen Menschseins in ein Gleichnis, das er mit unvergeßlichen Worten zu beschreiben versucht. Er spricht darin von einem armseligen umherziehenden Komödianten und seinem dürren Gaul, von einem Clownskostüm: „ ... dieser Kontrast der glitzernden, funkelnden Dinge, gemacht, um uns zu amüsieren — und dieses Leben einer unendlichen Traurigkeit...“ Die Szene erweitert sich, ihm: „Der Clown war ich, sind wir, sind wir alle — wir tragen alle ein Flittergewand. Doch wenn man es einem wegnimmt: Wer würde nicht bis in die Eingeweide von grenzenlosem Mitleid erfaßt?“
Jetzt kommt der Entschluß, der sein Leben entscheidet: „Keinem Menschen das Flittergewand zu lassen, sei es ein König oder Herrscher. Der Mensch vor mir — ich will seine Seele sehen!“ Kein Zweifel, der Zusammenbruch war zugleich der Augenblick der menschlichen und religiösen Konversion, folgerichtig auch der künstlerischen. Für Rouault ist nicht das Motiv entscheidend, sondern der Gehalt. Er flieht für Jahre jedes religiöse Motiv, er malt Clowns, käufliche Richter, Dirnen. Und wie er sie malt! Niemand versteht ihn, außer einigen Freunden.
Einst, in der Lehrzeit, hatte er kein Geld für seine Malsachen. Da nahm er das Fahrgeld, das ihm der Meister für Botengänge gab, und machte die Wege zu Fuß. Doch sein Gewissen war so wach, daß er die ganzen Strecken neben der Pferdebahn einherlief, um sicher zu sein, daß er den Padron um keine Minute seiner Zeit/ bestahl. Mit solchen charakterlichen Bärenkräften ausgestattet und mit echt bretonischer (keltischer) Zähigkeit geht er von neuem ans Werk. An ein Werk, das unvergleichlich und ohne Vorbild und wesentliche Nachahmer geblieben ist bis auf den heutigen Tag.
Schicksalhaft fallen in diese Periode Begegnungen mit Huysmans und Leon Bloy. Nachdem Rouault „La femme pauvre“ gelesen hat, notiert Bloy erschüttert in seinem Tagebuch: „Dieses Buch hat ihn ins Herz gebissen, hat ihn unheilbar verletzt.“ Doch vor der neuen Malerei Rouaults prallte Bloy entsetzt zurück. Ihn entzückten die frühen, braven Bilder im Akademiestil, das Neue nannte er hilflos „Gräßlichkeiten und rachsüchtige Karikaturen“, er begriff nicht, daß Rouault seine Dirnen, Richter und Clowns deshalb so hart und in erschreckend bösen Farben malte, weil er die Menschen liebte und sein Malen als Gleichnis zur Gottesferne dachte. Er stellt sich die Passion Christi nicht als historisches, sondern als immerwährendes Ereignis vor, Christus wird zu jeder Stunde von den Menschen neu verspottet, gegeißelt, gekreuzigt. Aus diesem Credo schöpft er seinen unerschöpflichen Zorn und seine wilde Klage.
Mit seinem machtvollen Glaubensakzent war er, soziologisch gesehen, der „Christenheit“ seiner Tage in Frankreich um ein Menschenalter und um eine geistige Revolution voraus, doch das machte nicht den großen Maler aus. Sein Talent war nie brillant, sein Malergenie wirkte gleichsam unterirdisch; er scheute geschwätzige Zirkel, Salons, scheute vor allem jene Maler, die Genie durch Wissen und Reden ersetzen wollen, scheute Ausstellungen. Mit seinem Kittel und einer weißen Bäckermütze angetan, schloß er sich in seinem Atelier ein, das während der Arbeit niemand betreten durfte. Und malte. Mit urtümlicher Kraft steht das Schwarz neben dem Weiß in seiner Graphik, befehden einander beißlustig die wuchtigen Farben seiner Oelmalerei. Man nennt seine Farben provokant, seine Formen aggressiv. Er staunt über solche Kritiken, schüttelt sie ab wie ein Hund die Wassertropfen aus seinem Fell. Einige verweisen seine Kunst geistig ins 13. Jahrhundert. Mag sein. Unwichtig. Er ist in der religiösen Kunst ein Jahrhundert für sich.
Einer, der ihn versteht, ist Maritain. In „Kunst und Scholastik“ und „Die Grenzen der Poesie“ finden sich tiefe Bemerkungen über Rouault. Er pflegte lange Zeiten hindurch einmal in der Woche bei den Maritains zu essen, erscheint, kochend vor Ideen, hält Monologe, auf die er keine Antwort erwartet, bringt auch Gedichte mit: „Die Kritiker reden gut, doch wenn ich fischen gehe zum Fluß ... und Jesus und seine Mutter bieten mir einen Fisch aus lebendigem Silber an ...“ Er redet vom Heiligen brüderlich, so familiär, wie es mehrmals in der deutschen Mystik geschah, und manche Zeile ist wie von Villon.
Er lebt zurückgezogen, arm, staunt, wenn man ihm rät, Bilder zu malen, die sich verkaufen. Kann man das? Die Malerei ist sein Leben. Wie könnte einer sein Leben verhöckern?
In dem Jahrzehnt, in dem er (bis 1927) am „Miserere“ schafft, malt er kaum. Als er wieder zum Pinsel greift, sind seine Farben reicher, .leuchtender geworden. Die Serie berijhmer -Landschaften entsteht, die großen religiösen Bilder. Ja er wagt jetzt religiöse Motive, seine Kunst ist reif dafür geworden. Er erzählt nicht wie einst als Schüler, das Heilige ist nicht mehr angewandte Literatur, sondern Sinnbild, Inkarnation, und es leuchtet von der Leinwand herab wie aus den Glasfenstern gotischer Kathedralen. Venturi merkt an: „Es scheint ... als käme das Licht aus den Gemälden selbst ...einzigartig in der Geschichte der Malerei. Rem-brandt, Daumier, Cezanne, die großen Anbeter des Lichts, sie müßten das Neue in den Farben Rouaults erkennen: das Phosphoreszieren ...“ Diese Farbkunst allein schon gräbt seinen Namen unauslöschlich in die Geschichte der Malerei.
Er beschäftigte sich wiederholt mit der Gobelinkunst, mit der Glasmalerei, mit der Keramik — als Handwerker. Er entwickelte Farben, die niemand vor ihm kannte. Das genügte ihm zur Intensität des Ausdrucks,' er i konnte figurativ bleiben, er empfand die Abstraktion als Versuchung, fürchtend, in intellektueller Luft „auszutrocknen“. Er sah seine Aufgabe „wie ein Musiker“ in der verwandelnden Uebertragung materieller, geistiger, seelischer Realitäten.
Mit zunehmendem Alter beruhigen sich seine anklägerischen Paroxysmen in Form und Farbe zu vertiefter Daseinsschau, vermag er in seinen Landschaften, Blumen, Früchten das Ruhen im Gottesfrieden zu erahnen. Man erinnert sich des Ausspruchs, den der alte Lehrer Moreau einst, den Jüngling umarmend, tat: „Sie lieben die Materie (die Dingwelt), ich beglückwünsche Sie!“ Aus dieser Liebe, diesem Welt-Eros, ist alles, was Rouault schuf, selbst die tragischsten Themen, letztlich mit Freude getan, mit einer tiefen, unzerstörbaren, dickköpfigen Freude am Leben. Mit einer Freude, die das Leben, auch im Schmerz, in seiner Unbegreiflichkeit als Geschenk zu würdigen weiß.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!