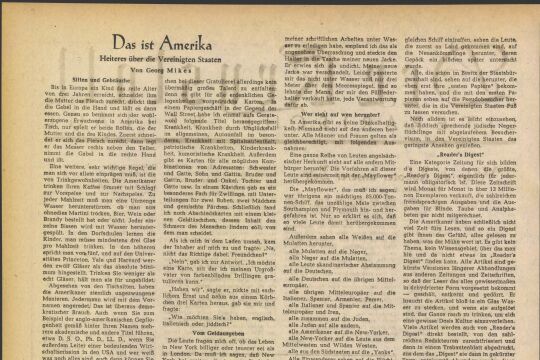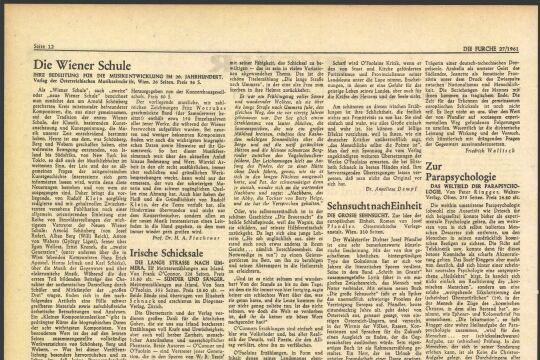Nach der Lektüre von ein paar Seiten Text von Flannery O'Connor sitzt man grübelnd da - und beginnt möglicherweise von vorne.
Flannery O'Connor arbeitete sich an der Erbsünde ab. An Mord und Totschlag, Gewalt und Tod. Literatur könne nicht gedeihen in einem Klima, 'in dem der Teufel nicht wahrgenommen wird'.
USA, Südstaaten. Vater, Mutter, Kinder und Großmutter machen einen Ausflug mit dem Auto. "Tennessee ist bloß ne Müllhalde für Hinterwäldler", schimpft das Kind, "und Georgia ist genauso ein blöder Staat." Die Großmutter hält dagegen: "'Zu meiner Zeit', sagte die Großmutter und faltete ihre dünnen, stark geäderten Hände, 'hatten Kinder mehr Respekt vor ihrem Heimatstaat und vor ihren Eltern und vor allem Übrigen. Damals wussten die Leute, was sich gehört. Oh, schaut mal, das niedliche kleine Negerlein!', sagte sie und zeigte auf ein Negerkind, das an der Tür einer Hütte stand."
Der abrupte Wechsel verweist auf die "gute alte Zeit" - und die Übersetzung übernimmt zurecht heute verpönte Begriffe. Schon sehen wir die guten alten Plantagen. Vielleicht auch die Klischeebilder der Romanverfilmung "Vom Winde verweht", die Flannery O'Connor so verachtete. Es sind kleine, plötzliche Verschiebungen wie hier, in dieser Rede der Großmutter, mit denen O'Connor kunstvoll ins harmonische Gewebe reißt. Erzählend - nie behauptend oder moralisierend -macht O'Connor subtil aus einer feinen, schön angezogenen alten Dame eine immer unangenehmere Gestalt. Was freundlich klingt, kann messerscharf herablassend sein. So etwa, nachdem die Familie mit dem Auto verunfallt ist. Da sagt die nette alte Dame jenem Fremden, von dem sie hofft, er würde helfen: "Sie sehen kein bisschen so aus, als ob sie aus einer ordinären Familie stammen, Sie kommen ganz bestimmt aus einem guten Elternhaus!"
Die 1955 in der gleichnamigen Sammlung von Kurzgeschichten erschienene Story "Ein guter Mensch ist schwer zu finden" gehört zu den berühmtesten der amerikanischen Schriftstellerin Flannery O'Connor und man staunt noch heute über die Erzählpräzision. Die Großmutter redet darin sich und ihre Familie im wahrsten Sinn des Wortes um Kopf und Kragen. Während die Kumpanen des Fremden die Familie in den Wald bringen - man hört Schüsse -, hört sie nicht auf zu reden und ihr Gegenüber zum Beten aufzufordern. Erst kurz vor ihrem Ende flackert so etwas wie Zweifel auf, erst dann wird das Hierarchiebewusstsein von Berührung abgelöst, als sie die Schulter des Fremden streift: "Du bist eins von meinen eigenen Kindern!"
Kunstvolle, verblüffende Dialoge, überraschende, plötzliche Wendungen, faszinierende Anfänge und erstaunliche Enden: kaum zu glauben, dass diese Autorin hierzulande so wenig bekannt ist. Ein einzelner Satz, ein einzelnes Wort kann mehrere Bedeutungen und Interpretationen auf einmal öffnen -und nach der Lektüre von ein paar Seiten Text sitzt man grübelnd da und beginnt von vorne.
Dramatische Notwendigkeit: der Teufel
1925 in Savannah, Georgia, geboren, studierte Flannery O'Connor Soziologie und Journalismus. Das Leben im Bundesstaat New York, wo sie andere Schriftsteller traf, blieb Episode. Nachdem die Autoimmunkrankheit Lupus diagnostiziert worden war, zog sie zu ihrer Mutter nach Milledgeville, wo sie in den letzten Jahren ihres Lebens von Schmerzen geplagt nur mehr mit Krücken gehen konnte. Sie hielt über 100 Pfauen, las Augustinus, Thomas von Aquin, James Joyce, Teilhard de Chardin, Søren Kierkegaard, Edgar Allen Poe und Nathaniel Hawthorne. Als Katholikin lebte sie umgeben von Protestanten und Evangelikalen und ließ sich von ihrer Mutter täglich zur Messe fahren. Fromm ist ihre Literatur nicht, Gnade aber ein wichtiges Thema. An der Erbsünde arbeitete sich O'Connor ab. An Mord und Totschlag, Betrug und Diebstahl, Gewalt und Tod. Literatur, so O'Connor, könne nicht gedeihen in einem Klima, "in dem der Teufel nicht wahrgenommen wird". Der Teufel: eine dramatische Notwendigkeit für Schriftsteller und ziemlich zugegen. Ein katholischer Romanautor müsse kein Heiliger sein, schrieb O'Connor einmal, er müsse noch nicht einmal katholisch sein, er muss aber "unfortunately" Romancier sein: Er sehe die Welt, wie sie ist, und könne gut schreiben. Das konnte sie, und wie. O'Connors Literatur hat Nick Cave ebenso beeinflusst wie Bruce Springsteen, den die "Nichterkennbarkeit Gottes" und die unerklärbaren Mysterien ergriffen haben. O'Connors Spuren findet man vor allem in seinem 1982 erschienenen Album "Nebraska". Dass ihr auch Quentin Tarantino manches verdankt, ahnt man während der Lektüre.
Am 3. August 1964 starb sie 39-jährig. Ihre Erzählungen wurden posthum mit dem National Book Award ausgezeichnet, seit 1988 sind ihre Werke als Klassiker in die Library of America aufgenommen und 2015 widmete man O'Connor eine 93-Cent-Briefmarke. Von den wenigen Erzählungen sind zehn nun -warum nicht alle? - neu auf Deutsch übersetzt, nicht immer ganz überzeugend, aber eine Einladung und Chance für jene, die die Lektüre nicht im Original wagen.
Die 1955 erschienene Erzählung "Der Flüchtling"(im Original "The Displaced Person") verweist auf die Diskussionen um den Displaced Persons Act von 1948, der für einige Jahre die Einwanderung in die USA ermöglichte. Darin kommt ein "Pole" mit seiner Familie auf die Farm von Mrs McIntyre. Die Angestellte Mrs Shortley ist nicht bereit, sich den Namen der Fremden zu merken, wundert sich aber, dass sie aussehen wie andere Leute auch, und fragt sich: "Wenn sie von dorther kamen, wo ihnen solche Sachen angetan worden waren, woher wusste man dann, ob sie nicht von der Sorte waren, die so etwas anderen auch antun würden?" In ihrer Vision sieht sie schon "zehn Millionen Milliarden Fremde" in Arbeitsstellen drängen und die "Neger" andere Arbeitsplätze suchen. Eine Vision, die sie diesen dann auch mitteilt. Langsam und stetig träufelt das Gift ihres Sprechens in das Denken der Umgebung, während man vom Zugereisten nichts erfährt. "Sie fand, es müsste ein Gesetz gegen sie geben. Es gab keinen Grund, warum sie nicht dort drüben bleiben und den Platz von ein paar derjenigen einnehmen konnten, die in ihren Kriegen und Gemetzeln umgebracht worden waren." Auch die Farmerin ist nur auf den ersten Blick gastfreundlich. Immer deutlicher wird ihr ökonomisches Nutzendenken und der Unwille, Verantwortung zu übernehmen. O'Connor webt eine schreckliche Erzählung aus Vorurteilen, Verantwortungsverweigerung, Sorge um "Reinheit" und Gewalt durch Sprache und Nichtstun.
"Ich hab Sie gleich erkannt"
Unter der Ebene mancher Komik, lobte Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison in ihrem jüngsten Band "Die Herkunft der anderen", finde sich bei O'Connor "eine scharfsinnige und präzise Schilderung, wie das Bild des Fremden konstruiert wird und welchen Nutzen es seinen Verfertigern bringt."
"Sie sind der Outlaw!", schreit die Großmutter in der eingangs erwähnten Geschichte an einer entscheidenden Stelle. "Ich hab Sie gleich erkannt!" Ein dummer, folgenreicher Fehler, das weiß man aus jedem Thriller. Doch dieser Satz ist vor allem in anderer Hinsicht bedeutsam. Hier wird ein Fremder als Gesetzloser, Ausgestoßener benannt. Als "Misfit", wie es im Original noch passender heißt, denn Schuld und Strafe stehen in der Erfahrung dieses Menschen in keinem Verhältnis. Wir werden Zeugen einer Ausschließung. Und die geschieht auch bei O'Connor zunächst und vor allem durch Sprache.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!