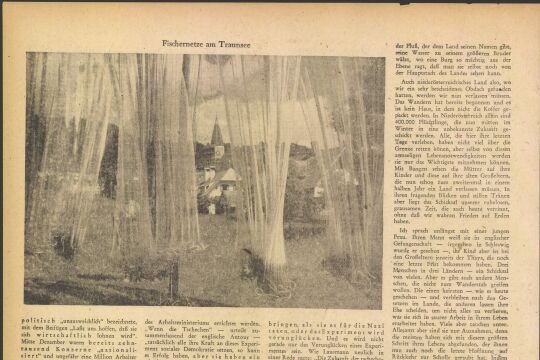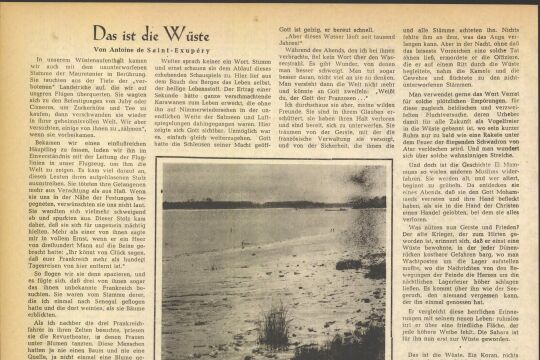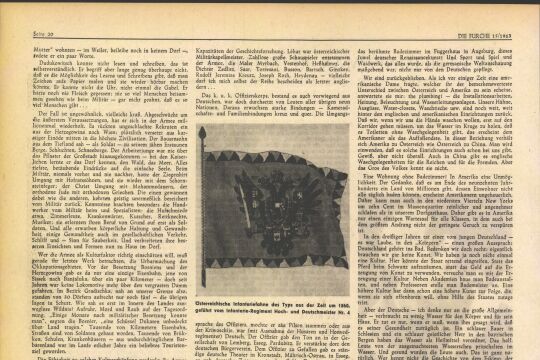Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gespräch auf wasserlosem Boden
„WIR HABEN VIEL LAND, auf dem sind wir die Herren.“ Der Sohn des Scheichs hat seine Zelte nahe der Piste aufgeschlagen, um Wasser zu kaufen von den Fernlastern, die vorbeikommen. Und er zeigt die Piste entlang und über die Savanne, in der kahle Sträucher sich im Sand verlieren. — „Wir haben viel Land. Wir können Nomaden bleiben. Wir würden zu leben aufhören, wenn wir gezwungen würden, an einem Ort zu bleiben. Aber wir lassen uns von niemandem zwingen, auch nicht von Mogdar Ould Daddah.“
Es ist der trockenste Teil Mauretaniens, über den der Stamm des Scheichs Achmed Kerkoub die Herrschaft ausübt. Die Trockenheit hat tiefe Falten in die Erde gegraben. An jedem Strauch zehren einige Esel oder Kamele. Und in der Ferne sieht man die rote Tönung des Sandes, den Anfang der tödlichen Saharadüne. „Ich bin Herr über das Land, das sich zwischen dieser Piste in Mauretanien und der großen Saharapiste ausdehnt. Wenn ich neben einer Stadt mein Lager aufschlage, ist sie voll vom Geschrei meiner Kamele.“
Aber im Reich des Scheichs gibt es außerhalb der vier Märkte nur zwölf Quellen. Und der Weg von Quelle zu Quelle ist so weit, daß die Frauen, die Sklaven und die Kamele einander den Platz an der Quelle streitig machen, wenn sie zu einer kommen. Nur die Herren warten, bis die Frauen, die Sklaven und die Kamele, vom Wasser schwer, sich zurückgezogen haben und eingeschlafen sind. Und kochen süßen, gewürzten Tee. Denn die Herren trinken kein Wasser.
„ICH KENNE PARIS, und zwei meiner Frauen waren mit mir in London. Der Stamm, wie Sie ihn hier lagern sehen, Männer und Frauen, nur die Kamele und die Esel ließen wir zurück, zog mit mir durch Italien. Von Sizilien bis zu den Dolomiten. Wir haben die Waffen der Deutschen kennengelernt. Wir haben in Häusern geschlafen, in denen es elektrisches Licht und fließendes Wasser gab, und deutsche Kriegsgefangene wuschen unsere Wäsche. Wir wissen, wie es ist, in Städten zu wohnen, nicht nur in den kahlen Städten der Savanne, sondern in Städten, die der Stolz Europas sind. Französische Ingenieure und Regierungsbeamte sind zu uns gekommen mit Plänen, wie Wasser in unser Gebiet gebracht werden kann, so daß wir nicht mehr von Quelle zu Quelle ziehen müssen und bleiben können, wo es uns am besten gefällt. Wir haben die Herren zurückgeschickt.“
Der japanische „Sony“-Tränsistor, der zu jedem Nomadenzelt gehört wie der Wassersack, bringt Meldungen aus Paris.
Wir saßen auf der durch lange Perioden der Trockenheit und plötzliche Regengüsse, die niemandem Erleichterung und nichts als Verheerung brachten, zerstörten Piste. Wir warteten, bis ein Fernlaster sich am Horizont abzeichnete. Wir hielten ihn auf. Der Scheich kaufte Wasser; um schweres Geld, das sein Schatzmeister aus einem schwarzen, von vier Sklaven bewachten Zelt holte. In einigen Stunden wird der Stamm genug Wasser gesammelt haben, um den Weg zur nächsten Quelle durchgehen zu können. Der junge Scheich Mogdar Mamadou will sich Bei der nächsten Wahl ins Parlament wählen lassen, egal auf welcher Liste. Zweimal im Jahr wird er auf einem weißen Reitkamel nach Nouachshott reiten und den Herren sein ewiges Recht auf das Nomadentum als Botschaft „ins Gesicht schleudern“.
Ob er die Unabhängigkeit begrüße, die am 28. November für Mauretanien proklamiert wird?
„Ich war nie abhängig.“
Ob er für Marokko sei, wie die Großkaufleute in Atar, die den „Anschluß“ nicht erwarten können, oder für die Selbständigkeit Mauretaniens kämpfen würde? • „Ich bin für mein Reich zwischen den Pisten, das schon bestand, bevor Ihr die Schlacht von Tours und Poitiers gewannt. Ich, bin für die Stämme, die darauf wandern und die alle meinem Vater gehören.“
ABENDS, AM RANDE DER STADT ATAR, die zwischen der neuen Hauptstadt Nouachshott und den Erzbergen von Fort Gouraud liegt. Die Soldaten der französischen Garnison sind schon in den Kasernen, die Läden der Kaufleute sind noch offen und werden es bis ein Uhr früh sein. Auf den Straßen sind Unteroffiziere, maurische Kaufleute, eine Handvoll europäischer Spezialisten, die morgen nach Fort Gouraud gehen, Prostituierte und Fernlasterchauffeure. In den Höfen der Häuser werden bis in den Morgen kleine Lagerfeuer brennen. Der rote Sand zwischen der Stadt und dem Horizont ist bespickt mit Hunderten von Feuern der Stämme, die an Atar vorbeiziehen, um zu kaufen, zu verkaufen und Wasser in großen Tonnen zu holen. Vom Markt kommt der süßliche Geruch des Fleisches, das während des Tages nicht verkauft werden konnte und verfault. Und das Schreien der Hyänen und der Aasgeier, die in der Zeit bis zum Morgen den Markt sauber und rein gefressen haben werden, daß er hygienisch ist wie die Markthallen von Stockholm.
Zwischen den Fernlastern, die wie eine Wagenburg aufgestellt sind, wo die Piste aus Atar hinausführt, sitzen die Chauffeure. Wollops aus dem Süden und etwas separiert die maurischen Chauffeure der großen maurischen Transportfirmen. Sie vertragen einander nicht sehr gut, die Wollops vom Süden werfen den Mauren Halsabschneiderei vor, die Mauren halten alle Neger für davongelaufene Sklaven und Diebe. Die gegenseitige Einschätzung wird aber nicht zu ernst genommen, gerade erwähnt und gefühlt. Nur manchmal, wenn die Temperatur während des Tages über 60 Grad steigt und die Nacht so kalt ist, daß die Wollops sehr offen und die puritanischen Mauren geheim Arrak aus den Geschäften holen, kann es dazu kommen, daß der eine dem anderen Wasser verweigert und der andere dafür Blut rinnen läßt.
In dieser Nacht ist es nicht sehr kalt, und der Tag war nicht heiß. Die schwarzen Chauffeure singen, trinken aus einem großen Lavoir saure Eselsmilch, die mit Wasser verdünnt und gezuckert ist und den Durst des ganzen Tages löscht. Die Fährer der schweren Züge, eine Aristokratie unter den motorisierten Pistennomaden, trinken Tee, der von ihren Gehilfen und Dienern in langwieriger Zeremonie vorbereitet wird.
IN DEN FÜNF STUNDEN, die wir zwischen den Wagen saßen, bevor wir uns am Rand der Piste schlafen legten, sprachen sie sehr ruhig.
Es fehlte die Würze männlicher Gespräche in Europa, wie Zoten und die gemeinsame Betrachtung pornographischer Bilder, es fehlte das Gasthauslachen und das Erzählen amouröser Begebenheiten. Ibrahim Ugdar, der Fahrer, mit dem ich neun Tage lang über die Piste fuhr und der immer kontrollierte, ob ich nachts nahe genug bei den Reifen schlief, so daß der Geruch des Gummis die Schlangen von mir abhalte, war als Student eines technologischen Instituts in Paris gewesen. Er liebt Europa, und er will nach Europa zurückkehren. Er liebte Afrika. Und er will die Europäer, besonders die Franzosen, aus Afrika draußen haben. Aber er mißtraut auch den afrikanischen Politikern.
Die Politiker der Mauren werden von der „Zivilisierung ihres Landes“ sprechen, aber sie werden unter einer Decke mit den Stämmen stehen, wenn die Maurenscheichs wiederum, wie vor der französischen Herrschaft, die Neger im Sudan und im Senegal überfallen. Und sie werden heimlich an der Beute beteiligt sein. So sind die Mauren, und so wird es sein, wenn die Franzosen gegangen sind. Und er mißtraut den senegalesischen Politikern. Die werden ihre Familien in alle Ämter setzen und den ganzen Senegal zum Eigentum einiger Großfamilien machen, wenn die Franzosen einmal fort sind und Senghor gegangen ist. •
Er mißtraut den Kommunisten in Guinea, weil sie den Islam vernichten und Afrika die Gottlosigkeit aufzwingen werden, wenn die Franzosen einmal gegangen sind. Und er mißtraut den islamitischen Missionären, die aus Ägypten kommen und mit ihren Missionen vorgeben, den Islam verstärken zu wollen.
„Aber sie haben einmal mit dem Islam die Sklavenjagden gebracht. Wir haben den Islam behalten und ihn zu unserem Islam gemacht. Wenn sie heute wiederkommen und sagen, unser Islam sei zu weich und nicht der richtige, so bereiten sie wahrscheinlich neue Sklavenjagden vor, die sie erst durchführen können, wenn die Franzosen gegangen sind.“
IBRAHIM MISSTRAUT ALLEM, was jetzt an sein Land, den Senegal, herankommt. Er fürchtet die Zeit, in der es keine Franzosen mehr in Afrika geben wird — aber er will die Franzosen so rasch wie möglich aus Afrika entfernen. In seinem Kopf ist ein unentwirrbares Durcheinander von Hoffnungen, Befürchtungen und Ängsten. Sein politisches Denken ist ein Knäuel aus fremden Phrasen und eigener Erkenntnis. — Nur Haß fehlt. Er weiß es selbst und sagt um ein Uhr morgens, da wir uns neben den Rädern zum Schlafen legen: „Wir sprechen im Kreis, wir leben im Kreis, wir tun das jetzt seit fünf Jahren und fühlen uns eigentlich ganz wohl dabei. Aber was kommen wird, weiß ich nicht. Nicht einmal, was kommen soll. Ich werde wiederum nach Europa gehen.“ — Er glaubt, er werde dort die Klarheit des Denkens erlernen. Eigenartig, daß man immer von anderen Kontinenten erwartet, was der eigene nicht geben kann.
Unter den Chauffeuren, zwischen den Fernlastern, waren auch einige Radikale, nicht schlecht geschult. Sie sprachen von Lenin und Stalin, von Sekou Toure, von Mao Tse-tung und von Tito. — Sie sprachen nicht von Chruschtschow, weil er ihnen offensichtlich zu europäisch ist. Es sind Tito und Mao Tse-tung, die das politische Denken der Radikalen in jenen Teilen Afrikas, durch die ich fuhr, am stärksten beeinflußten. Es ist Israel, das das Denken der Gemäßigten am stärksten beeinflußt. Aber wenige, mit denen ich nächtens zwischen Fernlastern oder in schwarzen Nomadenzelten saß, sind „Radikale“ oder sind „Gemäßigte“. Fast alle sind nichts als Männer auf einem Kontinent, der plötzlich zur Politik erwacht oder in die Politik gestoßen worden ist. Und sie betrachten nun mit weitaufgerissenen Augen teils ängstlich, teils hoffnungsvoll die Erdbeben und die Vulkanausbrüche, in denen der Kolonialismus zugrunde geht und Afrika langsam eine politische Oberfläche finden wird.
ALS ICH VOM FORT GOURAUD über die Savanne nach Port Etienne fuhr, traf ich Alain de Mazary, Lehrer bei einem Nomadenstamm. Auf dieser Strecke gibt es keine Piste, nur den Sand und Steine, und der vierachsige Fernlaster kämpft um jeden Meter. Hier soll einmal eine Bahntrasse gelegt werden, über die das umstrittene Erz von Fort Gouraud nach Port Etienne gebracht wird, das heute ein kleiner Fischerhafen ist und in einigen Jahren zum größten Erzexporthafen Afrikas werden soll. Alain de Mazary lebt seit acht Jahren unter Nomaden. Er zieht mit den Stämmen auf seinem weißen Reitkamel. Er schlägt sein Zelt auf, stellt seine Schiefertafel auf und sammelt immer wieder die Kinder zum Lernen, wenn der Stamm auf einer Weide bleibt.
„Die französische Verwaltung wird gehen. Die Herren aus der Ecole Coloniale und dann •uch die Obersten, die Majore und die Soldaten. Ich bin kein Verwalter, ich bin kein Soldat, ich bin Lehrer, und ich werde es so lange bleiben, solange die französische Sprache hier ist. — Wenn man mich läßt und wenn man die Lehrer aufnimmt, die nach mir kommen.“ — Der Stamm, mit dem Alain ritt, hat ihn als einen der Seinen aufgenommen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!