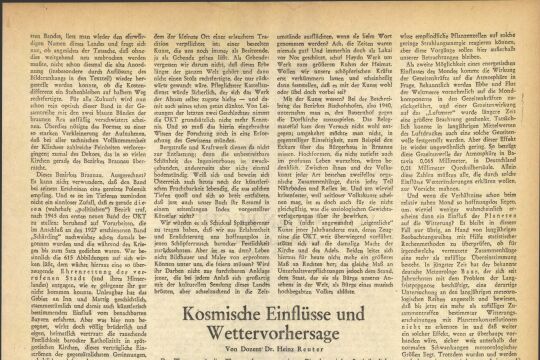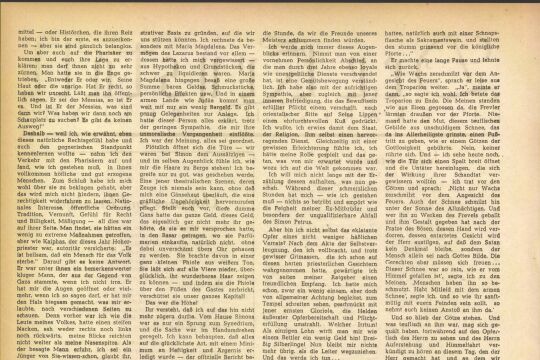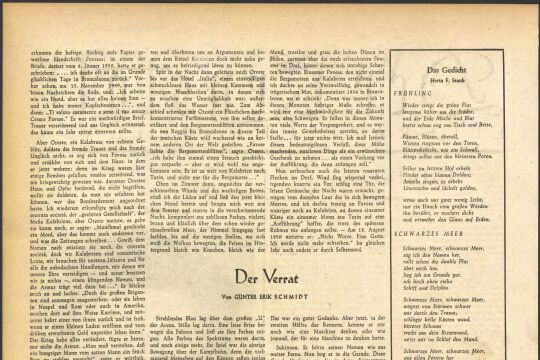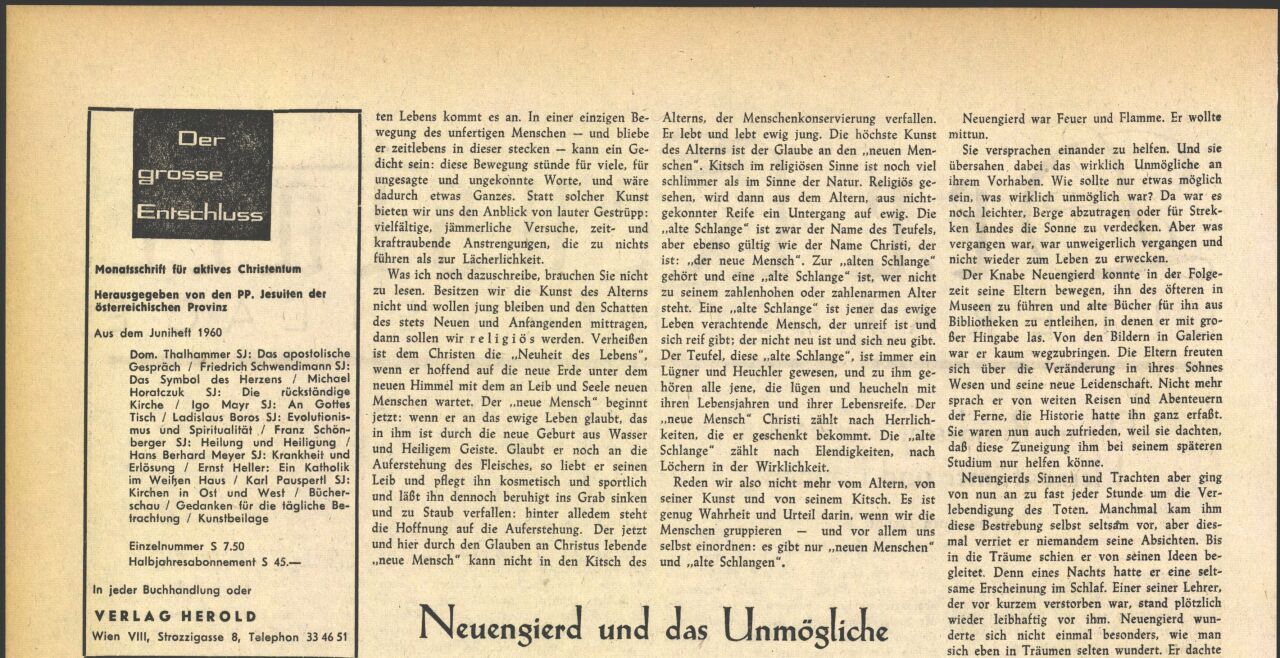
Das Ja und das Nein sind nebeneinander da.
Viele Leute, die nichts wissen, werfen der Wahrheit vor, sie sei unduldsam. Man mufj sich über dieses Wort ausdrücklich verständigen.
Wenn man diese Leute hört, möchte man sagen, die Wahrheit und der Irrtum wären zwei Wesen, die auf gleicher Ebene miteinander verhandeln könnten, zwei Königinnen, die einander ebenbürtig wären, die — eine jede in ihrem Reiche — in Frieden leben mühten, zwei Göttinnen, die sich in die Welt teilten, ohne dah die eine das Recht hätte, der andern ihr Reich streitig zu machen. Daher denn die Gleichgültigkeit, die der Sieg Satans ist. Der Hai) gefällt ihm, genügt ihm jedoch nicht, er braucht auch noch die Gleichgültigkeit.
Die Gleichgültigkeif ist Hafj von einer Galtung für sich, ein kalter und dauerhafter Hafj, der sich vor den andern und manchmal auch vor sich selbst hinter der Maske einer duldsamen Miene verbirgt — denn die Gleichgültigkeit ist niemals, was sie zu sein vorgibt. Sie ist mit Lüge überzogener Hafj.
Um tagtäglich eine Flut von heftigen Beleidigungen gegen die Wahrheit offensichtlich auszuspeien, müfjfen die Menschen anders sein, als sie sind.
Die Partei, die sie ergreifen, ist: keine Partei zu ergreifen. Und dennoch ist der laut schreiende Hafj, da die Erbsünde einmal gegeben ist, weit eher zu erklären als der schweigende. Nicht setzt mich in Erstaunen, dafj ich Lästerung einem menschlichen Munde entfahren höre. Die Erbsünde ist vorhanden, die Freiheit des Menschen ist vorhanden, und so ist die Lästerung erklärt. In ganz und gar nicht auszudrückende Bestürzung dagegen versetzt mich die Scheu, Partei zu ergreifen. Es geht um die Zukunft des Menschen und um die ewige Zukunft alles dessen, was in der Welt die Gabe des Verstandes und der Freiheit hat. Es geht sicherlich und notwendig um dich selbst, wie eben auch um jeden und jedes. Wenn du also weder für dich noch für irgend jemand noch für irgend etwas Gefühl aufbringst, so geht es doch sicherlich und notwendig um ein geheiligtes Gefühl für dein eigenes Ich. Wenn du lebendig bist, so erwecke das Leben in dir! Nimm deine Seele und bringe sie ins Handgemenge! Nimm dein Sehnen, nimm dein Denken, dein Gebet, deine Liebe! Nimm die Werkzeuge zur Hand, die du zu gebrauchen verstehst, und wirf dich ganz in die Waagschale, auf der alles und jedes Gewicht hat. Wenn du schläfst, so erwache! Wenn du tot bist, stehe auf von den Toten! Suche die besten deiner Erinnerungen in deinem vergangenen, deinem erloschenen Leben! Gedenke des Morgenduftes der Rosen von einst, du mufjt ihn doch einmal genossen haben, und sieh zu, ob du die Kraft hast, zu sagen: „Was macht das schon aus!“
Da man zwischen die Feuerlinie derer, die lieben, und derer, die hassen, gestellt ist, mufj man den einen oder den andern Waffenhilfe leisten. Du sollst es wissen! Nicht an den Menschen im allgemeinen ergeht der Ruf, sondern an dich ganz persönlich. Denn alle sittlichen, geistigen und stofflichen Kräfte, über die du verfügst, sind Waffen, die Gott dir in die Hand gegeben hat zugleich mit der Freiheit, sie für ihn oder wider ihn zu benutzen. Du muht dich schlagen, und notwendig schlägst du dich auch. Nur die Wahl des Kampfplatzes ist dir überlassen.
Die Seele des Menschen ist für die göttliche Nahrung geschaffen, in der Zeitlichkeit wie in der Ewigkeit. Es gibt nicht zwei Quellen des Glücks, es gibt nur eine; diese aber wird niemals versiegen, und alle können aus ihr trinken. Liebst du also die Langeweile — dann wende dich an das Nichts. Liebst du das Leben, liebst du das Glück, liebst du die Liebe — dann wende dich an das Sein!
Hätte Neuengierd seinen kleinen Freund mitgenommen. Aber nun würde er allein das Wagnis unternehmen. War es doch schon ein Wagnis, bei Vollmondschein das elterliche Heim zu verlassen, bis auf den Stephansplatz zu eilen, und noch schwerer schien es ihm, dann wieder nach Haus zu kommen. Daß er ja dann eine längere Reise antreten mußte, wenn es sich lohnen sollte, daran dachte er nicht. Längere Zeit noch ließ das Vollmondgesicht im Kalender auf sich warten, das gab ihm etwas Beruhigung, doch mit dem täglichen Vorrücken der Zeit wurde er wieder unruhig. Er hatte inzwischen nicht wenig Abenteuerbücher studiert, um alle Gegebenheiten für sein Unternehmen ausfindig zu machen und auszunützen. Vor allem mußte er sich eigene Wohnungsschlüssel verschaffen, das war klar. Es war auch gar nicht sicher, ob es ihm das erste Mal glücken würde. Ob Wolken nicht den Mond versteckten!
Das erste Mal wäre es auch schrecklich schwer gegangen Die Eltern waren zu Hause und hatten obendrein Besuch, dem man vorgestellt wurde. Aber, Gott sei Dank, der Himmel war bedeckt, und es war nicht daran zu denken, daß die Wolken sich verziehen könnten. Aber beim nächsten Mal lag alles günstiger. Er konnte sich's gar nicht besser wünschen. Die Eltern waren ins Kino gegangen. Neuengierd versuchte sein Vorhaben sofort auszuführen und lief auf den Stephansplatz. Wirklich geisterhaft lag dieser da, von Mondenschimmer überglänzt. Aber nun stand Neuengierd fast verzweifelt schon über eine Stunde vor dem Aufgang zum Turm und nirgends hatte er die genannte Tafel erspähen können.
Aber plötzlich — konnte er seinen Augen trauen? Wo soeben ein Auto vorübergeflitzt war, da ragte aus dem Boden eine Stange mit der Tafel: „Abfahrt zur Vergangenheit.“ Und schon hob er den Deckel, den er nun auf einmal am Fuße der Stange erblickte. Er fühlte mit einem Bein in den Schacht — und es bot sich ihm eine feste Grundlage, Ein Sprung, er konnte kaum gesehen worden sein, und er stand in dem Fahrgestell Schon gritt äPflfc1 Tiefe.- TifiaÜf
Gar nicht lange dauerte das Vergnügen. Bald auf dem Boden angekommen, trat er ins Freie. Aber was erblickte er! Er war wieder am Fuß des Stephansdomes, fast an dem gleichen Platz, von dem aus er abgefahren war. Nur lagen ringsum Gräber mit schönen hölzernen und geschmiedeten Kreuzen. Ein Friedhof war da, wie er ihn nie um den Stephansdom gesehen hatte. War sein Wunsch nach der Vergangenheit nun in Erfüllung gegangen? Er tat ein paar Schritte. Jetzt müßte er Menschen sehen! Da kam auch schon der erste, es war eine Frau in hochgeschlossenem, langem Trauergewande. Sie trug eine Gießkanne in der einen Hand und Blumen in der anderen, besuchte also jetzt bei Nacht das Grab eines Verstorbenen. Aber es berührte Neuengierd nicht seltsam, daß es Nacht war. Im Mondschein vermochte er sogar Namen und Sterbedaten von den Tafeln der Kreuze zu lesen. Neuengierd errechnete, daß die Toten schon mehr als zweihundert Jahre hier ruhten, wenngleich einige erst vor kurzer Zeit verstorben schienen. Aber plötzlich überkam ihn doch leichter Schauder, daß er zur Nachtzeit auf einen Friedhof geraten war.
Während er noch dachte, in die Kirche zu entfliehen, änderte sich der Himmel, der wohl auch derselbe geblieben war wie vor seiner Abfahrt. Nur die Zeit verging hier anscheinend rascher. Der Sternenhimmel verschwand fast zusehends. Es lichtete sich. Auch in den Straßen, in denen sich bald das Leben zu regen begann. Ein Bäckerbub rannte mit seinem Korb vor schmalen, hochgegiebelten Häusern, die Neuengierd nie vorher auf dem Stephansplatz gesehen hatte. Da saß ein livrierter Diener auf dem hohen Kutschbock eines vornehmen Wagens und wartete. Neuengierd ging ein pa;.: Schritte weiter und stand wieder vor einer Kirche. Das war doch die Peterskirche! Auf den Stufen zum Eingang bewegten sich Menschen in Trachten, wie er sie auf den Bildern alter Meister gesehen hatte. Die Vergangenheit lebte also um ihn. Gott sei Dank, daß es nicht mehr so finster war. Dies wäre hier in den Straßen zum Fürchten gewesen. Es gab kein elektrisches Licht. Bloß Lampen hingen hier, die mit Brennöl gespeist wurden.
Jetzt kamen Frauen in blumigen Krinolinen und Hauben oder Kapotthütchen auf dem Kopf. Männer trugen lange Mäntel, karierte Hosen sahen darunter hervor. Mit eleganten Stöckchen wirbelten sie durch die Luft oder schlugen sie gegen das gebuckelte Straßenpflaster. Die meisten hatten Barte. Ach, wenn er an sich heruntersah — sie würden seine ganz andere Bekleidung erkennen. Er hielt sich fern von den Kirchengängern und vom Straßenverkehr. Aber es ging nicht leicht. Immer mehr Menschen kamen von allen Seiten. Es mußte ein Festtag sein. Sie bewegten sich in bunten Reihen. Hier trug man eine Sänfte über den Graben an der Pestsäule vorbei zum Trattnerischen Gewölbe (wie da zu lesen war). Da klingelten Pferde an einen Wagen gespannt. „Die Vigano“, hörte er die Leute murmeln. Eine hübsche junge Frau entstieg ihm und eilte geradewegs über die Straße in einen Zuckerlladen. Sie trug einen großen Strauß Veilchen an der Brüst.
Das Treiben wurde beängstigend. Neuengierd tauchte im Gewühle unter. Er wollte auskosten, was solange sein Wunsch gewesen war. Da kam er zum Kohlmarkt. Vor der Auslage eines Modengeschäftes scharten sich die Menschen. Eine wie lebende Puppe bewegte sich im Kreise. Sie trug ein langes, mehrfach gerafftes, festliches Samtkleid und auf dem Kopf eine Haube aus weinroter Seide mit Bändern unter dem zierlichen Kinn gebunden.
Immer mehr besorgte Neuengierd, daß man ihn bald beachten mußte. Hier kam ein junger Mann in einem hellen Wams und ebensolchen Kniehosen, ein Barett auf dem Haupt und einen Degen an der Seite, wie sich ihn Neuengierd immer wünschte. Ihm mußte er entgehen. Er lief — aber niemand beachtete ihn — geradewegs in eine Prozession von festlichen Menschen. Die ersten voran trugen Fahnen mit bunten Bildern von Christus, Maria und den Heiligen. Sosehr Neuengierd anfänglich Mut gezeigt hatte, sosehr ergriff ihn langsam eine gewisse Beklommenheit. Kaum, daß er stehenbleiben und in den Himmel zu sehen wagte, es drängte ihn fort. Da stand er schon hinter den letzten Häusern. Wiesen und Getreidefelder dehnten sich vor ihm, obgleich er noch nicht weit vom Dom sein konnte. Über ihm schien ein klarer Sommerhimmel. Er erschien dem Knaben nicht anders, als er ihn immer erlebte. Nur der Boden war um ein paar Jahrhunderte gesunken. Auf ihm bewegte er sich nun. Niemand würde ihm das glauben, wenn er zurückkäme. Er mußte ein Zeugnis für die Zweifler mitbringen. Als er wieder in der Stadt war, sah er vor einem Laden ein Paar merkwürdiger Schuhe hängen, solche, die man — wie er zu wissen glaubte — längst nicht mehr trug. Ein Paar langer, spitzer, ohne Absätze, hingen da... und ohne viel zu überlegen, griff er nach ihnen. Doch sie i hielten fester, als er gedacht hatte, und als er daran riß, fiel der ganze Stand mit den Schuhen zusammen. Mit einem Paar in der Hand rannte er entsetzt davon. Aber bald hatte man ihn ereilt. Männer mit Helm und Säbel und einem grimmigen Schnauzbart unter der Nase hielten ihn fest. Er wollte zahlen, aber er hatte kein Geld. „Dann wird es den Kopf kosten“, sagte der eine. Neuengierd fiel weinend auf die Knie und bat, man möge ihn freilasssen. Aber man tat, als verstünde man ihn nicht.
Seine Sprache mußte wohl eine andere sein.
Nun, er verstand nur, daß für Diebe der Galgen bereit sei. Er wollte nicht auf den Galgen. Aber je mehr er seine Unschuld beteuerte, desto weniger verstand man ihn anscheinend. Menschen liefen herbei, und nun mußten sie auch seine absonderliche Kleidung bemerken. Neuengierd ließ die Schuhe fallen, und mit der Kraft eines plötzlichen rettenden Entschlusses entwand er sich der Hand des einen Stadtgardisten. Dann schlüpfte er durch die Menschenmenge und lief zum Dom. Dort mußte der Aufzug sein, der ihn wieder an die Oberfläche brachte.
Doch mit einemmal erschrak er. Sollte es am Ende nicht so einfach sein, wieder hinaufzukommen? Er würde die Tafel nicht finden. Der Vollmond schien noch nicht, und er mußte hier herunten bleiben, vielleicht viele Monate lang. Die Eltern würden ihn suchen — und nicht finden können.
Mühevoll stolperte er über die Kreuze des Friedhofs. Nun stand er am Fuß des Turms. Aber er sah keine Tafel, keinen Einstieg. Wenn er zurückblickte, gewahrte er seine Verfolger in weiter Ferne, so, als ob er durch ein umgekehrtes Fernrohr sehen würde. Er wollte weitereilen, aber seine Füße bewegten sich nicht vom Platz. So versuchte er, sich hinter einem Grabhügel zu verstecken. Während er aufsah, gewahrte er die Sonne sinken. Und ehe er sich noch verwundern konnte, war die Nacht angebrochen. Er fürchtete nur die Verfolger. Die Zähne schlugen ihm aneinander vor Angst. Würden die Toten nicht aufstehen? Er fühlte Hunger. Der Schweiß tropfte ihm von der Stirn. Wird er je wieder zur Höhe hinaufkommen? Er wollte auch auf ein seine Exkursion beweisendes Zeugnis verzichten.
Aber mit dem ersten Strahl des Mondes stand auch wieder eine Tafel hier, auf der die Worte standen: „Auffahrt in die Gegenwart.“ Wie ein Verschmachtender sank er auf den Boden des Aufzugs, und ehe er sich's versah, wurde er emporgehoben. Immer höher ging's. Ein kleiner Stoß. Er mußte die Erde der Gegenwart erreicht haben.
Da — er öffnete die Augen. Wo war er nur? Er lag in, seinem Bett, und der Mond schien ins Zimmer. Er fühlte noch Tränen an seinen Wangen, und im Zimmer nebenan schliefen die Eltern. Im Hemd, auf nackten Sohlen trat er an ihr Bett.
„Ach, Neuengierd, was hast du?“ fragten sie erschreckt.
Er schüttelte den Kopf.
„Was willst du jetzt wieder?“ Sie bangten um neue Wünsche ihres Sohnes. .
„Ich will nichts mehr , sagte er.
Sie verwunderten sich. „Nichts mehr? Gar keinen deiner unsinnigen, unmöglichen Wünsche mehr?“ Er wußte, sie waren nicht unsinnig und nicht unmöglich. Aber er verschwieg es.
Die Tränen kollerten ihm wieder aus den Augen. Und die Eltern weinten mit ihm, vor Freude über seine Wandlung.