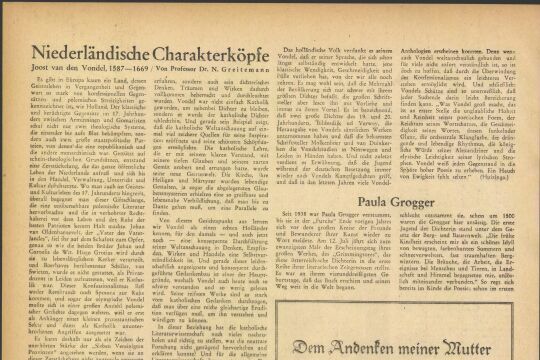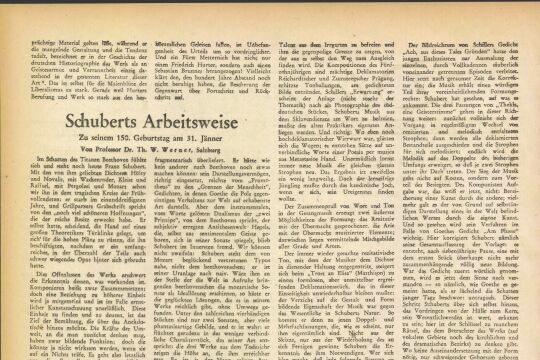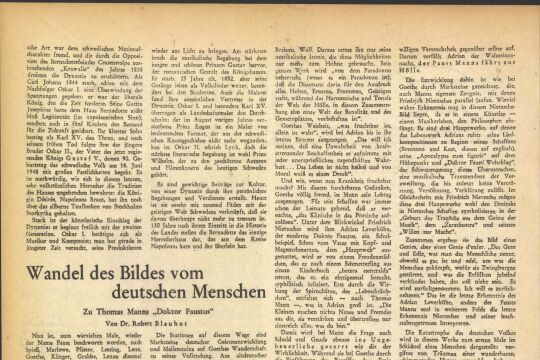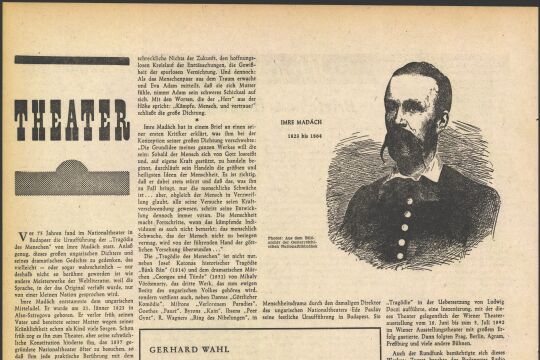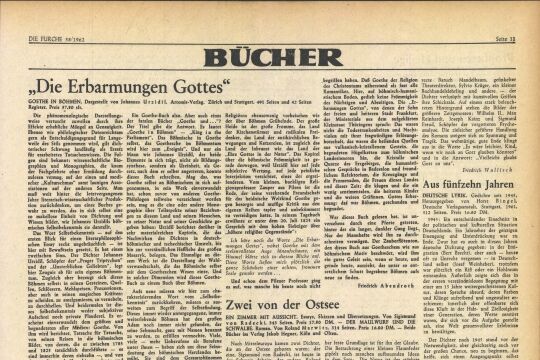In einer Zeit heftigster internationaler Spannungen rüstet sich die geistige Welt, Goethe zweihundertjährigen Geburtstag zu feiern. Leuchtend und unbestritten ragt seine Persönlichkeit weit über die Grenzen seiner Nation hinaus, einend erbittertste Widersacher der Gegenwart in Bewunderung seiner einmaligen Erscheinung.
Ähnlich verhielt es sich bereits vor einhundertzwanzig Jahren, da Fremde aus aller Herren Ländern, Wallfahrer der Kunst, nach Weimar kamen.
Niemals aber mögen sich zwei Welten so entschieden gegenübergestanden haben, als an jenem regnerischen 19. August des Jahres 1829, da der beinahe achtzigjährige Geheime Rat und wirkliche Minister Johann Wolfgang von Goethe im Empfangssalon seines Gartenhauses mit ausgesuchter Höflichkeit und Herzlichkeit auf den jungen, dreißigjährigen, aus seinem Lande aus politischen Gründen von fremden Machthabern vertriebenen Adam Mickiewicz zutrat und ihm die Hand drückte. Dem jungen Polen schlug das Herz heftig, da er nun vor seinem Idol stand.
Mit lebhaften Worten schildert Mickiewiczs Begleiter und getreuer Freund, Anton Eduard Odyniec, diese erste Begegnung — ebenso wie die später noch folgenden, in seinen ,Briefen von der Reise“, die übrigens, ein Menschenalter nach Goethes Tod, zum ersten Male in deutscher Sprache in Wien erschienen … „Sahst Du? Ich sah! — Hörtest Du? Ich hörte!“ schreibt er voll von sprühendem Enthusiasmus an seinen Freund Julian Korsak in Wilna. Und dann erzählt er mit liebevoller Genauigkeit von jeder Einzelheit über den Besuch bei Goethe, wie sie bei strömendem Regen in Frau Ottiliens bequemem Wagen zum Gartenhaus fuhren, an dessen Pforte sie ein alter Diener erwartete und sie über die sorgfältig gepflegten und bestreuten Wege des Gartens zu dem einstöckigen Hause geleitet wurden, in dessen Empfangssalon der Diener sie verließ. Während die beiden Freunde fast eine Viertelstunde warten mußten, betrachteten sie aufmerksam den Raum, in dem sie sich befanden. Sie entdeckten in einem Kamin, „der so reingekehrt war, als hätte niemals ein Feuer darin gebrannt", ein entzweigerissenes Papierblättchen, auf dem Mickiewicz die Handschrift Goethes erkannte; jene unvergeßliche Handschrift, die er schon einmal in einem Stammbuch der Frau Szymanowska gesehen hatte, jener großen polnischen Kla- viervirtuosin, deren seelenvolles Spiel Goethe oftmals in seinem Liebesschmerz um die junge Ulrike von Levetzow getröstet hatte.
Voller Ehrfurcht nahmen die beiden jungen Fremden die achtlos weggeworfenen Papierschnitzel an sich, um sie als kostbares Andenken aufzubewahren. Als dann Goethe endlich in den Raum eintrat, schauten sie ihn an wie eine übernatürliche Erscheinung, und Odyniec schreibt darüber: „Mir wurde heiß … und ohne Übertreibung, es ist etwas Jupiterhaftes an ihm! Der Wuchs hoch, die Gestalt kolossal,. das Antlitz würdig, imponierend, und dann die Stirne! — gerade dort ist die Jupiterhaftigkeit. Ohne Diadem strahlt sie von Majestät. Das Haar noch wenig weiß, ist nur über der Stirn etwas grau. Die Augen braun, klar, lebhaft, zeichnen sich noch durch eine Eigentümlichkeit aus, nämlich durch eine lichtgraue, wie emaillierte Linie, welche die Iris beider Augen am äußersten Rande rings umfaßt. Mickiewicz verglich sie mit dem Saturnusring. Wir sahen bisher bei niemand etwas Ähnliches. Wie ein Sonnenstrahl aus dem Gewölk verklärte ein wunderbar-liebliches, wohlwollendes Lächeln die Strenge dieser Physiognomie, als er schon beim Eintritt uns mit Verbeugung und Händedruck begrüßte und sprach: „Pardon, Messieurs, que je vous ai fait atten- dre! II rn’est träs agreable de voir les arnis de Mme Szymanowska, qui m’honore aussi de son amitif.“
Als sie sich dann gesetzt hatten, wandte sich Goethe an Mickiewicz und versicherte ihm, daß er wisse, daß er an der Spitze der neuen Richtung der polnischen Literatur stehe, die sich so stark den Ideen des Westens zuwende.
„Ich weiß es aus eigener Erfahrung“, fügte er hinzu, „was es für eine schwere Sache ist, gegen den Strom zu schwimmen."
Mickiewicz meinte: „Auch wir wissen es nach den Erfahrungen Eurer Exzellenz, wie große Genies die Strömung umlenken.“ Goethe nickte darauf ein wenig mit dem Kopfe, wie zum Zeichen, daß er das Kompliment herausgehört habe. Im weiteren Gespräch bedauerte er, daß er nur wenig von der polnischen Literatur kenne und keine der slawischen Sprachen verstehe, „mais l’homme a tant ä faire dans cette vie!" Er fügte jedoch gleich hinzu, daß er Mickiewicz schon aus mehreren Aufsätzen kenne und auch einen Abschnitt aus dessen jüngster Dichtung „Konrad Wallenrod“, den die Szymanowska an Goethe in deutscher Übersetzung geschickt hatte, gelesen habe. Auch einige Übertragungen des jungen Odyniec waren Goethe aus den „Leipziger Jahrbüchern" bekannt. Auf Goethes Wunsch schilderte nun Mickiewicz die Entwicklung der polnischen Literatur und tat dies, ihre einzelnen Epochen immer mit den historischen Geschehnissen verflechtend, mit solcher Anschaulichkeit, daß Goethe unverwandt seine Augen auf ihn gerichtet hielt und durch Zwischenfragen sein lebhaftes Interesse bekundete.
Im Laufe des Gesprächs kam man auch auf die Eigenarten des literarischen Ausdrucks der einzelnen Länder zu sprechen und Goethe meinte, daß bei dem immer deutlicher werdenden Streben nach großen und allgemeingültigen Wahrheiten die gesamte europäische Literatur einen einheitlicheren, sich gegenseitig angleichenden Charakter annehmen müsse. Mickiewicz verteidigte dagegen die Berechtigung des Nationalen in der Kunst, und Goethe mußte ihm auf Grund seiner überzeugenden Darlegungen zugestehen, daß die Kunst wohl immer bestimmter nationaler Eigenarten bedürfe, wenn sie echt wirken solle.
Am stärksten interessierte Goethe das Gebiet der Volkspoesie und des Volksliedes, und hier gab es so viele Fragen und Gegenfragen, daß sich das Gespräch noch über das ganze Mittagessen, das bei Frau Ottilie, Goethes Schwiegertochter, eingenommen wurde, erstreckte. Goethes weiter Geist und seine eminente Kenntnis der einzelnen Kulturen machten auf Mickiewicz einen solchen Eindruck, daß er, als sie das Gartenhaus verließen, spontan ausrief: „Wie, zum Teufel, gescheit ist der!“
Die gegenseitige Sympathie, die sich bei diesem ersten Besuch so deutlich gezeigt hatte, führte dazu, daß „aus dem kurzen Abstecher nach Weimar“ auf Goethes und Ottiliens Aufforderung hin ein längerer Aufenthalt wurde. Goethes Sohn, August, schloß sich ihnen an und Goethe ließ Mickiewicz für seine Sammlung von Bildnissen besonders interessanter Gäste porträtieren.
Je länger aber Mickiewicz in Weimar weilte, desto deutlicher wurde ihm auch die Kluft, die ihn von Goethe trennte. Ihm, ebenso wie seinem Freund Odyniec, war die abgeklärte Ruhe des Olympiers unvereinbar mit dem „Feuergeist", als den er Goethe bisher immer betrachtet hatte. Sie erschien ihnen als ein Mangel an Gefühl, als ein Sieg des Verstandes über das Herz, sie vermißten die hingebungsvolle Gläubigkeit, die ihnen außer ihrer Vaterlandsliebe als Wertvollstes und Teuerstes der Lebensgüter er-schien. Ja, Odyniec bricht einmal in die Worte aus, daß Mickiewicz doch wohl das Größere wolle. Mickiewicz selbst schweigt; er wagt nicht, Goethe offen zu widersprechen, in einem Innern aber ist er aufgewühlt. Er will Goethe verehren, zu ihm als Vorbild und Wegweiser aufblicken, denn dieser Mann war es ja, dessen Werke ihn tief in das innerste Reich der Dichtung geführt hatten, durch den er einen klassizistischen Formalismus überwunden hatte und sich offenen Herzens einer schwärmerischen Romantik ergab. Je länger er bei Goethe zu Gast ist, desto mehr sieht er seinen eigenen Weg, der sich von dem des großen Deutschen und Europäers trennt. Goethe wird für ihn zum Verfechter des Wortes: „Jede Nationaldichtung muß schal sein oder schal werden, die nicht auf dem Menschlich-Ersten ruht.“ So forderte also Goethe vom Dichter, sich vom rein Nationalen abzuwenden und über die engen Bande des Blutes und der Nation hinaus zum Künder und Sänger des Allgemein-Menschlichen zu werden. Mickiewicz will aber kein Thema außer dem Natio- len gelten lassen. Sein Volk ist verarmt, geknechtet, liegt am Boden und die Ungerechtigkeiten dort schreien zum Himmel, Tausende und aber Tausende seiner Brüder verkommen in Sibirien, andere müssen, wie er selbst, das Leben in der Fremde fristen, weil fremde Eindringlinge sich auf dem Boden des Vaterlandes festgesetzt haben. Wo ist hier eine Gerechtigkeit? Wie kann Gott dazu schweigen?
Sticht Goethes Faust die Wahrheit, sucht er den Ursprung alles Seins, damit er erkenne, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, so fordert Mickiewicz „Konrad“ vor Gottes Thron im III. Teil seiner „Totenfeier“, „Dziady“ die Herrschaft über die Seele der Menschen und das All: „MenscJi dem Gotte gleich!":
„Meister bin ich!
Ich, Meister, strecke die Hand aus!
Ich strecke sie über die Himmel hinaus und lege sie flach auf die Sterne, gleich wie auf gläserne Tasten der Feme.
Ich drehe die Sterne bald langsam, bald schnell, mein Geist läßt sie tönen, bald dunkel, bald hell.
Und jeden der Töne erkenn ich am Klingen, weil ich ihn erweckte selber zum Singen.
Ich trenne, verbinde, vereinige wieder, verschlinge die Töne in Strophen und Lieder dann aber verschütt’ ich sie achtlos wieder und laß sie zerstäubt zur Erde hernieder.“
So rechtet der überheblid Held KonraÜ, ein neuer Hiob, mit Gott, leidend für Millionen und duldend, aber kämpfend für die Menschenrechte und nicht für das Allgemein- Menschliche!
George Sand meinte einmal in einer Betrachtung über Goethe, Byron und Mickiewicz, daß deren in einem Jahrhundert der philosophischen Forschung entstandene Werke als „metaphysische Dramen“ bezeichnet werden müßten; bei Goethe herrsche der Skeptizismus vor, bei Byron die tiefe Verzweiflung, bei Mickiewicz jedoch eine erhabene, edle Wut und Empörung. Konrads Schrei zium Himmel sei die Stimme der ganzen unterdrückten Menschheit.
Mickiewicz hat niemals bestritten, daß der dritte Teil seines „Dziady“ in Anlehnung an den Faust entstand, dessen Aufführung anläßlich des achtzigsten Geburtstage Goethes einen mächtigen Eindruck in dem Polen hinterließ. Er wollte aber darüber hinaus, wollte über das Schicksal eines Einzelmenschen hinaus, in seinem Werk die Wiedergeburt von Volk und Menschheit durch Kampf um ein Recht und innere Läuterung zeigen.
Als Mickiewicz Weimar verließ, trennten sich die Wege dieser zwei Großen für immer. Goethe schritt ruhig, abgeklärt und ausgesöhnt, wissend um alle Freude und um allen Schmerz, seinen gewählten Weg weiter. Mickiewicz aber betrat den bitteren Pfad der Passion. Er hat Goethe nie vergessen, ja, er setzt sich immer stärker mit dessen Schaffen auseinander, und als er ein großes nationales Epos, den „Pan Ta- deusz“, niederzuschreiben beginnt, teilt er am 8. Dezember 1831 Odyniec darüber mit: „Ich dichte jetzt ein Werk in der Art von Hermann und Dorothea." Dieser „Pan Tadeusz", sein grandioses Meisterwerk, geschrieben in der Emigration, entstand aus der unbesiegbaren Sehnsucht nach der verlorenen Heimat. Als größter nationaler Dichter ging er damit in die Geschichte Polens ein. Gerade diesem Umstand aber, daß das nationale Kolorit in jedem Vers durchschimmert, ist es wohl zuzuschreiben, daß Mickiewicz’ Werk nicht die Weltgeltung besitzt, wie es die hohe Qualität seiner Dichtungen verlangen darf.
Goethe hat in seiner tiefen Geistesschau erfaßt, daß es noch etwas Höheres gibt, als Nation und Vaterland: das reine, edle Menschentum im Sinne seines Schöpfers!
Jeder Mensch und jedes Volk wird immer seine besonderen Eigenheiten zeigen und seine Eigenart behalten, aber diese dürfen niemals als trennende Klüfte sich zeigen, sondern müssen, in der Liebe zum Nächsten, zu einer an Farben und Spielarten reichen, höheren Weltordnung eingegliedert werden.
aus dem Gleichgewicht kam. Auh die Flügelreliefs des spätgotishen Waldzeller Hochaltars hat Shwanthaler, wie Gemälde gerahmt, erhalten Mehrnbah bei Ried.
Nun können wir die Überlieferung prüfen, die besagt, daß Thomas Shwanthaler auh Mihael Pahers Choraltar in St. Wolfgang am Abersee gerettet hat. Tatsahe ist: 1674 wurde in der Wallfahrtskirche durh altars der Pachers Werk verdrängt hätte, sondern eines Doppelaltars an Stelle des bisherigen Johannesaltars, der offenbar niht mehr erhaltungswürdig war. Offenbar hatte inzwishen Shwanthaler Abt Cölestin bestimmt, Pahers Altar zu schonen; ist dies richtig, so verdanken wir Schwanthalers Einsicht und stolzer Bescheidenheit sowohl das krö