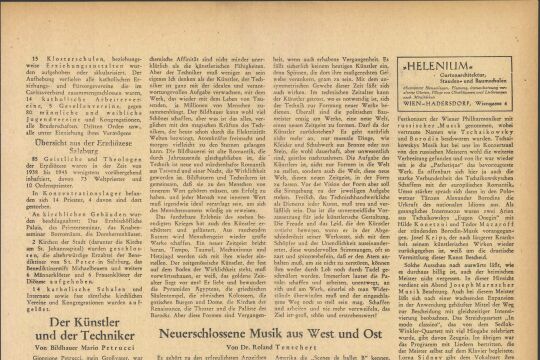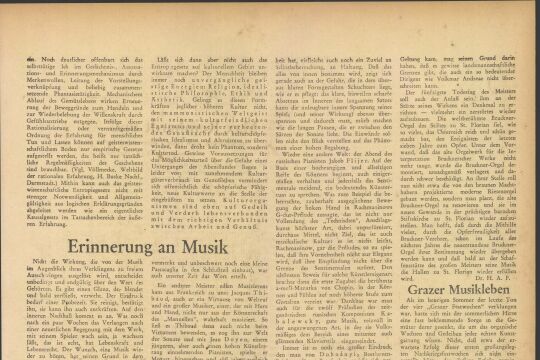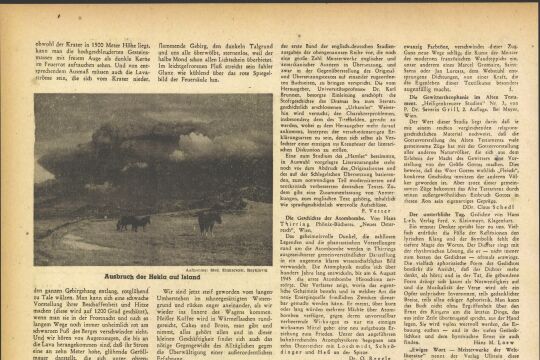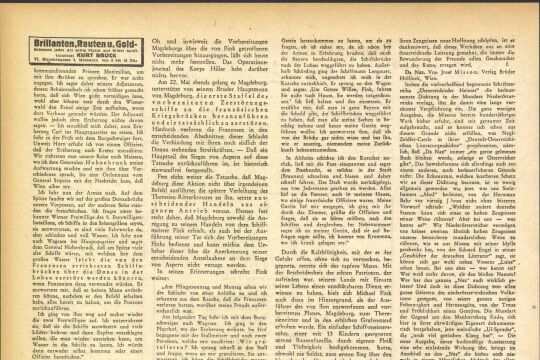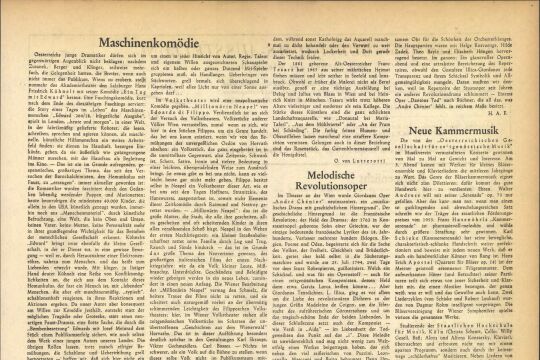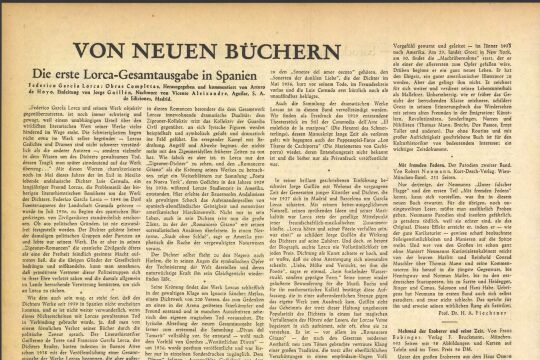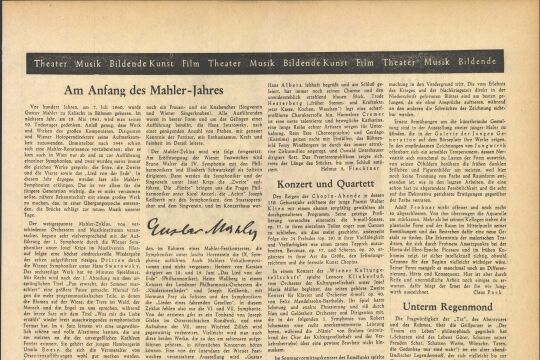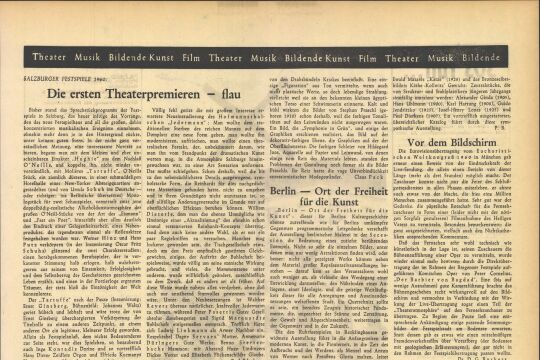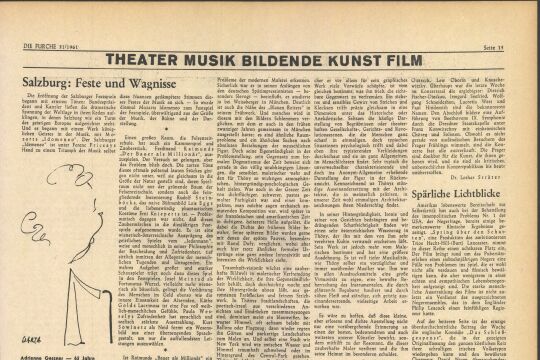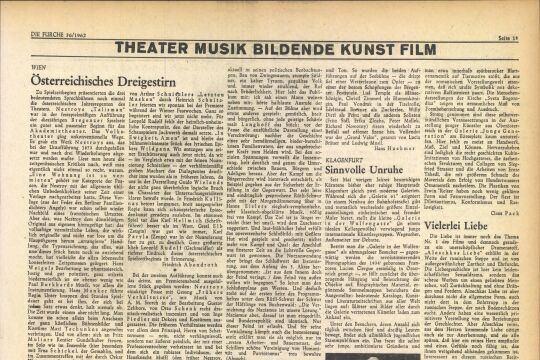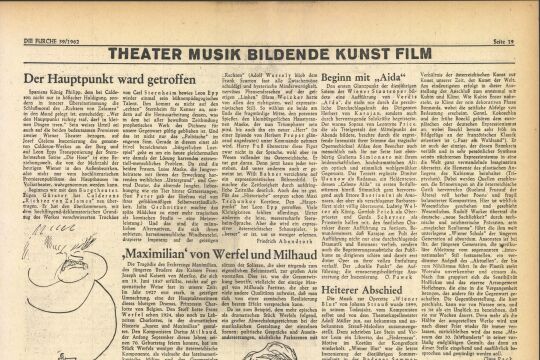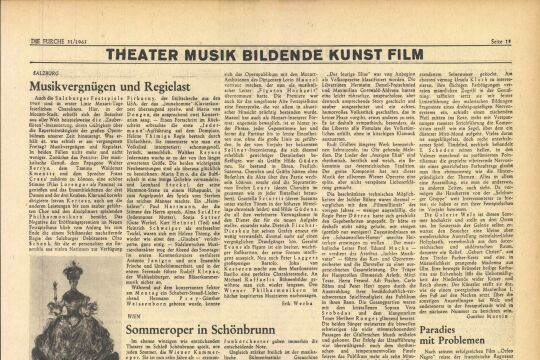Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gottes Liebes- und Zornwille
Zugegeben: Man schreckt, wenn im Volkstheater der Vorhang zu Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ aufgeht, zunächst einmal verblüfft zurück, wenn man das Bühnenbild (Georg S c h m i d) und die Kostüme (Maxi Tschunko) sieht. Was soll das für eine ausgefallene Regieidee sein: Shakespeare in das biedermeierlich-weltschmerzliche Italien der Restaurationsepoche verlegt und noch dazu mit Schubertschen Melodien, an einem der Höhepunkte sogar mit dem durch das „Dreimäderlhaus“ unrühmlich populär gewordenen Militärmarsch untermalt? Diesmal stammte das Konzept nicht einmal von Gustav M a n-k e r, dem immer Eigenwilligen, sondern wurde samt einer sehr weitgehenden Bearbeitung des Tieckschen Grundtextes schon bei den Salzburger Festspielen 1939 von Heinz Hilpert geschaffen.
Aber dann beginnt man sich das Ganze zu überlegen. Geistesgeschichtlich ist das gar nicht so abwegig und weit hergeholt. Shakespeare läßt diese köstliche Geschichte Ja auch nicht im überschäumenden Italien der Renaissance spielen, sondern im Königreich Sizilien seiner eigenen Zeit, des ausgehenden 16. Jahrhunderts, da die spanischen Vizekönige ein phantasielos-bürokratisches Regiment ausübten und die Italiener die politischen Sorgen und Aufregungen für ganze drei Jahrhunderte „aus dem Kopf“ hatten, in einer , halkyonischen“ Zeit sozusagen, da man sich ganz und gar auf die Gefühligkeiten und Amouren verlegen konnte, dieweil eine vertrottelte Obrigkeit dem Prinzip huldigte, Missetäter einfach durch Nichtbeachtung zu bestrafen. Der rostbraune Ocker gewisser frühbarocker Palazzi war der (vom Bühnenbild um eine Spur zu rötlich wiedergegebene) Grundton dieses Nachsommers, ähnlich dem Kaisergelb des Biedermeier.
Und siehe da: die Figuren fügten sich dergestalt in dieses Lebenselement, als sei es ihnen von Anfang an original gewesen: Da war Heinrich T r i m b u r, endlich einmal ein Benedikt ohne die neckischen Kraftmeiereien und „Hoho“-Töne, die einen sonst vergrämen, ein ungemein natürlicher und sympathischer Raunzer, eine Beatrice (Elfriede K u z m a n y), der man allerdings ein bißchen mehr an Kapricen gewünscht hätte, die dieses Fehlen aber durch sehr kluge, frauliche Überlegenheit wettmachte. Und dann gab es in der Hofgesellschaft einen Leonato (Egon Jordan gut und schwungvoll wie schon lange nicht), ein von der Regie etwas zu chargierter Antonio (Oskar W i 11 n e r in der Maske eines zornigen Toscanini), ein groteskes Schurkenterzett der Herren Prodinger, Stavjanik und Weik-k e r. Um vieles blässer die Herren Hend-richs und Höring, auch im Sprachlichen enttäuschend die Hero der Renate Bernhard. Die Glanzrollen der Gerichtsdiener wurden von Fritz M u 1 i a r (etwas zu „glänzend“ und in unmotiviertem Dauer-fortissimo) und Kurt Sowinetz (wie immer ziseliert durchgearbeitet) verkörpert. Man wurde von Akt zu Akt fröhlicher und nahm dank Mankers geschickt gesteigerter Regie die „Quinta Essentia“ der Shake-speareschen Lustspielwelt gleichsam mit allen Poren wahr. Jakob Böhme hätte sie den allerorten gegenwärtigen „feurigen Liebeswillen der Gottheit“ genannt.
Auch bei Strindberg gibt es vor allem in den späten Werken eine stete Präsenz Gottes. Aber es ist das andere Element, das Böhme den „finsteren Zornwillen“ genannt hat. Seine Gesellschaftsdramen haben nichts mit Sozialkritik, nichts mit der Entlarvung von Mißständen oder individuellen Sünden zu tun. Sie zeigen die prinzipielle und von Anfang an gegebene
Schuld und „Geworfertheit“ des Menschen, gegen die es kein ethisches Besserungsmittel aus eigener Kraft gibt. Sünde begeht nur der, der diese allgemeine Schuld für seinen Teil zu leugnen versucht und es unternimmt, den Richter zu spielen. Er verfällt dann Wahrhaft dem „zweiten Tode“. Strindberg zeigt mehr, als seine Zeitgenossen zu begreifen vermochten. Er macht das unterirdische Wurzelgeflecht einer Gesellschaft sichtbar, aus der es nur den Ausweg radikaler Entsühnung durch Dulden geben kann. Dieser Ausblick bleibt allerdings mattfarben. Der Schlußprospekt seiner „Gespenstersonate“ soll laut Regieanweisung Böcklins „Toteninsel“ sein, und die dazugehörige Musik soll nach dem Willen des Autors „angenehm-trau-ernden“ Charakter tragen. Das befolgte der Regisseur Veit Relin in seinem Ateliertheater allerdings nicht wörtlich. Denn er wollte ja kein zeitbefangenes Dokument der Theatergeschichte geben, sondern Strindbergs Genius in seiner Zeitlosigkeit beschwören. (Kein anderes Wiener Theater hatte sich im 50. Todesjahr des Vaters aller modernen Dramatik diese Aufgabe gestellt.) Vielleicht führte dies zu einer allzu feierlichen und pietätvollen Zelebration. Aber die Schauspieler, die eigentlich eher zu rezitieren hatten, waren dadurch in ihren gestalterischen Möglichkeiten wenigstens nicht überfordert. So kam ein runder, des Anlasses würdiger, literarischer Gesamteindruck zustande, an dem der sprecherisch ungemein gut weiterentwickelte Emanucl Schmied (der Alte) wie besonders Gerda S v e n-n e b y (Mumie) und Andreas Adams (der Student in Strindbergmaske) den Hauptanteil hatten. Konrad K u 1 k e s Bühnenbild löste die szenische Phantasieproblematik geschmackvoll, die Kostüme der Agnes Laurent brachten keine falsche Nuance in das einheitliche Bild. Keiner, der das Theater dieses Jahrhunderts an seinem Ursprung kennen lernen will, sollte diesen Abend versäumen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!