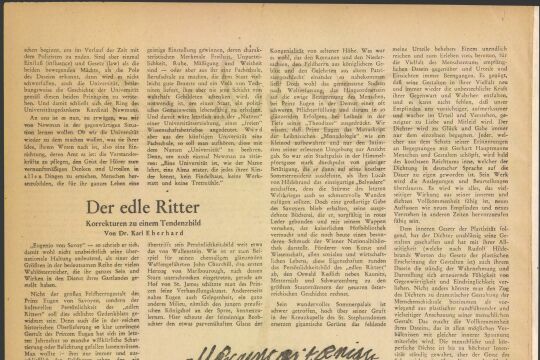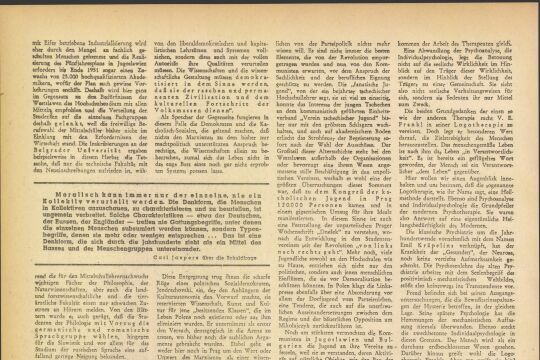Sollten wir ein Motto über das Gesamtwerk des Diditers Graham Greene setzen, so würden wir das Wort des heiligen Johannes wählen: „Gott ist größer als unser Herz.“ Denn dieses Werk ist eine unaufhörliche und oft geradezu atemraubende Auseinandersetzung mit eben jenem Wort — atemraubend schon deshalb, weil natürlich auch eine beständige Auseinandersetzung mit der Kleinheit, Enge und Furchtsamkeit unseres eigenen Herzens. Daß diese Auseinandersetzung nicht im theologischen oder moraltheologischen Raum stattfindet, sondern ausschließlich im dichterischen, macht das Werk Graham Greenes noch in einem weiteren Sinn zu einem atemraubenden Ereignis, denn es stößt mitten in die schwere Problematik hinein, die — wenigstens für den Katho- like i — um das Verhältnis Dichtung und Theologie, Dichtung und Moraltheologie gelagert ist. Es gibt keinen Dichter, der diese Problematik mit solcher Kühnheit zur Diskussion stellt wie Graham Greene. In ihm erscheint ein bisher unbekannter Typ des katholischen Dichters, oder — wie Greene es lieber hört — des Dichters, der katholisch ist. Mit der Unterscheidung dieser beiden Formulierungen ist bereits das Wesentliche gesagt: in der ersten steht das kirchliche Vorzeichen vor dem Dichter, in der zweiten fehlt es, obwohl der Dichter der katholischen Kirche angehört. Das bedeutet: Graham Greene nimmt für sich das Recht in Anspruch, als Dichter so souverän zu sein wie nur irgendein weltlicher Schriftsteller. Und in der Tat, kein Ungläubiger könnte die Welt ernster nehmen als er. Da ist die ganze Fülle der Abirrung, der grenzenlosen Gottesferne, des naiven und des perfiden Lasters, der irdischen, rein diesseitigen Gesinnung, die uns das Bild der heutigen Menschheit zeigt. Graham Greene gibt seinen Gestalten keineswegs den Frieden Christi mit auf den Weg oder läßt sie zu diesem Frieden gelangen, sondern sie bleiben, wie er selbst sagt, „bis zuletzt dieser Welt verhaftet und haben Teil an ihren Leidenschaften und Schwächen". Und dennodi nehmen sie auch an der Erlösung teil. Denn das Erstaunliche bei Graham Greene ist, daß dieser Dichter, der uns den Blick in keinen Abgrund menschlicher Verkommenheit erspart und uns auch nicht die leiseste Illusion gestattet, doch in der Lage ist, den Vorwurf, Pessimist zu sein, staunend, ja fast entrüstet zurückzuweisen. In einem sehr aufschlußreichen Tischgespräch mit französischen Geistlichen, das im Druck vorliegt, bekannt er sich zu einem überströmenden Optimismus, nur daß dieser seine Nahrung offensichtlich nicht vom Menschen her empfängt, sondern hier ist der Punkt, wo sich der Dichter Graham Greene als Christ erweist: die erstaunlichen Überraschungen trostvoller Art, die er uns in seiner Dichtung zumutet, fallen immer in dem Sinne, daß Gott eben größer ist als das menschliche Herz.
Aber sehen wir uns diese Diditung selbst an. Wir sagen Dichtung, sind uns aber bewußt, daß wir den Gedanken an alles, was man Poesie nennt, von vornherein ausschalten müssen. Schon die Sprache dieser Bücher zeigt die eigentümliche Entzauberung der modernen Welt, sie verhält sich zur Poesie wie die schonungslose Helle elektrisch beleuchteter Städte zum Mondlicht einer romantischen Landschaft. Aber inmitten der Trivialitä; ten und Nacktheiten dieser Dialoge erscheinen Worte von einer so bezwingenden Größe der Wahrhaftigkeit, daß sie fast wie Schönheit anmuten. Diese Schönheit, die eigentlich Wahrhaftigkeit ist, teilt sich, wie der Sprache, auch den Gestalten mit.
Da ist das im Mexiko der Kirchenverfolgung spielende Buch: „The Power and the Glory" mit dem letzten noch lebenden Priester seines Landes, von dem eine wohlerzogene Christenheit wünschen würde, daß er sich in asketischer Selbstheiligung und begeistertem Märtyrermut der Größe seiner Lage gewachsen zeigte. Und die Erfüllung dieses Wunsches, so könnte man meinen, würde auch einer christlichen Literatur wohl anstehen. Statt dessen erblicken wir einen in jeder Weise heruntergekommenen Menschen, vom Volke „der Schnapspriester" genannt, der sich ständig in Gesellschaft seiner Flasche befindet, feige für sein Leben bangt, und in dessen Dasein es so ziemlich alles gibt, was einer geistlichen Existenz zur Unehre gereicht. Und doch ist das priesterliche Gewissen das letzte, das in ihm vernichtet wird, oder vielmehr: es wird überhaupt nicht vernichtet. Ja, es ist fast, als wolle diese verkommene Gestalt uns geradezu die Unzerstörbarkeit der priesterlichen Weihen, wie die Kirche sie lehrt, vor Augen halten. Dieser armselige und unwürdige Geistliche ist — wenn es darauf ankommt — fähig, unter den schlimmsten und peinlichsten Gefängnisverhältnissen oder während einer im Pferdestall abgehaltenen Beichte sehr ungewöhnliche, aber bestürzend tiefe christliche Worte zu sagen. Ja es ergibt sich das Erschütternde, daß er an sich selbst staunend erfährt, wie ihn die eigene Unzulänglichkeit und Her- untergekommenheit erbarmender macht, aber freilich auch hellhöriger und verletzbarer gegenüber jenen falschen Tönen, deren sich oft gerade die sogenannten Frommen schuldig machen. Als ihn der
Verräter bittet, einem Sterbenden beizustehen, folgt er ihm gehorsam, wenn auch zitternd, obwohl er ahnt, daß man sein priesterliches Gewissen mißbraucht, um ihn in den Tod zu führen. Er erleidet denn auch diesen Tod, aber wiederum nicht so, wie unser eitles Verlangen es wünscht. Während in derselben Stadt fast zur selben Stunde eine fromme Frau ihren Kindern die erhebende Beschreibung eines triumphalen Märtyrertodes vorliest, wankt Graham Greenes armseliger Held von zwei Polizisten gestützt bebend der Wand zu, an der ihn die tödliche Kugel erreichen soll. Der Ruf: „Viva el Christo Rey", mit dem seine geistlichen Brüder starben, ist seiner Todesangst versagt. Zwei Welten tun sich auf die erhebende der frommen Täuschungen, der edlen Wünsche und Ansprüche, und die illusionslose, beschämende und doch menschlich so ergreifende Wirklichkeit. Dieser im Leben enttäuschende und im Sterben so elende Priester stirbt eben doch für sein heiliges Amt und ist der letzte Wächter seines Volkes gewesen: Gott bestätigt ihn als solchen — unmittelbar nach seinem Tode betritt der erste von draußen gesandte Priester den Böden Mexikos.
Noch gefährlicher, ja geradezu erschreckend gefährlich, geht es in dem Roman „The Heart of the Matter“ zu. Schon im ersten Teil der Dichtung wetterleuchtet es über den ganzen Himmel, wenn wir den Helden des Romans, den Polizeioffizier Scobie, vor der Leiche eines jungen Selbstmörders, an dessen Seelenheil der anwesende Priester verzweifelt, sagen hören: „Selbst die Kirche kann mich nicht lehren, daß Gott mit jungen Menschen kein Mitleid habe." Scobie spricht sich hier selbst unbewußt das Gnadenurteil „denn mit dem Maß, mit dem wir maßen, wird man uns wieder messen", heißt es im Evangelium. Scobie ahnt, als er jenes Wort spricht, noch nicht, daß sein eigenes Leben einmal durch Selbstmord enden wird — durch einen Selbstmord aus Gottesliebe, nachdem er zuvor einen Ehebruch aus Erbarmen begangen hat: man lese diese ungeheuerliche Konzeption bei Graham Greene nach und lehne sich getrost gegen sie auf — niemand wird ihre Bedenklichkeit leugnen, auch Greene leugnet sie nicht. In dem schon erwähnten französischen Tischgespräch gibt er zu, daß Mitleid ein Anlaß zu schwerer Sünde werden kann. Aber es kommt ihm nach seinem eigenen Wort als darstellender Dichter weniger auf die Sünde an als auf die Tiefe der Verlassenheit des Sünders, auf die furchtbare Ausweglosigkeit seiner Lage. Und wir dürfen hinzusetzen, es kommt ihm auch auf das Motiv der Sünde an. „Die Kirche kennt alle Gesetze“, sagt Pater Rank zu Mrs. Scobie, „aber sie weiß nicht, was im Herzen auch nur eines einzigen Menschen vorgeht." Selbst im sündig gewordenen Mitleid offenbart sich noch das Herz aller Dinge. „Denn", so heißt es wiederum in jenem Tischgespräch, „wer könnte seine Mitmenschen ohne Mitleid verstehen?" Scobie, dessen Erbarmen sich weder von seiner Gattin noch von seiner Geliebten zu trennen wagt, für den es aber auch Gott gegenüber unerbittlich heißt: „Ich liebe dich, ich kann dich nicht länger an deinem Altar betrügen", findet keinen anderen Ausweg als den von seiner Kirche verurteilten Tod durch eigene Hand. Aber dieses: „Ich liebe dich, Gott" bedeutet für Greene die Möglichkeit der Begnadigung. „Es mag vielleicht sonderbar klingen, wenn ein Mensch so sehr im Unrecht war", sagt Pater Rank zu der Witwe des Selbstmörders, „aber ich glaube ernstlich nach allem, was ich von ihm weiß, daß er Gott wahrhaft liebte."
Damit sind wir wieder zu dem Spannungsverhältnis zurückgekehrt, von dem wir im Eingang sprachen. Graham Greene würde der letzte sein, der es leugnet. Wenden wir uns also noch einmal an ihn selbst. In einem sehr kühlen, sehr freimütigen Brief an Elizabeth Bowen kommt er auf die Pflichten zu sprechen, die man von seiten der Gesellschaft dem Dichter auferlegt oder vielmehr auferlegen möchte, denn Graham Greene behauptet, der Dichter habe das Vorrecht, sich diesen Pflichten zu entziehen oder, wie er selbst sich ausdrückt, illoyal zu sein — ein Vorrecht, von dem er allerdings weiß, daß man es ihm nicht zugestehen will. So ist er sich vollkommen darüber klar, daß ihm selbst gerade als katholischer Dichter schwere Konflikte entstehen können. Wir brauchen über die Art dieser Konflikte kein Wort zu verlieren, da sie hinlänglich bekannt sind. Sie beruhen auf dem Mißverständnis, daß Dichtung zur Erbauung da sei, nachahmenswerte Vorbilder schaffen und — wofern sie sich auf christlich religiöse Probleme einläßt — die von der Moraltheologie vorgeschriebenen Gesetze vertreten und ihnen zum Sieg verhelfen müsse. Graham Greene zögert nicht mit der Anerkennung, daß diese Gesetze hohe und ehrwürdige sind, ja höhere und ehrwürdigere als die dichterischen, daß sie aber schlechterdings einem anderen Auftrag und einer anderen Seinssphäre angehören. Die Moraltheologie hat es mit dem Reich des Gehorsams zu tun, die Dichtung — wie alles Schöpferische — mit dem Reich der Freiheit. Wir meinen nicht die Willensfreiheit, sondern die Freiheit des Geistes und des Gewissens. Man nehme der Dichtung diese, und man schneidet einen Strom von seiner Quelle ab: freiheitslose Dichtung ist zur Ohnmacht verurteilt, Alle gelenkte Kunst zeigt eine eigentümliche Kraftlosigkeit, in ihren Erzeugnissen scheidet sich das Machwerk vom Kunstwerk. Nun aber gehört die Freiheit des Gewissens zum unveräußerlichen Besitz der katholischen Lehre —von dieser Seite her kann sie also auch dem Dichter unmöglich verweigert werden.
Von der grundsätzlichen Trennung der beiden Aufträge und Seinssphären her ergeben sich dann eine Reihe von weiteren Unterscheidungen. Hat es die Moral mit dem Allgemeingültigen zu tun, so die Dichtung mit dem Individuellen. Die Moral stellt Gesetze auf, die Dichtung stellt Menschen dar. Die Moral ist dem theoretischen Anspruch verpflichtet, die Dichtung dem Konkreten der Erscheinung. Sie hat ihre Wurzeln nicht im Seinsollenden, sondern im tatsächlich Seienden, also im Menschlichen mit all seiner Unzulänglichkeit. Kurz, sie hat es mit dem Leben selbst zu tun, nicht mit der Anweisung zum Leben — das Leben ist immer ein mehr oder weniger irrationales. Das weiß auch im Grunde niemand so gut wie der Moraltheolöge, steht er doch in seiner praktischen Arbeit genau so der Relativität der Erscheinungen gegenüber wie der Dichter. Trotzdem sind seine Forderungen an diesen durchaus verständlich, und zwar nicht nur von der Würde seines eigenen Auftrags her. Denn Dichtung bedeutet selbst im Zeitalter kulturellen Verfalls noch eine große suggestive Macht über das menschliche Gemüt, die man sich aus guten Gründen zu erzieherischen Zwecken verpflichten möchte. Aber dieser Wunsch beruht auf einem Trugschluß, denn Dichtung übt ja ihre Macht gerade dadurch aus, daß es ihr nicht um den Triumph der Gesetze geht, aber freilich auch nicht um die Auflockerung der Gesetze, sondern um Auflockerung des menschlichen Gemüts. Dichtung wirbt nicht um Anerkennung der Moral, sie wirbt um ein erschüttertes Herz, sie wirbt um das Zerbrechen unserer richterlichen Selbstgerechtigkeit. Wenn die Fragestellung der Moral auf „Entweder-Oder“ lautet, also auf „Schuldig oder Unschuldig", so lautet die berühmte Formel des Dichterischen „Schuldig-Unschuldig". Auf ihrer schon für die griechische Dichtung konstitutiven und seither durch die Jahrhunderte lückenlosen Gültigkeit beruht jedes große dichterische Kunstwerk. Ohne sie gibt es weder einen dramatischen Helden noch einen Romanhelden großen Stils, ein jeder ist zugleich ein Schuldiger vor der Moral und ein Unschuldiger vor seinem eigenen psychologischen Gesetz und den Mächten seines Schicksals. Auf dieser Doppelsicht beruht dia Erschütterungsmacht der dichterischen Aussage — gerade der schwebende Zustand ihrer Aspekte bedeutet den Zauber ihrer Lebensnähe Und Unmittelbarkeit.
Und dennoch gibt es ein erzieherisches Moment, dem die Dichtung zu dienen vermag, allein es liegt in einer ganz anderen Richtung als der geforderten. In seinem schon erwähnten Brief an Elizabeth Bowen legt Graham Greene den katholischen Schriftstellern nah, sich den großen Kardinal Newman zu ihrem Schutzpatron zu wählen, denn dieser hat über das Verhältnis Dichtung und Moral sehr aufschlußreiche Äußerungen hinterlassen. Unwillkürlich fragt man sich angesichts ihrer, wie es möglich ist, daß noch in unseren Tagen über den strittigen Punkt Zweifel und groteske Irrtümjer entstehen konnten. „Es ist ein .Widerspruch in sich’", sagt der Kardinal, „über sündige Menschen eine von Sünden freie Literatur zusammenstellen zu wollen. Man kann vielleicht etwas sehr Herrliches Zusammentragen, aber wenn man es recht besieht, zeigt es sich, daß es überhaupt keine Dichtung ist."
Aber, so wird man ohne Zweifel einwenden, der Stein des Anstoßes liegt ja gar nicht nur darin, daß der Dichter es mit der Darstellung der sündigen Welt ernst nimmt. Viel bedenklicher ist es, wenn er den Sünder in jenem schon erwähnten Zwielicht beläßt, wenn dieser bis zuletzt in jenes Zwielicht eingetaucht bleibt und wenn er trotz dieses Zwielichts gerettet werden und andere retten kann, wie wir es bei dem armen Schnapspriester und dem Selbstmörder Scobie gesehen haben. Und es ist wahr, Graham Greene geht hier noch weit über den großen Kardinal hinaus. Er hat eine Bresche in viel tiefer liegende Bedenken und Widerstände geschlagen als jener, eine Bresche, die sich schwerlich wieder schließen wird. Er hat dies vermocht, nicht etwa, weil die Großartigkeit und Kühnheit seiner Konzeption die Gegner überwunden hätte — diese Gegner sind nicht zu überwinden,
denn sie haben ja von ihrem Standpunkt aus vollkommen recht. Er hat es vielmehr vermocht, weil die Zeit dafür reif geworden ist.
Wir stehen heute, darüber kann sich kein offenes Auge täuschen, dem vollen Zusammenbruch der sogenannten bürgerlichen Moral gegenüber, und es erweist sich, daß man diese weithin für die christliche gehalten hat. Dies ist aber ein Irrtum. Wir sagen nichts gegen die bürgerliche Moral, gut, es bedarf der Ordnung — o wie sehr bedarf es ihrer! Wir sagen lediglich, daß sie nicht mit der christlichen Moral identisch ist. Jene ist eine Moral der Gerechten im Reiche dieser Welt, für die christliche Moral aber gilt das Wort von den Zöllnern und Sündern, die dem Reiche Gottes näher sind als sie. Nun, auch dem Dichter sind Sie näher: Dichtung hat eine unwiderstehliche Neigung, sich der Fragwürdigen, der Angefochtenen, ja der tragisch Gescheiterten anzunehmen — unangefochtene, moralisch geglückte Existenzen haben für sie nur geringe Anziehungskraft. An diesem Punkt wird das eigentümliche Paradox des Dichterischen klar, aber ist es nicht zugleich das Paradox des Christlichen? Fällt es hicht zusammen mit eben jenem Wort von den Zöllnern und Sündern, die dem Reich Gottes näher sind als die Gerechten? Allein, wer ist denn nun eigentlich gerecht, und wer gehört zu den Zöllnern und Sündern? In einer gewissen Tiefenschau erscheint auch der Pharisäer nur als ein armer Sünder, ja wahrscheinlich als der ärmste von allen. Diese Anerkennung sind wir Graham Greene schuldig, denn er fordert Sympathie auch mit dem Gegner, eine Sympathie, die sein Werk tat sächlich aufbringt — man denke nur an die Gestalt des Leutnants, der die letzte Erdennacht des armen Schnapspriesters bewacht. In einem Brief an V. S. Pritchett, dessen bedeutsame Aussagen dem Brief an Elizabeth Bowen ebenbürtig sind, erklärt er es noch einmal für die erste Pflicht des Dichters, illoyal zu sein — illoyal heißt für Greene soviel wie frei sein. Galt es in jenem Brief mehr den Konflikt mit der kirchlichen Moral, so geht es hier um den Konflikt mit den Forderungen des Staates und der weltlichen Gesellschaft. Der loyale Dichter, so führt Greene aus, darf weder Verständnis noch Sympathie für den Andersdenkenden haben, also kann der Dichter nicht loyal sein, er muß für jedes Geschöpf Sympathie fodern — ein Geschöpf, das keinerlei Sympathie erweckt, ist dichterisch mißlungen. Man sieht, hier wird nicht nur im Werk des Dichters, hier wird auch im Dichter selbst „das Herz aller Dinge“ sichtbar. Und hier ist auch der Punkt, wo die Zeit für den Dichter Greene reif geworden ist, denn was fehlt denn nun eigentlich dieser Zeit, und welcher Mangel unterscheidet sie von allen anderen Zeiten? Ist es nicht ganz einfach der, daß das Herz gestorben ist, und zwar bis tief in die Reihen derer hinein, die für die christlich Frommen gelten? Ja, vielleicht liegt gerade bei diesen der eigentümlich tote Punkt der heutigen Welt, denn soweit unsere Augen reichen, ist Liebe das einzige schöpferische Prinzip, das wir kennen. Und von wem, wenn nicht von den Christen, sollte denn die Neuerschaffung unserer alt gewordenen Welt ausgehen?
Aus Graham Greene: „Vom Paradox des Christentums.“ Verlag der Arche, Zürich 1952