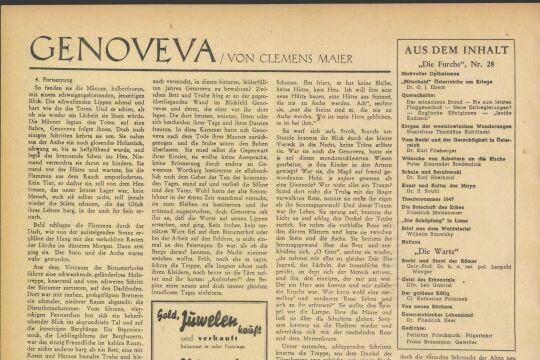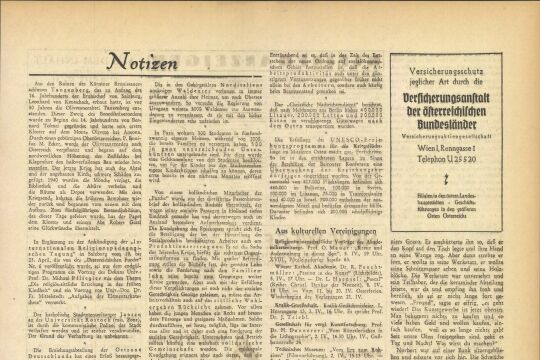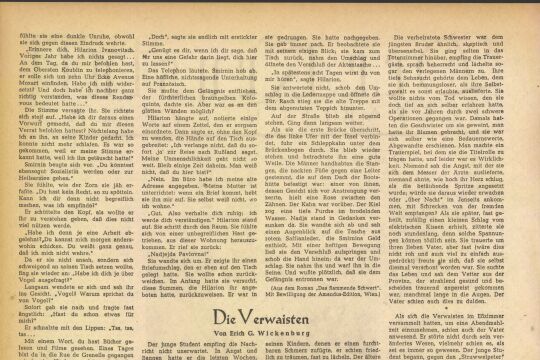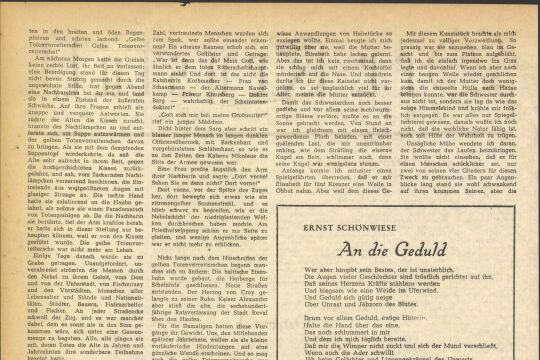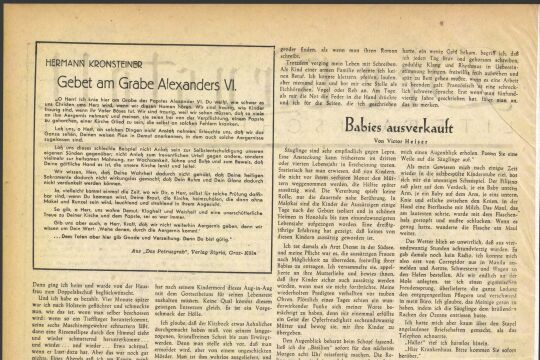Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Großer Bahnhof” der Nächstenliebe
AUF EINEM BAHNHOF IN ÖSTERREICH. Menschen ziehen zwischen den Steinquadern und Marmorplatten des Kolossalbaues wie dunkle Schwaden hin und scheinen zu warten. Sie warten, aber es fährt für diese Gestalten kein Zug, es ist für sie noch kein Fahrplan geschrieben, und es zeigt ihnen keine Uhr die Stunde an, von der sie sagen könnten, es sei die ihre.
Sie sind alle Menschen, obgleich viele, die an ihnen vorübergehen, sie nicht für solche halten. Abgerissen, schmutzig, betrunken, unrasiert und hohlwangig warten diese Zeitlosen am Tage auf die Nacht und in der Nacht auf den Tag. Es heißt oft, sie seien Trinker, Diebe, Vagabunden oder Dirnen. Selten hat es je gewißen, sie seien Menschen, denn sie verhalten sich sonderbar: sie liegen auf den Bänken der Wartesäle, betten ihren wilden Haarschopf auf die harten Platten der Tische und kümmern sich nicht um Zigarettenasche, sie lehnen an den Theken und halten ihre letzten Groschen hin für Schnaps, sie kauern in finsteren, verstaubten Winkeln, und ihre Hände ruhen auf dem schmutz des Pflasters.
Keiner unter ihnen kennt ein Daheim. Nicht jeder ist ein schlechter Kerl. Viele sind ohne eigene Schuld in diese schmutzigen Winkel des Bahnhofes abgedrängt worden. Die meisten unter ihnen aber sind froh, einen solchen Bahnhof gefunden zu haben, denn wenn für sie auch kein Zug geht, so gibt es in einem der Seitentrakte des großen Gebäudes für diese Menschen das Wunder einer Türe, die ihnen offensteht. Und noch dazu eine für diese Leute ungewöhnliche Türe: eine Türe, hinter der Menschen darauf warten, helfen zu können.
HIER FRAGT MAN NICHT, warum Menschen in Not geraten sind. Die Bahnhofsmission der Caritas fragt nur, ob das der Fall ist, und wenn ja, dann hilft sie auf ihre eigenartige, die müden Herzen der Ausgestoßenen wunderbar belebende Weise. Meist versehen Frauen diesen schweren Dienst der Missionstätigkeit auf den Bahnhöfen. Mehr und besser als Männer verstehen sie die menschlichen Unzulänglichkeiten. Schwester Johanna von der- Bahnhofsmission Linz ist eine dieser Frauen. Wir haben sie besucht. Wenn wir hier „Schwester Johanna” schreiben, dann meinen wir aber nicht nur sie, sondern auch all die anderen nimmermüden Schwestern der österreichischen Bahnhofsmissionen.
EINE ZWANZIGJÄHRIGE STAND EINES ÄBENDS bald in den düsteren Winkeln des Bahnhofes, bald schlich sie scheu und verzagt durch das grelle Licht der Neonlampen. Früh schon hatte sie einen Burschen kennengelernt, der an all ihrem Elend schuld war. Er hatte sie tu Diebstählen verleitet und zur Hehlerin gemacht. Sie war verurteilt worden. Ihr Entschluß stand fest. Sie wartete nur und starrte auf die Schienen und lauschte, denn sie wollte ihn nur hören, nicht sehen.
Um diese Stunde machte Schwester Johanna ihren Streifzug durch das Bahnhofsgelände. Sie schritt auf die Zwanzigjährige zu und faßte sie am Arm. Sie blickte dabei in ein blasses, eingefallenes Gesicht, in Augen, die fiebrig glänzten, aber tot waren, ausdruckslos und müde. „Lassen Sie mich los”, sagte das Mädchen leise, „meine Geschichte geht Sie nichts an.” Schwester Johanna aber konnte nicht loslassen, denn sie hatte zwei Lichter aus der Nacht über den Schienen auftauchen sehen. Sie riß das Mädchen von der Bahnsteigkante weg, und in der nächsten Sekunde donnerte der Rot-Weiß-Kurier über den Stahl der Schienen.
Was dann geschah, kam über das Mädchen wie ein Traum. Die Caritas nahm sich der Lebensmüden an und zeigte ihr zwei Wege: den einen in die Sphäre ungeteilter Liebe und Güte durch die Allmacht, den anderen in die Welt der Pflichterfüllung und Beständigkeit. Das Mädchen beschritt beide Wege und konnte sich so dem Bannkreis des verbrecherischen Jugendfreundes entziehen. Das war vor Jahren. Heute ist das Mädchen verheiratet, genießt das Glück zweier gesunder Kinder und kann Schwester Johanna nicht mehr vergessen, denn sie hatte ihr das zum Beginn eines neuen Lebens gemacht, was das Mädchen für ihr Ende gehalten hatte.
SCHWESTER JOHANNA SAGT aus ihrer reichen Erfahrung: „Es kommt immer darauf an, daß Menschen, wenn sie allein und in Not ge raten sind, nicht allein und nicht der Not überlassen bleiben. Man muß im richtigen Augenblick zu ihnen finden und ihnen mit Trost und guten Werken über die schwersten Depressionen hinweghelfen. Das zu tun, ist unsere Aufgabe. Es gibt daher Situationen, in denen menschliche Kraft allein das nicht mehr zuwege brächte, was notwendig ist, um andere vor dem sicheren Untergang zu gewahren.” Schwester Johanna begann ihre Tätigkeit für die Hilfebedürftigen im Rahmen der katholischen Mädchenschutzorganisation. Diese Organisation zieht sich hin über alle katholischen Länder und steht jungen Mädchen zur Verfügung, die in der Fremde allein und hilflos sind. Arbeitsplätze, Unterkünfte, Reisegelder, Auskünfte und gute Ratschläge vermittelt diese Organisation den jungen Mädchen und nimmt sich ihrer an, wenn sie enttäuscht oder gar auf die schiefe Bahn gelockt worden sind.
DA KAM EINES TAGES EIN MÄDCHEN zu Schwester Johanna. Es war vom Land in die Stadt gekommen, um Haushaltsarbeiten; zu verrichten. Es wollte anständig bleiben und sich nützlich erweisen. Aber der Herr des Hauses, der Vater jener Kinder, die sie betreuen sollte, der Mann jener Frau, der sie ergeben sein sollte, bedrängte sie brutal und niederträchtig. Er war nachts in ihre Kammer gekommen und hatte sich nicht abweisen lassen. Das Mädchen ging, suchte Hilfe und fand Schwester Johanna. Eine Organisation vermittelte eine neue Aufgabe. Ein neues Leben begann.
ABER AUCH JUNGE BURSCHEN UND MÄNNER erleiden genau so Schiffbruch. Da war zum Beispiel ein junger Bursch, der schon zum drittenmal bei Schwester Johanna angeklopft und um Brot gebeten hatte. Die Schwester gab ihm wieder Brot und heiße Suppe. Er aß an dem sauberen Tisch der Station und löffelte mit Heißhunger die Suppe. „Wo wohnen Sie denn jetzt?” fragte die Schwester.. Er deutete nach oben und meinte: „Droben wohn’ ich schon seit ein paar Tag’. Wo soll ich sonst hin? Da hab ich meinen Koffer und mfeine Klamotten unter die Stiege g’haut und leg mich drauf.” „Ich werde Ihnen helfen”, sagte sie. Er blickte staunend von der Suppe auf. „So?” fragte er, „es wär’ ja recht freundlich, aber ich hab’ wenig Hoffnung. Bis jetzt hat niemand was übrig g’habt für mich. Tät’ mich wundern, wenn’s auf einmal anders wäre.” Die Schwester Johanna erklärte ihm: „Es wird jetzt’anders werden. Es wird Ihr Elend ein Ende nehmen, aber Sie müssen mithelfen und auf Gott vertrauen.” Da horchte der junge Bursche auf, und dann sagte er langsam und gedehnt. „Gott?” Eine Weile blieb es still, dann sagte er: „Auf Gott soll ich vertrauen? Das tät’ ich gerne, aber ich will Ihnen etwas sagen, Schwester: für mich hat es noch nie einen Gott gegeben, der sich nur ein bisserl anschaun hätt’ lassen. Für mich hat der Herrgott net einmal a Platzerl übrig gehabt bis jetzt.”
Er stand auf, packte sein Bündel, klemmte es unter den Arm, und wollte hinaus. Aber da sah Schwester Johanna, daß in seinen Augen Tränen standen, und sie ahnte, was geschehen würde, wenn sie diesen jungen Kerl auch diese Nacht seinem Schicksal überließe. Sie hielt ihn fest und ließ ihn nicht fort.
Noch in derselben Nacht kam er ins Caritas- haus und fand hier viele hilfreiche Menschen, die plötzlich wetteiferten, seinem Leben einen Sinn zu geben. Wenige Tage später bekam der Bursche einen Arbeitsplatz und durfte ordentlich wohnen. Es dauerte auch nicht mehr lange, da hatte er am eigenen Leibe erfahren, daß es einen Sinn hatte, auf Gott zu vertrauen. Er kam nicht wieder auf den Bahnhof. Schwester Johanna aber weiß, daß er ordentlich geblieben ist, einer geregelten Arbeit nachgeht und seine in Lumpen gehüllte Vergangenheit mit den alten Zeitungsfetzen für immer in den Kanal geworfen hat.
‘
OB ES DER VÖEST-ARBEITER WAR, der seine Fahrkarte verloren hatte und kein Geld mehr besaß, eine neue zu kaufen, dem die Bahnhofsmission aber einen Fahrschein zur Verfügung stellte, die entlassenen Häftlinge einer Strafanstalt, die kein Geld hatten und von der Bahnhofsmission verpflegt wurden, der alte Mann mit den rheumatischen Gliedern, der aus dem Krankenhaus entlassen wurde und kein Zuhause wußte, von der Bahnhofsmission aber aufgelesen und karitativer Betreuung’ zugeführt wurde, ob es jener Tuberkulosekranke war, den seine Notlage zum Dieb gemacht hatte, der aber im Schoße der Caritas ein neues Leben beginnen und sogar auf Genesung hoffen durfte. Sie alle und noch viel mehr sind in den Hallen und Gängen der Bahnhöfe aufgelesen worden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!