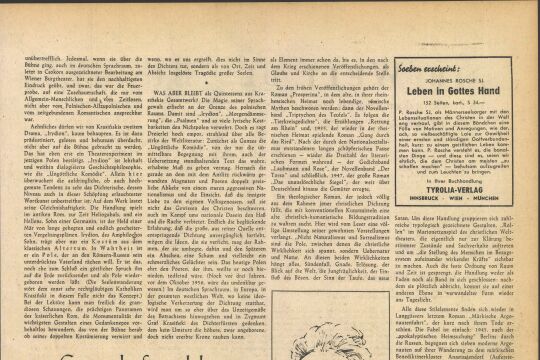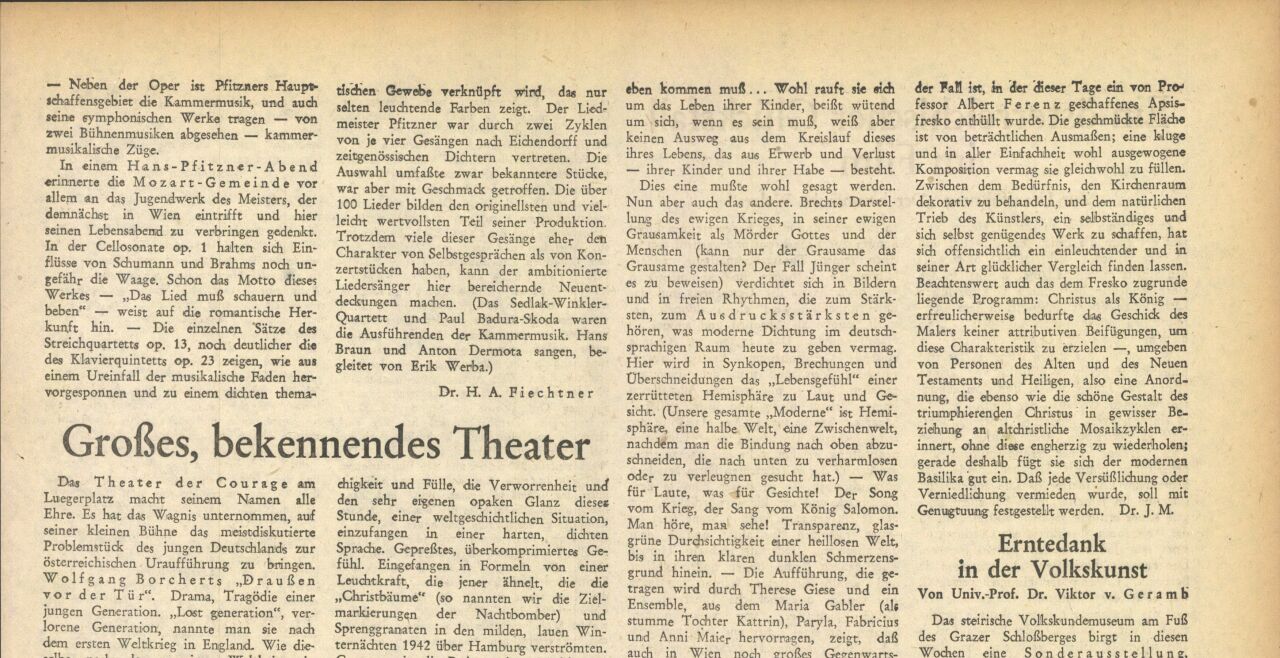
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Großes, bekennendes Theater
Das Theater der Courage am Luegerplatz macht seinem Namen alle Ehre. Es hat das Wagnis unternommen, auf seiner kleinen Bühne das meistdiskutierte Problemstück des jungen Deutschlands zur österreichischen Uraufführung zu bringen. Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tü r”. Drama, Tragödie einer jungen Generation. „Lost generation”, verlorene Generation, nannte man sie nach dem ersten Weltkrieg in England. Wie dieselbe nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland aussieht, zeigt Leben und W’ferk des Dichters. Hohes Symbol ihrer Einheit: Wolfgang Borchert stirbt, fünfundzwanzigjährig, einen Tag vor der Uraufführung seines Werkes in Hamburg, an Tuberkulose, nachdem er im Gefängnis und auf den Schlachtfeldern des Dritten Reiches seine Jugend „verlebt” und einige Erzählungen, Entwürfe, Fragmente geschrieben hat. Der 25jährige Unteroffizier Beckmann, Held und Träger seines Stückes, erlebt die Welt in der Situation des „Draußen vor der Tür”. Was Heidegger als Hineingehangensein in die „Sorge” pathetischsüffisant, was Jaspers als Grenzsituation und Typos gelehrt-geruhsam, was Sartre gerissen-genüßlich in seinen Dramen ausbeutet, hier ist es nackte, zerschunden Wirklichkeit eines grauen Gegenwartstages.
Ein Mensch, ein Geschlecht kehrt heim. Aus Sibirien, aus der Gefangenschaft, und findet keine Aufnahme mehr. Der Oberst, „der sehr lustig ist”, der Kunstdirektor, „der mutig sein möchte, aber dann doch lieber feige ist”, Frau Kramer, „die weiter nichts ist als Frau Kramer, und das ist gerade so furchtbar” …
Militär und Finanz, Kunstbetrieb und kommerzielle Geistverwaltung, eine „gute Gesellschaft” und das Proletsein der Seele — sie alle vereinigen sich in geschlossenem Widerstand gegen den „Neuen”, den Jungen, den Anfänger, der nichts hat als seine „Arbeitskraft” und der nichts kann als sein Herz ausschütten — immer wieder ausschütten und immer wieder anbieten… in einer schüchternen Erklärung, einem wilden Schrei, stumm, verstummend, mit beiden Händen.
Dies ist noch nicht das Schlimmste. Das Furchtbare fängt erst in der Begegnung mit den stärksten Mächten des Himmels und der Erde an: in der Begegnung mit Gott und der Liebe. Beide offenbaren sich’ Beckmann, Borchert, dieser jungen, ortlosen Generation in jener letzten Schwachheit, die nur das Kreuz verstehen, begreifen, erfassen kann. Die Liebe kommt zu dem Jungen mit der Gasmaskenbrille, der eben erst einen Selbstmordversuch unternahm, in der Gestalt eines Mädchens, „dessen Mann auf einem Bein nach Hause kam”. Am Tod dieses Mannes, „der tausend Nächte von ihr träumte”, wird Beckmann unschuldigschuldig; er, dessen Eltern den Gasschlauch nahmen, dessen einjähriges Kind im Bomberischutt Hamburgs begraben liegt, dessen eigene Frau einen anderen fand. Auch hier also keine Rast, keine Ruhstatt. — Auf der Straße, auf der Straße dieses Lebens bleibt Beckmann, bleibt eine Generation liegen. Vorbei geht der „neue Mensch” und der alte Adam. Ja, er ist es selbst, Adam, der Urvater der Menschheit, klagend über das Schicksal seiner Söhne. Adam, der Gott gespielt hat, in vieltausendjährigen Aufständen zu und gegen Gott, und der immer noch eiä neues Spiel versucht…
Borchert, der junge Deutsche aus der Hitlerzeit, hat, wie wir erfahren, Thomas Wolfe, Faulkner, Hemingway gelesen. Und hat, dazu, sein eigenes Leben gelebt. Das Ergebnis: ein Zeitstil, dem es (zumal in Borcherts Erzählungen) gelingt, die Brüchigkeit und Fülle, die Verworrenheit und den sehr eigenen opaken Glanz dieses Stunde, einer weltgeschichtlichen Situation, einzufangen in einer harten, dichten Sprache. Gepreßtes, überkomprimiertes Gefühl. Eingefangen in Formeln von einer Leuchtkraft, die jener ähnelt, die die „Christbäume” (so nannten wir die Ziel- markierungęn der Nachtbomber) und Sprenggranaten in den milden, lauen Winternächten 1942 über Hamburg verströmten. Granaten, in die Ruinen einer Nachkriegsweit geworfen. — In seinem Drama macht Borchert von dieser seiner eigentümlichsten Begabung manchmal zu schüchternen Gebrauch — und redet deshalb noch zu viel. Das Theater der Courage hat mutig gekürzt, es hätte, im letzten Drittel, noch etwas einsparen können, um die Kraft, die der Zuschauer benötigt, um durchzuhalten, nicht völlig aufzubrauchen. Trotz allem: eine sehr starke, echte Leistung, beglückend für den Kritiker, der gezwungen ist, die Halbheiten und Haltungslosigkeiten der Wiener Bühnen allabendlich zu besehen. Eine Leistung, die bewegt, die mitreißt und erschüttert — bis auf einige Momente, in der die Hochtonigkeit der Erregung eine Art Lähmung und Erstarrung bewirkt. —- Joseph Hendrichs, als Unteroffizier Beckmann, lebt das Leben dieses so oft verfluchten, so schwer begnadeten Geschlechts. Mit ihm steht ein Ensemble, das sein Bestes gibt. Ergreifend, stark, wie bereits in Freibergs „Weltwirtshaus”, Elisabeth Stemberger. — Unser Dank gebührt auch August Rieger, der Regie führt, und Max Meinecke, dem Bühnenbildner, der den weiten Weg von der Burg nicht gescheut hat, um hier dem Theater und dem Kulturleben zu geben, was beiden not tut: die Echtheit gültiger Zeichen.
Zu den stärksten Erlebnissen, die Wiens Theater zu mitteln vermögen, muß Bertold Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder” in der Scala gezählt werden. Hier ist also ein Hauptteil des Zürcher Stadttheaters nach Wien übersiedelt, beziehungsweise rückgesiedelt: Therese Giese, Paryla, Heinz, Otto, Lindt- berg. Und sie können sich wahrlich sehen lassen, so wie’ vor zwei Jahren, als sie im Gastspiel in der Josefstadt mit demselben Stück Zürich in Wien vertraten. Das Zusammenwirken von Regie, Schauspielkunst, Dichtung und Musik (letztere von Paul Burkhard und Hans Eisler) erstellt einen Stil, der Brecht angemessen ist. — So schwach dieses Stück ideologisch ist, so stark ist es in einzelnen dichterischen Episoden. Brecht zeigt sich hier als anarchischer Individualist von einer Grausamkeit und barbarischen Linearität, die durch Schicksal und Sälde, durch die bald bunten, bald dunklen Wolken, die über Glück, Glas und Würfelspiel des Menschlich-Allzumenschlichen hängen, nur selten milder getönt erscheinen. Fanatismus eines atheistischen Kalvinisten.
Diese Mutter Courage, die als Marketenderin im Dreißigjährigen Krieg durch Deutschland zieht (letzte Tochter der Land- störtzerin Kurasche des großen Grimmelshausen), diese Frau, die ihre Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, so nach und nach dem hungrigen Kriegswolf in den Rachen werfen muß, ist selbst wölfischen Geblüts. Der Instinkt, ein wilder, zugleich sehr „sachlicher” Instinkt der Selbsterhaltung,’ treibt sie durchs Leben, durch das in Kriegswehen versinkende Europa, immer im Gefolge ihres einzigen Herrn und Gottes: des Krieges und seiner Wirklichkeit! — Frau Courage ist „Realistin” in einer erzenen Monumentalität. Dienstbar allen Freuden und Schrecknissen ihres dem Krieg hörigen Lebens. Ihr Standpunkt: es kommt, wie es eben kommen muß… Wohl rauft sie sich um das Leben ihrer Kinder, beißt wütend um sich, wenn es sein muß, weiß aber keinen Ausweg aus dem Kreislauf dieses ihres Lebens, das au Erwerb und Verlust — ihrer Kinder und ihrer Habe — besteht.
Dies eine mußte wohl gesagt werden. Nun aber auch das andere. Brechts Darstellung des ewigen Krieges, in seiner ewigen Grausamkeit als Mörder Gottes und der Menschen (kann nur der Grausame das Grausame gestalten? Der Fall Jünger scheint es zu beweisen) verdichtet sich in Bildern und in freien Rhythmen, die zum Stärksten, zum Ausdrucksstarksten gehören, was moderne Dichtung im deutschsprachigen Raum heute zu geben vermag. Hier wird in Synkopen, Brechungen und Überschneidungen das „Lebensgefühl” einer zerrütteten Hemisphäre zu Laut und Gesicht. (Unsere gesamte „Moderne” ist Hemisphäre, eine halbe Welt, eine Zwischenwelt, nachdem man die Bindung nach oben abzuschneiden, die nach unten zu verharmlosen oder zu verleugnen gesucht hat.) — Was für Laute, was für Gesichte! Der Song vom Krieg, der Sang vom König Salomon. Man höre, man sehe! Transparenz, glasgrüne Durchsichtigkeit einer heillosen Welt, bis in ihren klaren dunklen Schmerzensgrund hinein. — Die Aufführung, die getragen wird durch Therese Giese und ein Ensemble, aus dem Maria Gabler (als stumme Tochter Kattrin), Paryla, Fabricius und Anni Maier hervorragen, zeigt, daß auch in Wien noch großes Gegenwartstheater möglich ist. Wir hoffen, daß sie als Ansporn und Mahnung von den anderen Bühnen gewürdigt wird.
Das Renaissancetheater hat als Vorweihnachtspremiere Dario Nicodemis „Scampolo”, das alte Schlagerlustspiel, gewählt. Das Spiel um die urwüchsige Heiterkeit eines einfältig-klugen Menschenkindes. Das Mädchen Scampolo, der Fratz aus Roms Elendsvierteln, lebt, aus der Kraft seines frischen Herzens, in jener seligen Armut, die den letzten und liebsten Kindern Gottes zu allen guten Zeiten eigen war. Was kümmert es der falsche Anstand und klügelnd rednerische Verstand der scheinbürgerlichen Welt, in die es so unversehens mit seinem Wäschekorb hineinstolpert? Für dieses Mädchen gibt es keine Hindernisse — siegessicher findet es mit Hilfe seines sehr gesunden inneren Sinns und des sehr gutwilligen Autor den Weg zum Happy-End. — Geraldine Katt, seit Jahren dieser Leibrolle verschworen, führt auch in der Renaissancebühne das Stück zum Erfolg.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!