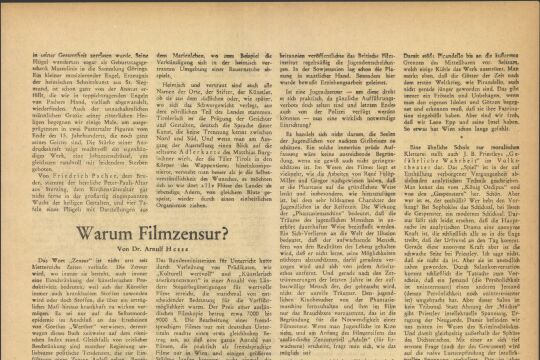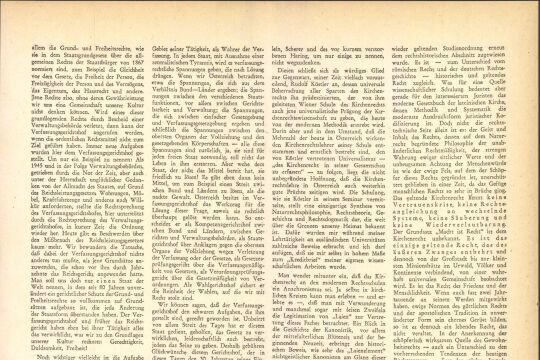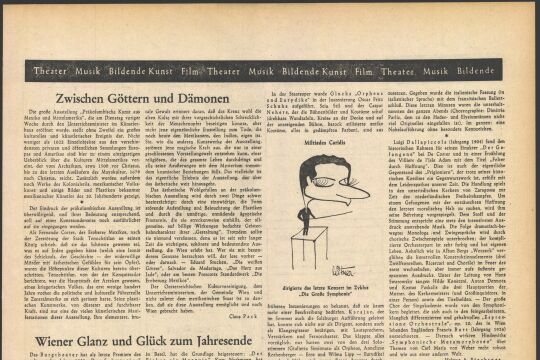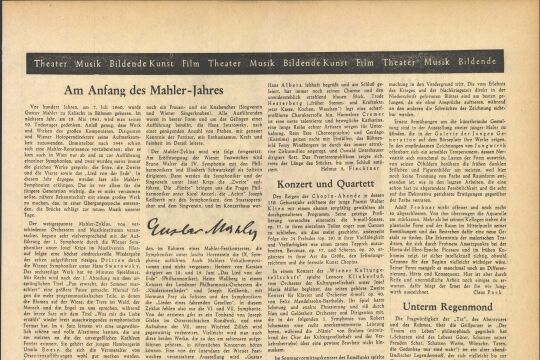Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Guter Weia in den Kellern
Die Wiener Kellertheater haben derzeit gute Kost anzubieten. Da ist zunächst das Theater am P a r k r i n g, das den „Guten Wein des Herrn Nuche“ von Paul Willems aufs Programm gesetzt hat. Der gute Wein befindet sich in einer Flasche im Medikamentenschrank, auf die Herr Nuche, ein reicher Kaufmann, vorsorglicherweise „Gift“ geschrieben hat, damit er ihm allein bleibt. Aber Martin, der Knecht, der in Isabella, die Tochter des Hauses, verliebt ist, trinkt aus Liebeskummer daraui und schwankt dann auf den Friedhof, weil er ja nun „tot“ ist. Und er hat noch manche Abenteuer zu bestehen, bis ihn der Frühling und zwei Landstreicher endgültig kurieren und er heimfindet zu Isabella und den Kühen im Stall. Der Frühling allein hätte das nicht geschafft, sosehr ihn auch Paul Willems, ein Französisch schreibender Komödiendichter aus Handern (wir lernen ihn in einer deutschen Uebertragung von Carl Werckshagen kennen), liebt und besingt; ohne die lustigen Einfälle der Landstreicher wäre es nicht gegangen. Diese, die unkomplizierten Zwillingsbrüder von Didi und Gogo aus „Warten auf Godot“, machen das Stück erst zu dem, was es ist; einer scharmanten und amüsanten Angelegenheit; ihr Augenzwinkern und ihre „Land-Streiche“, ihre Grazie und ihre Lebensweisheit machen aus dem Leben einer flandrischen Kleinstadt eine Vagabundenkomödie, leicht und doch nicht ganz gewichtslos, duftig und doch nicht ohne verborgene Gefahren .. . Erst aus der Vogelperspektive, aus der wir das alles betrachten dürfen, läßt es sich ganz genießen. Und der Astronom, der uns diese Einblicke durch sein Fernrohr, das er lieber auf die erleuchteten Fenster und die Frühlingswiesen als auf die Sterne richtet, gewährt, weiß das und ist dem Spiel ein guter Anwalt und Dolmetsch. Otto Schenk hat eine köstliche Aufführung zustande gebracht, die uns vergessen läßt, das nicht alles Schwalben sind, was der Frühling bringt, und nicht alles Gold, was blumenreich dahergeredet wird. In Kurt Müller, dem Astronomen, Hilde Nerber, der Haustochter, und den beiden Landstreichern, Robert Werner und Fritz Holzer, hat er hervorragende Schauspieler zur Verfügung, die verlocken, ihrem Treiben ein zweites Mal zuzusehen.
Das Kleine Theater im Konzerthaus Spielt „Die Zwillinge von Venedig“, eine Veroneser Komödie von Carlo G o 1 d o n i, die Regisseur Otto A. Eder nach einer Bearbeitung von Heubel (1756) für das Kleine Theater eingerichtet hat. Das Theater hat sich in Goldonis Rokokokomödien selbständig gemacht; seine Grundelemente spielen allein; Intrigen und Verwechslungen, Harlekinaden und Liebeswerbcn, Maskierung und Entlarvung haben ihren Reigen; Zufälle werden zu Pointen, und Darsteller und Kulissen, Säbel und Gewänder spielen mit. Das ist handfestes Theater, wenn auch kultivierter und weniger derb als die alte Commedia dell'arte. Die Hauptrolle schrieb Goldoni für einen Schauspieler seines Theaters, S. Angelo in Venedig, in dem Zanetto, der dumme, und Tonio, der kluge Zwilling, ihre Verkörperung fanden. Dessen Verwandlungen, die oft in atemberaubendem Tempo geschehen müssen, sind eine Hauptattraktion des Abends. Die übrigen Gestalten holte sich Goldoni von überall her aus der Weltliteratur — nicht zuletzt auch aus dem eigenen Werk —, wie er sie gerade für sein Ensemble brauchte. Otto Eders Inszenierung hat Theatergeist; Kurt jaggberg als Zwillingsbruder seiner selbst leistet Erstaunliches, und Franziska Kalmar und Maria Groiß, die er — einmal in der einen, einmal in der anderen Rolle— umwirbt, können seine heißen Bemühungen verständlich machen; daneben hält sich Joe Trümmer als Arlecchino am besten. Robert Hofer-Ach stellte ein reizend-bewegliches Bühnenbild bei.
Die Tribüne spielt die „M e d e a“ von Franz Theodor C s o k o r. Csokor hat seine Medea „post-bellica“ genannt, um anzudeuten, daß wir hier eine neue Medea vor uns haben. Aber jede Medea ist notwendigerweise eine Nachkriegsgestalt. Diesmal ist es der zweite Weltkrieg, der vorübergegangen ist. Und in das Leben Peters ( = Jasons) tritt eine neue Frau, deren Haut unverbraucht duftet, weil sie kein Schicksal hatte. Und er will Anna (= Medea) verlassen, weil sie ihn immer an die Zeit des Krieges, an die Front und das Partisanenschicksal, an die Nachte im Graben erinnert. Und wieder erfüllt sich das Schicksal Medeas, die verlassen wird und das Leben tötet, das sie gab. (Hier ist es noch ungeboren.) Csokor glaubt, daß wir heute schon von einem „Medea-Komplex“ sprechen dürfen: denn alle Flauen, die durch den Krieg gegangen sind, sei es nun mit der Resistance oder im Fronteinsatz, die das Töten oder doch die Beihilfe zum Töten zu ihrer Arbeit machten, scheinen das verloren zu haben, was die Frau in ihnen ausmachte; sie bleiben weiter „im Dienst“, bleiben weiter Soldat, auch wenn sie jetzt andere Aufgaben zu erfüllen haben; sie können sich nicht mehr umstellen, können nicht ganz heimfinden. So muß Jason seine Medea fliehen; Csokor macht das verständlich, aber er entschuldigt es nicht. Freilich ist seine Dora, deren behüteter Schicksallosigkeit Peter verfällt, keine Frau, für die man irgendeine andere verläßt; sie ist so unbedeutend, daß das Jason-Problem am unrichtigen
Objekt dargestellt erscheint. Csokors Medet-Stück spielt auf dem Boden Griechenlands; aber manche Parallele zur antiken Trogödie bleibt äußerlich, Die Sprache Csokors ist wuchtig, männlich, eindringlich. Sie hätte bessere Interpreten verdient, als sie in der lieblosen Inszenierung Gandolf Buschbecks hatte, in der nur das Bühnenbild entsprach. Daß der antike Chor durch eine Schallplatte ersetzt wurde, kann nur als Groteske empfunden werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!