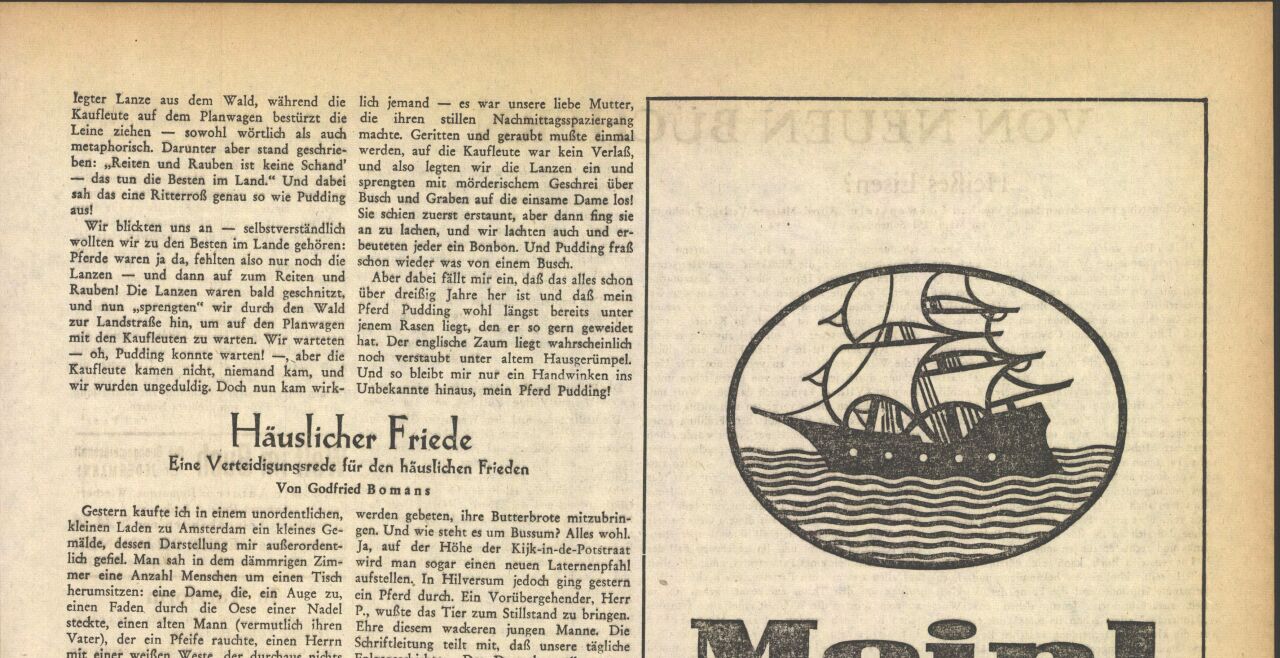
Gestern kaufte ich in einem unordentlichen, kleinen Laden zu Amsterdam ein kleines Gemälde, dessen Darstellung mir außerordentlich gefiel. Man sah in dem dämmrigen Zimmer eine Anzahl Menschen um einen Tisch herumsitzen: eine Dame, die, ein Auge zu, einen Faden durch die Oese einer Nadel steckte, einen alten Mann (vermutlich ihren Vater), der ein Pfeife rauchte, einen Herrn mit einer weißen Weste, der durchaus nichts tat und ein kleines Kind, das, den Kopf vornüber in den Armen, in Schlaf gefallen war. Durch das geöffnete Fenster sah man einen blühend aussehenden Herrn hineinschauen, dessen rechter Arm mit gestrecktem Zeigefinger auf die kleine Gruppe um den Tisch herum zeigte, dabei dem Betrachter des kleinen Gemäldes gerade in die Augen sehend, als wolle er sagen: alles recht und schön, aber d i e s e s ist nun, was ich Gemütlichkeit nenne. Der Maler hatte seine Absichten noch verdeutlicht mit der Unterschrift: „Häuslicher Friede.“
Aus verschiedenen Gründen sagte diese Vorstellung mir zu. Erstens des Preises wegen. Denn 1 Gulden 50 ist billig für eine Abbildung so tief sinnbildlicher Bedeutung. Weiter weil es so abscheulich schlecht gemalt war. Wir können durch ein Gemälde bewegt werden, entweder weil es besonders gut gemalt wurde oder weil es einen so aufrechten Dilettantismus zeigt, daß es wieder schön wird. Kinder malen so. Weiter fand ich in dem zeigenden Herrn einen überraschenden Fund. Wiewohl er selbst auf dem Gemälde stand und also mit in die Vorstellung hineinbezogen war, distanzierte er sich von der Szene, indem er nachdrücklich darauf zeigte. Er gab damit zu erkennen, er wisse ganz gut, daß es ein Gemälde sei. In dieser Weise schuf er ein Gemälde in einem. Gemälde, eine Art picturaler, zweiter Potenz. Schließlich war ich auch mit seiner Auffassung einverstanden. Diese Art schläfrige Gemütlichkeit ksnn man nur im Familienverband erreichen. Das Glikksgefühl, beisammen zu sein, gewinnt dann eine Intensität, die betäubend auf die Sinne wirken kann. Aber der wichtigste Grund, warum ich das k'eine Gemälde kaufte, war die Hinter-seite. Denn daran hatte einer vor vielen Jahren eine Zeitung geklebt! Es war eine ganze Seite der „Gooische B^zuin“ aus dem Jahre 1885. Herrliche Lektüre!
»
Mein erster Eindruck war, daß überhaupt nichts darin stehe. Es gab keine den Atem versetzenden Schlagzeilen, keine alarmierenden Entrefilets, keine erschütternden Mitteilungen über Aufstände auf dem Balkan, Unruhen in Rußland, Drohungen in Aegypten oder Streiks in Frankreich. Auch erteilte man keine Mitteilungen über das, was der Präsident der USA gestern gesagt habe, noch über das, was er vielleicht morgen sagen werde.
Man erfreute dafür den Leser mit der Nachricht, daß in Laren ein Zwilling geboren sei. Der Mutter (Frau E. Beerkens-Bijlstra) ergehe es unter Umständen ziemlich gut. Herr Beerkens (Inhaber der Kneipe auf dem Dorfplatz) antwortete auf die diesbezügliche Frage unseres Berichterstatters, er habe nicht damit gerechnet, aber er freue sich, wo sie einmal da seien, sehr darüber. Herr L. Grib-belbeen, dortiger Gewürzhändler, erwäge, seine Fassade zu verbreitern. Gewißheit hierüber sei nicht zu bekommen. Fräulein A. Rol-vink, ebenfalls in Laren, werde morgen 95 Jahre alt. Sie lese noch ohne Brille,, auch die kleinen Buchstaben. Möge dieser Tag nicht unbemerkt vorübergehen. Und was ist in Huizen geschehen? Du lieber Himmel, es ist da ein Kalb mit drei Beinen geboren. Besichtigung zwei Pfennig. Auch werde Gesamtvergnügen Sonntags von 11 bis 2 im Freien Lohengrin blasen. Die aktiven Mitglieder werden gebeten, ihre Butterbrote mitzubringen. Und wie steht es um Bussum? Alles wohl. Ja, auf der Höhe der Kijk-in-de-Potstraat wird man sogar einen neuen Laternenpfahl aufstellen. In Hilversum jedoch ging gestern ein Pferd durch. Ein Vorübergehender, Herr P., wußte das Tier zum Stillstand zu bringen. Ehre diesem wackeren jungen Manne. Die Schriftleitung teilt mit, daß unsere tägliche Folgegeschichte: „Der Doppelmann“ morgen enden und daß hierauf „Ritter Hugo“ erscheinen werde, eine fesselnde und zugleich lehrreiche Episode aus dem frühen Mittelalter.
Sieh, das finde ich nun eine nette Zeitung. Betrachten wir sie mal. Vorerst ist es eine richtige Lokalausgabe. Machen Sie sich nichts vor, das kennen wir nicht mehr. Wir kennen nur Landeszeitungen. Gewiß, daneben gibt es auch Ortszeitungen, die sich aber von den Landeszeitungen nur darin unterscheiden, daß sie mit den Nachrichten 24 Stunden zurückbleiben. An die echte „couleur locale“ wagt sich keine Schriftleitung mehr heran. Man hat Angst, für geistig minderwertig, für provinziell gehalten zu werden. Welch ein heilloser Irrtum! Denn tatsächlich ist die Geburt eines Zwillings zu Laren für die Ortsinsassen von unendlich größerer Wichtigkeit, als was Herr Bidault in der französischen Kammer gesagt hat. Im all“?—einen übrigens bin ich der Meinung, daß die Geburt eines Kindes, geschweige denn von zwei, bedeutsamer ist als die Worte Bidaults. Denn die hat man morgen vergessen. Zwillinge aber bleiben.
Der Wert einer Nachricht wird nicht an erster Stelle vom Umfang des betreffenden Ereignisses bestimmt, sondern vom Maße, womit wir zu diesem Ereignis in persönlicher Beziehung stehen. Daß der Yang-Ping-Ho wieder austrat und 56 Dörfer mit Mann und Maus verschlang, ist für einen Krämer in Amers-foort eigentlich, streng genommen, indifferent. Er weiß nämlich durchaus nicht, wo er den Yang-Ping-Ho irgendwo suchen soll. Aber lass' ihn lesen, daß Unholde den städtischen Geldschrank heute nacht wegschafften, so wird man ihn aufspringen sehen und aus seinem Hause rennen. Denn der Amersfoor-ter Geldschrank befindet sich drei Straßen weiter. Und sieh, er ist nicht mehr da. Eine leere Stelle. Abscheulich.
Es hat keinen Sinn, Tag für Tag die Menschen mit einer Lawine von Nachrichten aus allen Ecken des Erdballs zu überströmen. Sag mir nun mal: was nützt es einem Zimmermann in Baarn, wenn er einen ausführlichen Bericht über die Absichten des Herrn Peron, Präsidenten von Argentinien, liest? Oder über den Etat Frankreichs? Oder über das Räuberwesen in Griechenland? Oder über die Absichten des Herrn Franco? All diese Dinge liegen nicht nur weit außerhalb seines täglichen Interesses, doch er entbehrt auch völlig der Kenntnis der örtlichen Lage, diese Berichte auch nur einigermaßen auf ihren Wert prüfen zu können. Ballast! Zeitverlust! Und vor allem: Verflachung des Geistes. Denn das tägliche Insichaufnehmen einer unendlichen Verschiedenheit an nackten Tatsachen, die in keiner einzigen Weise mit deinem Beruf, deiner Umwelt oder Natur zusammenhängen, erzeugt nichts anderes als ein kritikloses Absorptionsvermögen.
Aber es gibt etwas anderes. Und das ist der Ton, in dem man unsere Tagesblättter ibfaßt. Dieser Ton wird täglich alarmierender. Wir berühren hier einen sehr ernsten Punkt. Millionen Menschen, die, wenn wir ihre Verhältnisse tatsächlich betrachten, eigentlich in Ruhe und Zufriedenheit würden leben können, werden Tag für Tag aufgeschreckt durch die Konfrontation, in glühenden Schlagzeilen, mit den fürchterlichsten Möglichkeiten, mit blutstockenden Perspektiven, den Atem versetzenden Prophezeiungen und den beunruhigendsten Wahrscheinlichkeiten.
Noch hat man die Kriegsgefahr abgewanck, so lesen wir Dienstag morgens beim Frühstück, aber es war in der allerletzten Minute. Kaum haben wir uns von dem Schreck erholt, patsch!, da lesen wir Mittwoch, daß Rußland zehn Atombomben pro Tag herstellt. Donnerstag tischt ein „sachverständiger Mitarbeiter“ uns eine Betrachtung auf, die die Wirkung einer Atombombe beschreibt. Freitag lesen wir, daß es in Berlin wieder zu Zwischenfällen gekommen ist. Glaubst du, daß Herr P. Beerkens zu Laren (einer der Zwillinge, der 1885 so froh bewillkommnet wurde) noch Lust hat, Samstag einen neuen Kaninchenstall zu bauen? Oder daß er auf die Glasveranda eine neue Zinkplatte legen läßt? Es wird meine Zeit schon dauern, denkt er. Morgen liegt alles vielleicht in Trümmern. Glaubst du, daß Gribbelbeen, Sohn des alten, seine Fassade wird verbreitern lassen? Er ist wohl klüger. Das alles hat ja keinen Sinn.
Und jetzt die Söhne Herrn Beerkens und Herrn Gribbelbeens. Das sind schlaue Burschen, die die Augen am rechten Platz haben. Die wandern aus. Recht haben sie. Um Europa ist es doch geschehen? In Kanada, in Südamerika, in Transvaal, da fangen sie ein neues Leben an. Dort ist Arbeit, dort ist Zukunft. Dort wird das ganze Land nicht dem Erdboden gleichgemacht, dorthin kommen die Russen nicht, dort wollen wir mal sehen lassen, was wir können. Es geht nicht darum, ob sie wirklich fortziehen. Es gibt Devisenschwierigkeiten, Einwanderungshindernisse, Verbotsbestimmungen. Dadurch bleibt Beerkens und bleibt Gribbelbeen in Holland. Aber wie? Grollend, verlangend, unruhig und meistens in einer einstweiligen Stelle, bei der Rationierung oder im braven Beamtentum, als Sprungbrett für später. Der Wunschtraum ist: hinaus! Zehntausende junger Menschen gehen mit diesem Gedanken umher: hinaus! Fort von hier! Alles stürzt ein!
Es läuft hierauf hinaus: wir leben in einer Angstpsychose. Der fortwährende Alarmzustand, in dem wir uns befinden, lahmt die Initiative im eigenen Lande, tötet die Arbeitskraft, dämpft die Unternehmungslust und vergiftet das Leben. Es ist fast unmöglich, in „häuslichem Frieden“ um einen Tisch herumzusitzen, jeder mit seiner Arbeit, ruhig und munter, wenn da mitten auf dem Tische eine Zeitung liegt, in der die schrecklichsten Dinge stehen. Dinge, die wir nicht beurteilen können, deren Tragweite wir nicht zu messen vermögen, die ganz und gar außerhalb unserer Kompetenz liegen, aber die uns, gerade darum, mit einer vagen und zugleich panischen Angst erfüllen.
Es sind nun zwei Dinge zu sagen. Erstens: Wenn es wahr ist, daß es einen Krieg geben wird — einmal, in einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren — es doch nichts nützt, daß man dessen Möglichkeit uns jeden Tag vor die Nase setzt. Im Gegenteil, dann empfiehlt es sich eben, diese Zeit möglichst glücklich zu verbringen. Zweitens: Liegt Europa wirklich in den letzten Zügen? Hierauf kann man nur eine Antwort geben: ja. Wenn wir alle dieses ganz fest glauben, dann i s t es so. Wenn wir alle von dem Wahngedanken ausgehen, daß es um unsere Kultur geschehen ist und daß unsere Möglichkeiten alle sind, wenn wir in den verhängnisvollen Denkfehler verfallen, die abendländische Kultur mit einem Organismus zu vergleichen, der, wie alle Organismen, unentrinnbar seinem Verfall entgegengeht, dann wird dieses auch tatsächlich geschehen. Dann läßt sich nichts machen.
Aber, wenn wir einsehen, mit einem Blick auf die Geschichte, daß diese biologische Parallele auf einer Verwirrung zweier untereinander unvergleichbarer Verfahren beruht, daß eine Kultur durch eine bewußte Kraftanstrengung jener gerettet werden kann, die an sie glauben, daß sie nicht auf unmeßbaren Kräften von außen beruht, sondern auf dem Geist von innen, dann, und nur dann, sind wir gerettet.
Aus dem Niederländischen übersetzt von A. F. C. Brosens.




































































































