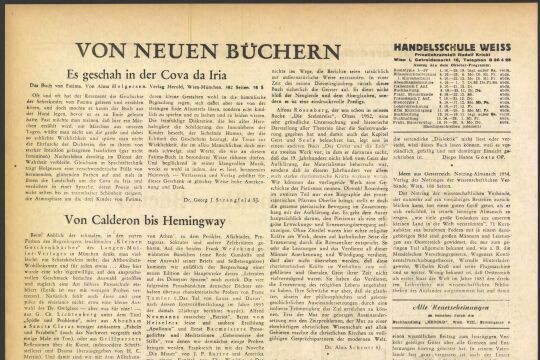Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hintergründiges Mexiko
Manuel der Mexikaner. Roman. Von Carlo
C o c c i o 1 i. Limes-Verlag, Wiesbaden 1959. 487 Seiten. Preis 19.80 DM.
In einem Brief an die deutschen Verleger bekennt sich Coccioli zu der Auffassung, daß die Literatur in unserer Zeit nur Botschaft oder Zeugnis sein könne. „Eine Literatur, die Selbstzweck wäre, lediglich ein Spiel, würde nicht die Aufgaben erfüllen, die man ihr in der Gemeinschaft der heutigen Menschen stellt.“
Und in dem hier vorliegenden Buch stehen die Worte: ' .
„Was mich interessiert, ist immer der Mensch. Er ist für mich das einzige, das unvergleichliche Objekt. Wenn ich alt sein und alle meine Bücher geschrieben haben werde, möchte ich, daß sich ein Bild aus ihnen herausschält, das des Menschen.“ , In jedem einzelnen Menschen, dessen Wege und Wesen.er mit Liebe und Anteilnahme verfolgt, sucht Coccioli das Allgemeinmenschliche, das Exemplarische, zu begreifen und sichtbar zu machen. .Dieser besondere Blickpunkt ist es wohl, der seinen Büchern ihre Unmittelbarkeit 'gibt, der seine Leser so in das Geschehen einbezieht, daß sie sich ganz persönlich angesprochen, ja aufgerufen fühlen. Sie müssen sich engagieren, ob sie wollen oder nicht,1 genau so wie sich der Verfasser niemals mit der Rolle des Beobachters und unbeteiligten Erzählers zufrieden gibt.
In „Manuel der .Mexikaner“ gestaltet Coccioli seine Begegnung mit Mexiko und mit einem Menschen, der dieses Land in geradezu unheimlicher Weise repräsentiert. Dieser Manuel, der von Seiten der Mutter einer reinrassigen Indianerfamilie an- • gehört, während sein Vater aus einem Fischerdorf an der, Küste, nahe bei Veraeruz, stammte, leidet an seinem „gespaltenen Blut“, aber mehr noch an der geistigen Zwiespältigkeit seines Volkes, dessen kontinuierliche Entwicklung durch die spanische Eroberung so verhängnisvoll unterbrochen wurde. Er will sich nicht zufrieden geben mit diesem Bruch und versncB'-dÄ: scrMer Unmögliche. Frieden zu stiften zwischen -dem Alten und Neuen, zwischen dem „2ei£absehniti itr i.'Götte und dem Zeitabschnitt Gottes“; denen beiden er gleichermaßen verhaftet ist. Er wird zum Verkünder der „Einheit der mexikanischen Zeit“, indem er erklärt, die alten Götter der indianischen Mythen seien eine Verkörperung des einen Gottes gewesen. „Gott, der Alleinige und Einzige, hat sich dieser Welt dargestellt durch den Sohn einer Jungfrau. Anderswo, von unserem Lande ! weit entfernt, haben sie diesem Sohn den Namen Jesus Christus gegeben. Hier in unserem Land wurde diesem selben Sohn ein anderer Naine gegeben ...“
Doch müssen wir einige Tatsachen nachtragen, die Coccioli in seinem hochdramatischen Vorspiel skizziert. Sie betreffen das Ende der bestürzenden Geschichte Manuels, von der der Autor verschiedentlich versichert, daß es sich darin in allen wesentlichen Punkten um wahre Begebenheiten handle. Wir begegnen in jenem Vorspiel dem Jüngling Manuel in Tlaltenalco, einem Dorf der mexikanischen Hochebene, in dem alljährlich die Passion Christi dar-gestellt wird. Im Jahre. 1954 tragen die Vertreter der Bruderschaft vom Geweihten Blut Manuel die Rolle des Gekreuzigten an, für die jeweils der Heiligste oder, der Sündigste gewählt wird. Auf Manuel scheint das erstere zuzutreffen — man vermutet in ihm den Retter eines Überfallenen jungen Mädchens des Dorfes —, bis er plötzlich als der Täter angeklagt wird. Das Spiel, das für Manuel, wie wir aus mannigfachen Andeutungen schließen dürfen, von Anbeginn keines war, verwandelt sich in blutigen Ernst. Der Jüngling stellt bei der Kreuzigung nicht mehr Christus dar, er ist das Opfer. Nicht nur das Opfer jener verleumderischen Anklage, von der offenbleibt, ob sie zu Recht besteht. . Man denkt bei diesem Opfer unwillkürlich an die Worte, die Manuel einmal erregt hinausgeschrien hat: . ..Keineswegs ist es ein einziger Erlöser, der am Kreuz stirbt! Sondern alle Erlöser bei allen Völkern der Erde sind darin eins .. .“ Coccioli hütet sich, von derartigen Zusammenhängen zu sprechen; er hält sich von jeder Deutung fern. „Nichts ist sicher und gewiß“, heißt es verschiedentlich. Erst im Verlauf der Geschichte Manuels, die der Autor nach dem „Vorspiel“ ihres dunklen Endes hinreißend erzählt, werden die Hintergründe teilweise enthüllt. Doch bleibt es eine Ge-schichte ohne eigentlichen Abschluß, ein ungewöhnlicher Roman, der mit Tagebuchblättern, Briefen und Anmerkungen zur „Geschichte Manuels“ endet, lauter Bruchstücke, die die Vielschichtigkeit der Ereignisse noch stärker ins Licht rücken; Spiegel einer Welt, die ebensosehr in christlichen wie in mythischen Bereichen wurzelt, in der ein leidenschaftlicher Katholizismus die magischen Elemente bis heute nicht zu verdrängen vermochte.
Es sei noch erwähnt, daß Coccioli, der dem Gehalt des literarischen Kunstwerkes so große Bedeutung beimißt, sich auch in formaler Hinsicht als Meister erweist. Unvergeßlich die Ursprünglichkeit und Ausdruckskraft seiner Sprache, die großartigen Schilderungen der fremden mexikanischen Welt, deren Wesen sich im Schicksal Manuels verdichtet.
Fast will es unfair erscheinen, neben dieses starke, bezwingende Buch ein anderes zu stellen. Aber mit dem Erstlingswerk der jungen, aus Ostböhmen stammenden Gudrun Pausewang, die jetzt in Südchile als Lehrerin wirkt, dürfen wir es wagen. Sie hat das Thema ihrer Erzählung aus ihrer neuen Umwelt genommen, eine eng begrenzte, psychologisch glänzend bewältigte Handlung, für die die Schilderung der chilenischen Wildnis den gemäßen Hintergrund abgibt.
Ein angehender indianischer Priester hat den Auftrag, eine junge europäische Lehrerin durch unwegsame Gebiete an die Küste zu führen. Begegnung zweier stolzer Menschen, deren Weg bisher gerade verlaufen ist und die nun aneinander alle Versuchungen und Verlockungen der Frau für den Mann, des Mannes für die Frau erfahren; die sich selbst und dem anderen nicht nachgeben wollen und einander doch nicht widerstehen können. Uralte animalische Instinkte werden da wach in zwei Menschen, die ihr Verhalten vom Geist, von ihrer religiösen Bindung, vom Willen bestimmt glauben und alle diese Sicherungen plötzlich zusammenbrechen sehen. Aber gerade der tiefe Fall der bisher Ungebeugten, die ihrer eigenen Kraft und Standhaftig-keit allzusehr vertrauten, erweist sich als das Tor in eine neue Freiheit, die nicht mehr auf Stolz, sondern auf Demut gegründet ist.
Es gibt Passagen in der 'Handlung, die in höchstem Grade heikel sind — die junge Lehrerin hat sich zum Beispiel nach dem Kriege, um einer drohenden Vergewaltigung zu entgehen, die eine Hand abgehackt, und diese Tat wirkt immer wieder auch in die hier geschilderten Ereignisse hinein —, erträglich nur durch die herbe Sprache und die strenge Gestaltung. Seltene Entgleisungen ins Pathetische wirken sofort peinlich. Im ganzen: ein vielversprechendes erstes Buch, das zu schönen Zukunftshoffnungen für die Verfasserin berechtigt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!